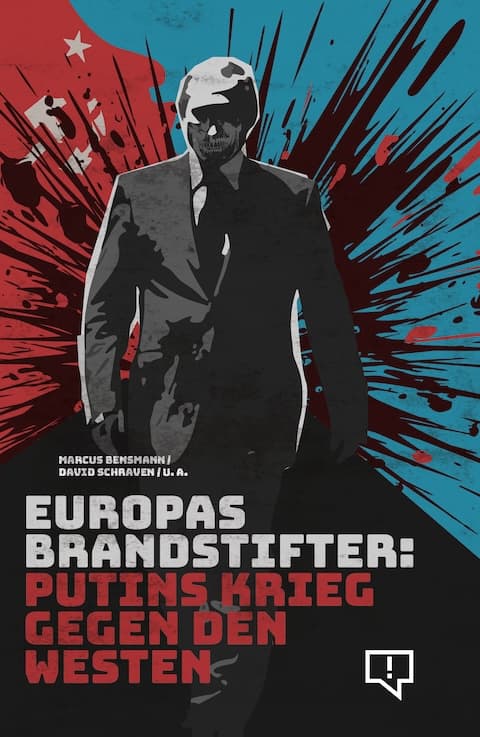Nach neuen Drohnensichtungen: Länder feilen an Abwehrkonzepten
Nach Sichtungen in Dänemark und Schleswig-Holstein sind auch in Niedersachsen wieder Drohnen unbekannter Herkunft gemeldet worden. Dort verfügt die Polizei noch nicht über die nötige Technik zur Detektion und Abwehr. Experten der Forschungseinrichtung Fraunhofer IOSB berichten von technischen Herausforderungen für Deutschland und Nebeneffekten der Drohnenabwehr.

Die vergangene Woche hat offenbart, wie vulnerabel Deutschland und Europa für feindliche Drohnen sind. Erst versetzten Drohnen unbekannter Herkunft Dänemark in Alarmbereitschaft. Kurz darauf gab es Meldungen auch aus Schweden, Norwegen und Lettland.
Am Freitag wurden dann auch in Schleswig-Holstein erneute Überflüge vermeldet. Der Spiegel berichtete, dass Drohnen wichtige Einrichtungen der kritischen Infrastruktur überflogen, darunter ein Kraftwerk und den Sitz der Landesregierung.
Das Ausmaß verdächtiger Drohnenüberflüge ist jedoch noch größer als bisher bekannt. Denn auch im benachbarten Niedersachsen wurden in der vergangenen Woche mehrere Fälle registriert, wie CORRECTIV erfuhr:
„In der vergangenen Woche ereigneten sich mehrere Drohnensichtungen, auch unbekannter Herkunft, an verschiedenen Orten in Niedersachsen“, teilte ein Sprecher des dortigen Innenministeriums auf Anfrage mit. Weiterführende Informationen könne man nicht mitteilen, da diese als vertraulich eingestuft sind.
Staatsanwaltschaft durchsuchte Frachtschiff
Beide Küstenländer sehen sich schon länger mit dem Phänomen von Drohnenüberflügen über Bundeswehrstandorten oder kritischer Infrastruktur konfrontiert.
Eine Vermutung ist, dass die Geräte von Russland von Schiffen aus der Nordsee gestartet werden könnten. Die Staatsanwaltschaft Flensburg hatte in diesem Zusammenhang Anfang Juli ein Frachtschiff durchsucht, das den Nord-Ostsee-Kanal passiert hatte.
Am Mittwoch haben jene Staatsanwaltschaft und die Innenministerin von Schleswig-Holstein, Sabine Sütterlin-Waack (CDU), den Landtag über die neuesten Sichtungen informiert. Es gebe „bisher keine gesicherten Erkenntnisse, wo die Drohnen herkommen“, sagte Sütterlin-Waack.
Man ordne die Sichtungen als Mittel hybrider Kriegsführung ein und habe mittlerweile auch mit dem dänischen Geheimdienst Kontakt aufgenommen.

Vermehrt Sichtungen unbemannter Flugobjekte
Nach den Sichtungen nahm auch die politische Diskussion an Fahrt auf. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) kündigte am Wochenende eine Neufassung des Luftsicherheitsgesetzes an.
Demnach soll die Bundeswehr künftig Drohnen abschießen dürfen. Eine solche Gesetzesänderung war Anfang des Jahres bereits vom SPD-geführten Innenministerium der Ampel-Regierung vorbereitet worden. Das Vorhaben kam aber seitdem nicht voran.
Das zögerliche Vorgehen überrascht. Denn das Phänomen verdächtiger Drohnenüberflüge erstreckt sich nicht nur auf einzelne Bundesländer.
Auch in der restlichen Bundesrepublik gab immer wieder Sichtungen unbemannter Flugobjekte über kritischer Infrastruktur und Bundeswehreinrichtungen – und zwar bereits seit 2022.
In einer früheren Recherche hatte CORRECTIV gezeigt, dass es 2024 mindestens 24 Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Ausspähungen durch Drohnen gab. Damals wollten die norddeutschen Länder an den Küsten „aus ermittlungstaktischen Gründen“ keine Angaben machen.

Wer ist für die Überflüge verantwortlich?
Wer für die Bekämpfung der mutmaßlich vom Putin-Regime gesteuerten Überflüge verantwortlich sein sollte, ist unklar. Die Bundeswehr? Oder die Bundespolizei? Oder doch lieber die Polizeibehörden der Bundesländer? Ein klares Konzept mit eindeutig geregelten Zuständigkeiten gibt es bisher nicht.
Auch die rechtlichen Befugnisse sind noch ungeklärt, ebenso die Frage, mit welchen technischen Mitteln sich die von Experten als existenziell eingeschätzte Bedrohung am besten eindämmen lässt.
Und weil die Klärung dieser Fragen auf sich warten lässt, mühen sich die Bundesländer derzeit noch, der Bedrohung mit Bordmitteln Herr zu werden. Die schleswig-holsteinische Innenministerin Sütterlin-Waack etwa fordert zwar mehr Befugnisse für die Bundeswehr, sieht also offenbar vor allem den Bund in der Verantwortung.
Im Landtag sagte Sütterlin-Waack aber auch, die Abwehr sollte „nicht durch Zuständigkeitsfragen verlangsamt werden“. Solange eine entsprechende Gesetzesänderung auf sich warten lässt, will man mit eigenen Konzepten voranschreiten.
Küstenländer arbeiten mit eigenen Drohnenkonzepten
Auf Anfrage bestätigte ein Ministeriumssprecher, dass durch die Landespolizei ein Konzept zur Drohnendetektion und Drohnenabwehr erarbeitet wurde, das sich nun in der Beschaffung befinde.
Die Landespolizei habe bereits 2024 Geräte zur Drohnenabwehr beschafft. Für 2025 wurden im Haushalt für das Konzept nochmals über fünf Millionen Euro zur Verfügung gestellt, sowie mehr Stellen für die Landespolizei und den Verfassungsschutz geschaffen.
Niedersachsen wiederum verfügt nach Auskunft des dortigen Innenministeriums bereits seit 2022 über ein Drohnenkonzept. Hinsichtlich Detektion, Verifikation und Abwehr von Drohnen sei es aktuell erweitert worden.
Bei der Beschaffung ist man noch nicht so weit wie im Nachbarland: „Die Polizei Niedersachsen verfügt gegenwärtig nicht über Technik zur Detektion, Verifikation und Abwehr von Drohnen, plant jedoch eine Beschaffung“, antwortete ein Ministeriumssprecher auf Anfrage von CORRECTIV.

Drohnenforschung am Fraunhofer-Institut: Technische Herausforderungen und Möglichkeiten im Überblick
Für CORRECTIV ordnete auch die Forschungseinrichtung des Fraunhofer-Instituts Karlsruhe die Frage ein, wie sich Deutschland besser gegen potenziell gefährliche oder spionierende Drohnen schützen kann. Im Bereich Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung (IOSB) wird intensiv zu Drohnen geforscht. Ein Sprecher nennt drei zentrale Punkte:
- Den Aufbau eines flächendeckenden Systems, um mit allen verfügbaren Techniken verdächtige Drohnenüberflüge erkennen zu können, um ein aussagekräftiges Lagebild zu erstellen
- Einen klaren Rechtsrahmen für Abwehrmaßnahmen – bislang sei die aktive Neutralisierung von Drohnen in vielen Fällen rechtlich schwierig oder unzulässig.
- Die Beschaffung und Integration verschiedener Abwehrsysteme.
Jedoch bestünden bislang noch erhebliche Hürden für eine flächendeckende Überwachung und Abwehr im Umfeld kritischer Infrastrukturen.
Dazu zählten: unklare und fragmentierte Zuständigkeiten, fehlende Befugnisse sowie die mangelnde Vernetzung zu einem zentralen Lagebild. Aber auch die grundlegenden technischen Herausforderungen bei der Detektion kleiner Drohnen, etwa der Unterscheidung „gut“ vs. „böse“ und bei der Abwehr, so der Sprecher.
Welche Schwierigkeiten gibt es in der Drohnendetektion?
Grundsätzlich stehen laut Fraunhofer verschiedene Sensoriken zur Verfügung, um unbekannte Drohnen zu detektieren – jede mit ihren eigenen Vorteilen und Begrenzungen. Im Wesentlichen sind dies:
Möglichkeiten zur Drohnenabwehr
- Funksignale: Steht die Drohne per Funk mit einer Bodenstation in Kontakt, etwa zwecks Fernsteuerung oder um Bilder zu übertragen, lassen sich die Funksignale orten. Eine Detektion und Identifikation ist oft sogar schon vor dem Start der Drohne möglich. Aber: Dies funktioniere nicht bei autonomen Drohnen, die ihren Weg selbständig finden beziehungsweise vorab via Flugweg („flight path“) programmiert wurden.
- Radar: Drohnen, die Radarsignale reflektieren, lassen sich wie andere Flugobjekte auch über größere Distanzen sehr genau orten, wenn sie in der Luft sind. Aber: Dies funktioniere nicht bei sehr kleinen oder überwiegend aus Plastik bestehenden Drohnen. Drohnen können das Radar unterfliegen.
- Optische Detektion: Mit verschiedenen Arten leistungsfähiger Kameras und KI-unterstützter Bildauswertung können Drohnen auf einige hundert Meter detektiert werden. Unter Einsetzung von thermischem Infrarot könne man auch in der Nacht operieren. Die Vorwarnzeit sei aufgrund der begrenzten Reichweite gering.
- Akustische Detektion: Funktioniert laut IOSB-Sprecher in realen Szenarien kaum, etwa in der Umgebung von kritischen Infrastrukturen oder in städtischen Bereichen, weil mit zu viel Schall durch Dritte zu rechnen sei.
Für Systeme, die Drohnen unterschiedlicher Klassen oder in unterschiedlichen Szenarien effektiv detektieren und gegebenfalls abwehren sollen, sei es unerlässlich, verschiedene Sensoriken und Wirkmechanismen zu kombinieren.
Drohnenabwehr: Vor- und Nachteile
Zwar existieren verschiedene Strategien, um Drohnen abzuwehren. Aber nach Angaben der Forschungseinrichtung jeweils mit Vor- und Nachteilen: Im zivilen Umfeld gehe es dabei etwa nicht nur um Technik.
Sicherheitsstandards und rechtliche Grenzen würden die Abwehr zusätzlich erschweren. Für die Drohnenabweher eingesetzte Laser- und Mikrowellenstrahlen könnten beispielsweise Herzschrittmacher beeinträchtigen.
Die wichtigsten Möglichkeiten zur Drohnenabwehr mit Vor- und Nachteilen:
- „Jamming“, also das Störung der Funksignale: Die Drohne kann vom Angreifer nicht mehr gesteuert und somit zum Landen gebracht werden. Nachteil: Kann auch andere funkbasierte Systeme stören oder wirkungslos sein, wenn die Drohne vorab via Flugweg (flight path) programmiert wurde.
- „Spoofing“, also die Manipulation der Drohne durch vorgetäuschte Steuersignale oder gefälschte GPS-Signale. Nachteil: Funktioniert nur bei Funkfernsteuerung beziehungsweise bei Nutzung von GPS. Und: Kann auch andere Systeme stören.
- Kinetische Geschosse: Der Nachteil ist die Gefährdung für jegliche andere Einrichtung, etwa den legitimen Luftverkehr sowie durch herunterfallende Drohnenteile und Geschosse.
- Flugabwehrraketen. Nachteile: Gefährdung und extrem hohe Kosten.
- Mikrowellen- oder Laserstrahlen: Vorteile sind die geringen Kosten pro Schuss. Die Nachteile: Operationelle Systeme seien noch kaum verfügbar.
- Bei Lasern bestünde außerdem das Problem einer Blendgefahr durch reflektierte und gestreute Strahlung sowie die Schwierigkeit eines anspruchsvollen Trackings. Das heißt, die Strahlung muss längere Zeit treffen, um genug Schaden zu verursachen.
- Bei Mikrowellen bestünde außerdem eine Gefahr in Kollateralschäden aufgrund begrenzter Fokussierungsmöglichkeit. HPM („High Power Microwaves“) würden laut IOSB auch jeden Herzschrittmacher gefährden.
- Abfangdrohnen, die die Zieldrohne rammen oder in der Nähe explodieren. Nachteile: begrenzte Geschwindigkeit, Gefährdung.
- Abfangen durch Netze oder Wasserwerfer: sehr begrenzter Wirkradius, allenfalls für Minidrohnen realistisch.
Verfügbare Systeme und Forschungsbedarf im zivilen Bereich
Der Sprecher der Forschungseinrichtung IOSB verweist abschließend auf eine weitere Schwierigkeit: „Aufgrund der beschriebenen Herausforderungen sind nach unserer Kenntnis bis dato keine umfassenden, gut funktionierenden Lösungen für die Detektion von Minidrohnen verfügbar, geschweige denn für deren Abwehr.“
Dem gegenüber steht, dass ukrainische Soldaten seit dem russischen Überfall auf die Ukraine eigene Entwicklungen einsetzen, um anfliegende Drohnen zu detektieren. Die low-cost-Geräte decken Frequenzen handelsüblicher kleiner DJI-Drohnen bis hin zu speziellen russischen Spionagedohnen ab.
Der Sprecher macht deutlich, dass es zwar durchaus Möglichkeiten gebe, Drohnen zu erkennen (etwas das institutseigene System „MODEAS“ zur Drohnendetektion).
Es fehle jedoch an finanzieller Unterstützung: Für die Weiterentwicklung zu einem einsatzfähigen System sei „noch einiger Forschungs- und Entwicklungsaufwand nötig“, der nur mithilfe von Fördermitteln oder im Rahmen einer Beauftragung durch die Industrie leisten könnten – „beides ist derzeit nicht gegeben“.
Text: Alexej Hock, Samira Joy Frauwallner
Redigat: Anette Dowideit, Ulrich Kraetzer
Fakencheck: Finn Schöneck