Merz’ Stadtbild-Aussage aus Mitschrift gestrichen: Was besagt das Neutralitätsgebot
Nachdem Merz sich abfällig über Migrantinnen und Migranten im „Stadtbild“ geäußert hatte, landete die umstrittene Passage nicht in der Mitschrift auf der Kanzler-Webseite. Laut Regierungssprecher ein normaler Vorgang und dem Neutralitätsgebot geschuldet. Ist das wirklich normal?

Als Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz Mitte Oktober sagte, beim Thema Migration gebe es ein „Problem“ im Stadtbild, war die Aussage überall. Sie sei „respektlos“ und „blanker Rassismus“, hieß es aus der Opposition. Beim Koalitionspartner war von Populismus die Rede, Medien schrieben von einem „bewährten Kampfbegriff der AfD“ und Fachleute sahen Parallelen zum Nationalsozialismus.
Doch an einer Stelle fehlte die Aussage komplett: In der offiziellen Mitschrift der Veranstaltung auf der Webseite des Bundeskanzlers. Dort sind in der Passage, wo es um das Stadtbild ging, nur drei Punkte in runden Klammern.
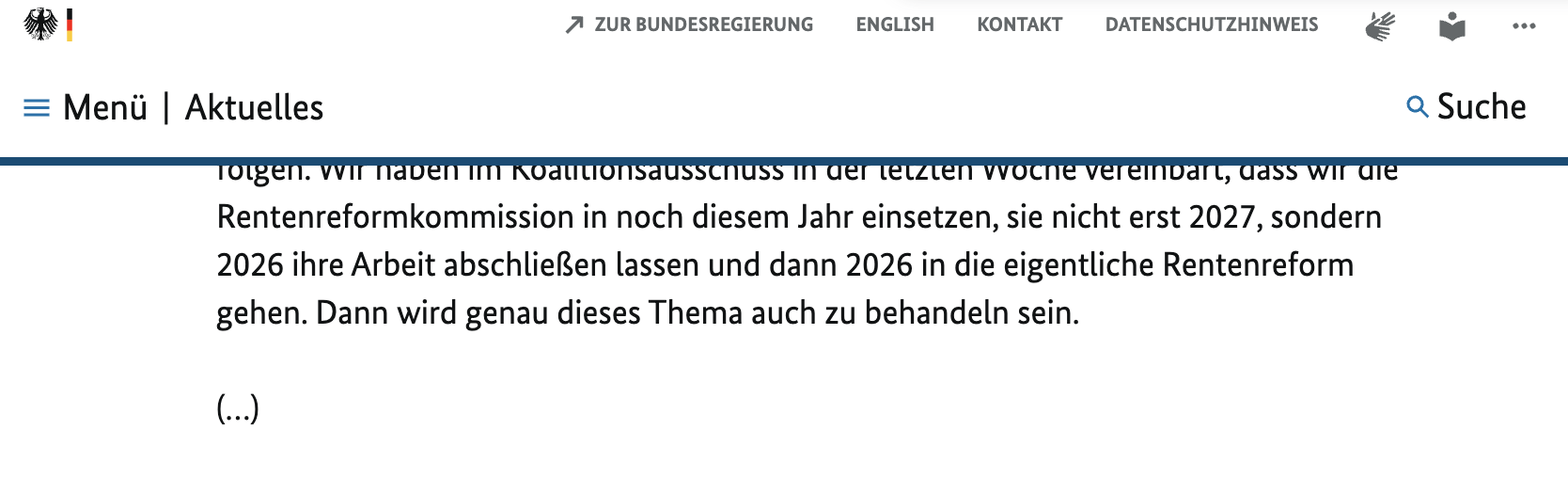
Warum, wollte am Tag nach der Aussage ein Journalist von Stefan Kornelius, Regierungssprecher und Chef des Bundespresseamts, wissen. Der Bundeskanzler, so Kornelius, habe sich bei der Stadtbild-Aussage „klar als Parteivorsitzender zu erkennen gegeben“, wegen des Neutralitätsgebot sei diese parteipolitische Äußerung nicht veröffentlicht worden. „Das ist die übliche Praxis in solchen Fällen und keinerlei Neuigkeit“, sagt Kornelius.
Tatsächlich betonte Merz bei seinem Antrittsbesuch in Brandenburg, kurz bevor er über das Stadtbild sprach, dass er sich nun „parteipolitisch“ äußere. Es folgten Aussagen über die AfD, Rechtspopulismus und CDU-Politik. Dass so eine Passage aus der Mitschrift gekürzt wird, ist jedoch nicht so selbstverständlich, wie Kornelius behauptet.
Kürzungen in Merz-Mitschriften sind selten
Eine Datenauswertung von CORRECTIV.Faktencheck von allen Reden und Pressekonferenzen von Merz in seiner Amtszeit, die auf der Seite des Kanzlers veröffentlicht wurden, zeigt: Bisher wurde nur zwei weitere Male eine Stelle mit drei Punkten in der Mitschrift markiert (allerdings in eckigen, nicht, wie beim „Stadtbild“ in runden Klammern).
Beide Male stehen die Punkte am Beginn eines Zitats, das Merz vorträgt: Einmal vom Philosophen Walter Benjamin und einmal aus Star Trek. In beiden Fällen markieren sie offenbar eine Auslassung im Zitat. Dass eine eigene Aussage von Merz oder eine ganze Antwort fehlen, ist jedoch – soweit nachvollziehbar – bislang einmalig und keineswegs übliche Praxis, wie Kornelius behauptete.
Umgekehrt ist jedoch häufig in den Mitschriften zu lesen, dass sich Merz sowohl als CDU-Vorsitzender und gleichzeitig als Bundeskanzler äußert. Zum Beispiel, als er nicht wie kürzlich den SPD-Ministerpräsidenten Dietmar Woidke in Brandenburg zum Antritt besuchte, sondern bei einem Antrittsbesuch seines Fraktionskollegen Markus Söder in Bayern. Dort leitet er einen Satz ein mit: „Diese parteipolitische Bemerkung will ich mir erlauben“ und spricht dann von der guten Zusammenarbeit in der Union. Anfang Oktober leitete Merz in einer Pressekonferenz eine Passage über die „sehr, sehr gute, sehr kollegiale, sehr offene Arbeitsatmosphäre“ in der Koalition ein mit den Worten, das sage er als Kanzler und als Parteivorsitzender der CDU. Im Juli stellte eine Journalistin eine Frage explizit an den „Abgeordneten“ Merz. Frage und Antwort sind in der Mitschrift nachzulesen.
Ein kurzer Blick auf die Zeiten vor Merz’ Amtsantritt: Auch Kanzler und Kanzlerin vor ihm haben sich in ihren weiteren Funktionen geäußert. So findet sich etwa auch eine Mitschrift von einer Aussage Olaf Scholz’ auf der Seite der Bundesregierung, in der er davon erzählt, wie er mit 17 in „meinen Freundeskreis, genannt die SPD,“ eingetreten sei. Von Angela Merkel ist dort auch eine Rede bei einem CDU-Festakt verschriftlicht, in der sie als CDU-Vorsitzende spricht.
Neutralitätsgebot soll andere Parteien vor Nachteilen schützen
Das Neutralitätsgebot leitet sich aus dem Grundgesetz ab und wird durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts konkretisiert. Im Kern geht es darum, dass etwa ein Bundeskanzler durch sein Amt keine Ressourcen für Parteizwecke nutzen darf, die der Opposition nicht zur Verfügung stehen. Dazu gehört auch die Autorität des Postens als Bundeskanzler: Ein Kanzler darf keine parteipolitischen Äußerungen machen, auch nicht für die eigene Partei, weil die anderen Parteien keine Person in so hoher Machtposition haben und daher benachteiligt wären.
Besonders bekannt ist ein Urteil gegen Angela Merkel, nachdem sie 2020 auf einer Pressekonferenz in Südafrika über die Wahl von Thomas Kemmerich (FPD) zum Ministerpräsidenten Thüringens gesprochen hatte. Für ihn hatten auch AfD-Abgeordnete gestimmt. Für Merkel ein „schlechter Tag für die Demokratie“. Gleich ein zweifacher Verstoß gegen das Neutralitätsgebot, entschied das Gericht: Erstens durch die Aussage an sich, zweitens dadurch, dass die Aussage auch auf den Internetseiten der Bundeskanzlerin und der Bundesregierung zu lesen war.
In dem Urteil ist auch nachzulesen, unter welchen Bedingungen das Neutralitätsgebot besonders gilt. So mache es einen Unterschied, ob ein Regierungsmitglied auf einer Regierungsveranstaltung spricht oder im Rahmen einer Talkshow oder eines Interviews – bei letzterem brauche es eine „differenzierte Betrachtung“. Im Urteil steht auch: Merkel hätte darauf hinweisen können, dass sie „nicht in ihrer Eigenschaft als Bundeskanzlerin, sondern als Parteipolitikerin oder Privatperson äußern werde“.
Fachleute sehen Streichung der „Stadtbild“-Aussage als legitim – aber uneinheitlich
Für Joachim Wieland, Verfassungsrichter in Nordrhein-Westfalen, haben Merz und der Bundespressedienst im aktuellen Fall die Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts erfüllt: Merz wies auf seine Funktion als CDU-Parteivorsitzender hin, gleichzeitig wurde die Webseite des Kanzleramts nicht zur Verbreitung genutzt. Wieland war unter anderem 2014 Prozessbevollmächtigter für den damaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck in einem Prozess rund um das Neutralitätsgebot, in einem anderen Prozess war er Bevollmächtigter der damaligen Bundesfamilienministerin von der SPD.
Für Vivian Kube, Rechtsanwältin mit Fokus auf Grund- und Menschenrechte, ist ebenfalls schlüssig, dass die Passage nicht in der Mitschrift zu finden ist. Sie sagt aber auch: Wird das Neutralitätsgebot so streng ausgelegt, dass die Aussage nicht im Transkript erscheinen soll, dann hätte Merz sie gar nicht erst bei einem Amtsbesuch tätigen sollen. So wirke es, als werde das Neutralitätsgebot im Nachhinein nur „vorgeschoben“.
Worin Kube und Wieland sich einig sind: Dass die Vorgangsweise unter Merz als Kanzler uneinheitlich ist – das zeigen auch die oben genannten Beispiele. Das liege auch daran, dass das Neutralitätsgebot schwer umsetzbar sei. Wieland dazu: „Politiker tun sich schwer damit, klarzumachen, welchen Hut sie gerade aufhaben“. Kube sagt: „Man kann auch die bisherige Rechtsprechung als lebensfremd kritisieren. Das Kanzleramt ist kein neutrales Amt, alle wissen, dass der aktuelle Kanzler zur CDU gehört“.
Politikwissenschaftlerin: Merz muss Rechenschaft für Aussagen ablegen, also müssten sie auch in die Mitschrift
Paula Diehl, Professorin für Politische Theorie und Politische Kultur an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel ordnet die Debatte rund um die „Stadtbild“-Aussage nicht aus einer juristischen, sondern aus einer politiktheoretischen Perspektive ein. Den Begriff der Neutralität hält sie dabei für fehl am Platz. Merz sei Parteivorsitzender, Kanzler und Teil einer Koalition, daher sei es normal, dass er bei allem, was er sagt, auch als CDU-Repräsentant spreche, sagt auch sie.
Relevant sei vielmehr, welche dieser Rollen er repräsentiert, wenn er spricht. In all seinen Rollen müsse er zu seiner Aussage stehen und diese rechtfertigen können. Deswegen gehöre sie auch in das Transkript. Dass die Aussage gestrichen wurde, verletzt nach Ansicht von Diehl das Prinzip der Accountability, also die Rechenschaftspflicht, die Politikerinnen und Politiker haben: „Die Bürgerinnen und Bürger haben ein Recht zu wissen, was die Regierenden tun und sagen, und die Öffentlichkeit kann nach Erklärungen verlangen“.
CORRECTIV.Faktencheck kontaktierte das Bundespresseamt mit dem Vorwurf, das Vorgehen rund um die Stadtbild-Aussage wirke für Fachleute vorgeschoben, verstoße gegen die Rechenschaftspflicht und passe teils nicht zur bisherigen Praxis. Ein Sprecher schreibt: „Ob das Neutralitätsgebot relevant ist, muss in jedem Einzelfall geprüft werden. Wir überprüfen unsere Praxis dazu regelmäßig und passen sie gegebenenfalls an.“
Mitarbeit und Datenanalyse: Sara Pichireddu
Redigatur: Steffen Kutzner, Paulina Thom
Die wichtigsten, öffentlichen Quellen für diesen Faktencheck:
- Pressekonferenz von Bundeskanzler Merz und Ministerpräsident Woidke zum Antrittsbesuch des Kanzlers in Brandenburg, 14. Oktober 2025: Link (archiviert)
- Abschlusspressekonferenz zur Kabinettsklausur in der Villa Borsig, 1. Oktober 2025: Link (archiviert)
- Rede des Kanzlers beim Parlamentskreis Mittelstand der Unionsfraktion, 8. Juli 2025: Link (archiviert)
- Sommer-Pressekonferenz des Bundeskanzlers, 18. Juli 2025: Link (archiviert)



