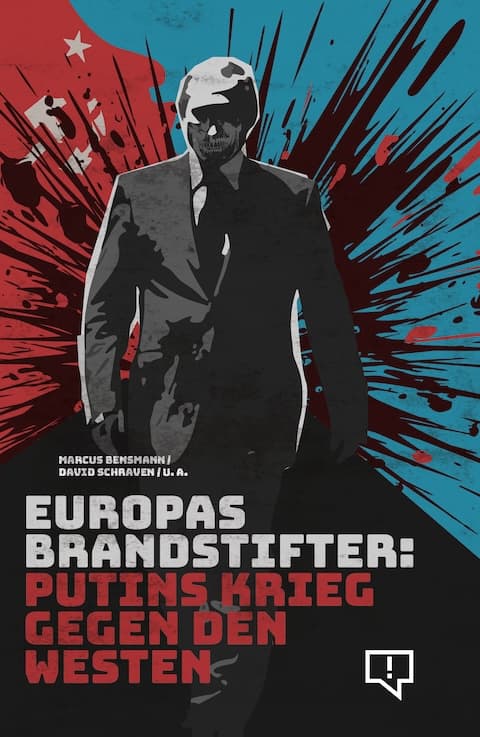Trotz Sanktionen: Europas Maschinen für Putins Krieg
Europas Rolle für Russlands Aufrüstung ist deutlich größer als bisher bekannt: Mehr als 28.000 Mal lieferten deutsche und europäische Firmen kurz vor dem Angriffskrieg Güter mit potenziell doppeltem Verwendungszweck. Das Beispiel einer süddeutschen Firma zeigt, welche Folgen das hat.

Das Wichtigste in Kürze
- Ohne Werkzeugmaschinen aus dem Ausland könnte Russland viele seiner Waffen nicht produzieren. Einmal im Land, laufen sie jahrelang.
- Deutsche und europäische Firmen lieferten kurz vor dem Angriffskrieg zehntausende Male Maschinen und Teile, die auch militärisch genutzt werden können.
- Das belegt diese Analyse russischer Importdaten.
„Vergesst das nicht“ – Es ist Ende Februar, als Sergey diese Nachricht auf seinem Telegram-Kanal veröffentlicht, auf dem er seit Jahren dokumentiert, welche Waffen Russland in der Ukraine einsetzt. „Die weißen Schaumstoffattrappen des Gerbera-Luftverteidigungssystems enthalten verschiedene Arten von Sprengköpfen – 3 bis 5 kg Sprengstoff!“
Die Gerbera ist eine russische Drohne, günstig aus Schaumstoff, Styropor und Holz gebaut. Ihr Hauptzweck: Ukrainische Luftabwehrsysteme überlasten. Die Gerbera stellt die Verteidigung vor ein Dilemma – viele der Drohnen sind harmlose Täuschkörper, deren Abschuss nicht zwingend nötig, aber teuer wäre. Doch einige der Modelle tragen Kameras oder Sprengladungen, wie jene, die Sergey in diesem Winter auf Bildern dokumentiert. Sie können also lebensgefährlich werden.
Auch die Europäische Union wurde in diesem Jahr mit der Gerbera konfrontiert. Als eine der Drohnen in den polnischen Luftraum eindrang, versetzte das die NATO in Alarmbereitschaft.
Europa stützt den russischen Krieg
Russland kann Drohnen wie die Gerbera, samt Kamera und Sprengkopf, dank Unterstützung aus dem Ausland bauen: Ein Großteil seiner Waffenproduktion wäre ohne importierte Maschinen schlicht nicht möglich. Europa, darunter auch Deutschland, hat mit seinen Lieferungen zur russischen Aufrüstung beigetragen – deutlich stärker, als bisher bekannt. Das belegt diese Recherche von CORRECTIV.Europe.
Der Sprengkopf der von Sergey dokumentierten Drohne wird laut Analyse des Ukrainischen Zukunftsinstituts vom russischen Rüstungsunternehmen Npo Basalt hergestellt. Dafür sind unterschiedliche Maschinen zur Metallbearbeitung notwendig.
Ob alle Stellen sauber verschweißt sind, ob der gesamte Sprengkopf keine Risse, Dichtungsfehler oder strukturelle Schwächen aufweist, wird am Ende ebenfalls mit einer Industriemaschine geprüft. Eine Maschine, die das kann, ist der CR-Scanner HD-CR 35 NDT des deutschen Herstellers Dürr Ndt. Recherchen von CORRECTIV.Europe belegen, dass die Rüstungsfirma Npo Basalt genau dieses Gerät kaufte.
Der Weg der Produkte des deutschen Unternehmens Dürr Ndt zeigt exemplarisch, wie potentielle dual-use Produkte wohl trotz Sanktionen in einige der am stärksten abgeschotteten russischen Rüstungsbetriebe gelangen konnten.
Güter wie der HD-CR 35 NDT von Dürr Ndt können sowohl zivil als auch militärisch eingesetzt werden, daher können Behörden sie als Dual-Use-Gut einordnen. Im Falle des CR-Scanners ist die potentielle militärische Nutzung eindeutig erkennbar, das Unternehmen wirbt auf einem Flyer dafür. Seit 2014 unterliegen solche Produkte beim Export nach Russland immer strengeren EU-Sanktionen. Bis zur Veröffentlichung dieser Recherche reagierte das Unternehmen Dürr Ndt nicht auf detaillierte Anfragen der Redaktion.
Die Jahre vor der Vollinvasion waren für Russlands Aufrüstung entscheidend
Gerade die Zeit vor 2022 war für die russischen Vorbereitungen des Angriffskriegs auf die Ukraine essentiell – und so auch die Werkzeugmaschinen, die europäische Staaten damals lieferten. Unsere Analyse zeigt: Zwischen 2019 und März 2022 gingen über 28.000 Lieferungen nach Russland, die mit hoher Wahrscheinlichkeit Dual-Use-Güter enthielten, also solche, die nicht nur zivil, sondern auch militärisch genutzt werden können. Allein aus Deutschland waren es 9.273 Lieferungen. Die Maschinen produzieren potentiell bis heute in der Rüstungsindustrie für Putins Krieg.
CORRECTIV.Europe hat in Kooperation mit dem freien Journalisten Dylan Carter und der Platform Tools of War über 861.882 Importdaten Russlands aus den Jahren 2019 bis März 2022 ausgewertet. Die Daten stammen von Import Genius, einem us-amerikanischen Handelsinformationsunternehmen.
Die Daten umfassen exportierte Werkzeugmaschinen aus allen EU-Staaten, der Schweiz, dem Vereinigten Königreich, Norwegen, der Ukraine, der Türkei und Island an die russische Industrie, einschließlich der Rüstungsindustrie. Sie liefern außerdem Details, wann welche Güter von welchen Standorten und Unternehmen in Europa ihren Weg in die russische Industrie gefunden haben.
Methodik und Daten
Der Datensatz mit russischen Zolldaten stammt von ImportGenius. Nach der Bereinigung umfasst er 861.882 Einträge zu Werkzeugmaschinenimporten von 2019 bis 2022. Er enthält Lieferungen aus der EU, dem Vereinigten Königreich, Norwegen, der Ukraine, der Schweiz, der Türkei und Island. Zu jedem Eintrag gibt es Produktangaben, Informationen zu Importeur und Versender, geolokalisierte Adressen, das Versanddatum und den angegebenen Frachtwert. 125.536 Einträge wurden per KI als potenziell militärisch riskant und somit als potentielle Dual-Use-Güter eingestuft – 94.293 davon stammen aus EU-Staaten.
Bereinigung der Daten
Die Daten wurden in zwei Schritten ausgewertet. Zuerst entschlüsselte das Team von Dylan Carter die Adressen der Absender und Importeure. Danach nutzten sie ein KI-Modell, das mit handgeprüften Datensätzen trainiert wurde. Die KI schätzt ein, wie groß das Dual-Use-Risiko eines Guts ist. Ihr F1-Wert liegt bei etwa 0,74. Der F1-Wert fasst zusammen, wie gut das Modell sowohl falsche Treffer als auch übersehene Fälle vermeidet. Ein Wert von 1 wäre perfekt, ist aber unerreichbar.
CORRECTIV.Europe bereinigte die Daten weiter: Ländernamen wurden vereinheitlicht, regionale Angaben ergänzt, Beschreibungen und Namen ins Englische übersetzt. Außerdem wurden Versendernamen mithilfe spezieller Software zusammengeführt, wenn sie in unterschiedlichen Varianten vorkamen. So konnte am Ende nicht nur die Redaktion, sondern auch ihr Netzwerk aus lokalen und freien Medienschaffenden in ganz Europa mit dem Datensatz arbeiten.
Limitation
Trotz der großen Datenmenge gibt es klare Grenzen. Werkzeugmaschinen können sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden. Einzelne Datensätze beweisen daher keine sanktionierten Exporte oder eine direkte Rolle in der russischen Rüstungsproduktion. Die KI liefert nur Hinweise, keine endgültigen Bewertungen. Diese muss einzeln überprüft werden. Zudem gibt es Lücken in den Rohdaten, etwa fehlende Versenderadressen in Teilen des Jahres 2020. Dennoch zeigen die Daten deutlich, wie umfangreich und konstant die Lieferungen von Werkzeugmaschinen nach Russland in den Jahren 2019 bis Anfang 2022 waren.
Die größte Produktgruppe der exportierten Werkzeugmaschinen sind Mess- und Prüfgeräte. Alle Produkte, die unter diese Kategorie fallen, können sowohl zivil als auch militärisch eingesetzt werden. Ob sie auch offiziell als Dual-Use-Güter gelten, lässt sich nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit bestimmen. Klar ist: Sie sind für jahrelangen Einsatz gebaut – und bleiben, einmal in der Rüstungsindustrie gelandet, dauerhaft Teil der Aufrüstung. Die meisten Lieferungen stammen aus Ländern wie Deutschland, Italien und Schweden.
Nach der Annexion der Krim 2014 können Exporte von solchen Gütern gemäß EU-Sanktionen eine Sondergenehmigung erfordern. Dürr Ndt beantwortete Fragen dazu, wie seine Geräte zu einem sanktionierten russischen Rüstungsbetrieb gelangen konnten, nicht.
Unsere Recherche zeigt: 2010 ernannte Dürr Ndt das in Sankt Petersburg ansässige Unternehmen Newcom Ndt zum exklusiven Distributor für Russland, Belarus und den Kaukasus. Über Newcom gelangten Bildplatten, Scanner und Radiografiesysteme von Dürr Ndt auf den russischen Markt.
Ein Vertrag, archiviert vom ukrainischen Verteidigungsministerium, belegt: Im Dezember 2016 lieferte das russische Vetriebsunternehmen Newcom Ndt dem sanktionierten staatlichen Sprengstoffhersteller Npo Basalt einen Radiografiescanner des Typs Dürr Ndt HD-CR 35. Der Vertrag nennt das Modell explizit. Zu diesem Zeitpunkt war Basalt seit zwei Jahren durch die EU sanktioniert – und hätte diese Technologie nicht erhalten dürfen.
Ein Schattenpfad in die Rüstungsindustrie
Schon vor dem russischen Großangriff begannen Importeure sensibler Güter, Netzwerke zur Sanktionsumgehung aufzubauen. Newcom Ndt bildet dabei keine Ausnahme. Bereits 2011 gründete das Unternehmen die Tochterfirma Alfa-Test – wohl mit dem Ziel, Kunden zu erreichen, die kaum Aussicht auf Exportausnahmen hatten.
Bis kurz vor der Invasion war Alfa-Test zu einem Lieferanten mehrerer besonders eingeschränkter Rüstungsbetriebe geworden. Archivierte Beschaffungsunterlagen, ausgewertet von CORRECTIV.Europe, zeigen: Über die Tochterfirma Alfa-Test gelangte Dürr-Technologie wohl trotz Sanktionen an den russischen militärisch-industriellen Komplex – an Unternehmen, die mit Nuklearmaterial, Sprengstoffen, Luftverteidigungssystemen und Raketentechnologien befasst sind.
Dokumente der staatlichen Plattform für das öffentliche Beschaffungswesen in Russland, besagen, dass ein Ingenieurbüro, das zur Atomwaffensparte des staatlichen russischen Nuklearkonzerns Rosatom gehört, ein XR 24 NDT-Gerät kaufte. Dieses findet sich bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung im Katalog von Dürr Ndt. Außerdem erwarb ein Tochterunternehmen von Rosatom 2015 ein Dürr Ndt XR 35-System. Und das Forschungsinstitut für Elektrophysikalische Ausrüstung D. W. Jefremow – Hersteller von Komponenten für Fusionsreaktoren und supraleitende Systeme – erhielt ein Radiografiesystem vom Typ Dürr Ndt HD-CR 35.
Wie versuchen Politik und Behörden zu verhindern – und so auch Hersteller zu schützen – dass Dual-Use-Produkte in der russischen Rüstungsindustrie landen?
Russland-Sanktionen verschärfen Export von Werkzeugmaschinen
Die EU-Verordnungen 833/2014 und 2021/821 legen fest, welche Exporte sanktioniert sind. Seit Russlands Annexion der Krim 2014 wurden die Regelungen kontinuierlich verschärft, um die Sicherheitsinteressen der EU zu schützen.
So funktionieren die Russland-Sanktionen
Um sicherzustellen, dass Handel und Export nicht gegen Sicherheitsinteressen des Herkunftslandes verstoßen, unterliegen sie entsprechenden Richtlinien. Nach Russlands Annexion der Krim 2014 hat die EU den Export von Dual-Use-Gütern sanktioniert, wenn der Empfänger ein Rüstungsunternehmen war. Insbesondere 2022 wurde die Regulierung verschärft.
Zwar sind Werkzeugmaschinen prädestiniert, um entsprechend klassifiziert zu werden, doch eben diese Einstufung ist die erste Hürde in einem sehr komplexen System: Oft lässt sich nicht klar trennen, ob ein Gut militärisch und – beziehungsweise oder – zivil genutzt werden kann. Denn auch Alltagsprodukte können darunter fallen. Beispielsweise einfache Bauteile wie Scharniere, die sowohl in Koffern als auch in der Rüstungsindustrie verwendet werden,
International war lange das Wassenaar-Arrangement entscheidend, das festlegt, welche Güter als Dual-Use gelten und wie ihr Export kontrolliert wird. Seit 2022 ist das System eingeschränkt, da Russland als Kriegspartei beteiligt ist.
Auf EU-Ebene regeln die EU-Verordnungen 833/2014 und 2021/821, welche Güter für Exporte kontrollpflichtig sind. Auch nicht gelistete Güter können kontrolliert werden, wenn sie militärisch genutzt werden könnten. Eine Expertenkommission legt fest, welche Produkte als Dual-Use gelten. In den letzten elf Jahren sind diese Listen und die Russland-Sanktionen stark gewachsen.
Für deutsche Unternehmen wie Dürr Ndt hat sich über die Jahre eines nicht geändert: Vor jedem Export müssen sie prüfen, ob ihre Produkte als Dual-Use-Gut eingestuft sind und ob der Empfänger auf einer Sanktionsliste steht.
Bei den Russland-Sanktionen finden sich diese Informationen auf über 50 Anhängen der EU-Verordnung mit hunderten Seiten. Auf diesen sind unter anderem russische Unternehmen wie Npo Basalt gelistet, die nicht beliefert werden dürfen. „Die Einordnung für Unternehmen ist äußerst kompliziert und zeitaufwendig“ , sagt Katharina Neckel, Referatsleiterin Außenwirtschaftsrecht und Handelsvereinfachungen bei der Deutschen Industrie- und Handelskammer. Die Kammern könnten zwar unterstützen, leisten aber keine Rechtsberatung. „Und auch sie stoßen aufgrund begrenzter Ressourcen und Zuständigkeiten schnell an ihre Grenzen.“
Falls der Empfänger nicht auf der Sanktionsliste steht, das Produkt jedoch als Dual-Use klassifiziert ist, ist eine Ausfuhrgenehmigung erforderlich. Das Unternehmen muss dann einen Antrag beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) stellen. Die Behörde prüft dann Empfänger, Endverbleib und technische Einstufung und stimmt sich bei Bedarf mit anderen Behörden wie dem Zoll ab. Erst nach offizieller Genehmigung darf das Gut ausgeführt werden.
Behörden in Deutschland sind mit Exportkontrolle überlastet
„Die Behörden können jedoch aufgrund bürokratischer Komplexität und hoher Arbeitsbelastung nicht jeden Export im Detail prüfen“, meint Christian von Soest, Leiter des Berlin Büros am Leibniz-Institut für Globale und Regionale Studien. Unternehmen berichten immer wieder von langen Bearbeitungszeiten und unklaren Zuständigkeiten zwischen verschiedenen Ämtern.
Ähnliches beobachtet auch Katharina Neckel: „Zu Beginn der Russland-Sanktionen hatte das BAFA teils Bearbeitungszeiten von mehreren Monaten. Mittlerweile berichten einige Unternehmen von durchschnittlichen Bearbeitungszeiten zwischen 20 bis 30 Tagen.“ Trotzdem sei das Amt teilweise heute noch überlastet. Das bestätigen auch weitere Experten gegenüber CORRECTIV.Europe. Aber ob das BAFA am Ende jeden einzelnen Antrag prüft oder nicht, scheint fraglich. Experten sind sich uneinig.
Das BAFA bestätigt auf Anfrage der Redaktion das Vorgehen der Behörde und äußert sich im Bezug auf die Wartezeiten wie folgt: Um der „berechtigten Kritik aus Unternehmerkreisen Rechnung zu tragen“, hätten Bundeswirtschaftsministerium und BAFA „im vergangenen Jahr umfangreiche Verfahrenserleichterungen und -beschleunigungen eingeführt, deren Wirkung sich im Abbau offener Vorgänge und der deutlichen Beschleunigung der Genehmigungsverfahren zeigt.“ Zudem würden sie jeden Antrag prüfen.
An den EU-Außengrenzen werden die Exporte vom Zoll kontrolliert – auch hier gibt es immer wieder Probleme. Zwar würden grundsätzlich Papiere vorliegen, doch „wenn die Ware nicht klar bezeichnet und in ihrer Funktion ersichtlich ist, ist es für Zollbeamte nicht einfach zu erkennen, ob sie eine Dual-Use-Ware ist“, sagt Frank Buckenhofer, Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei im Zoll. Außerdem stimme die Ware manchmal auch nicht mit den Papieren überein.
Der Zoll könnte aus seiner Sicht jedoch eine bedeutendere Rolle bei der Durchsetzung der Sanktionen spielen. „Er hat einen guten Überblick, wer mit wem über Grenzen handelt“, sagt Frank Buckenhofer. Nach den verschärften Sanktionen hätte er sich gewünscht, dass Firmen, die viel mit Russland handeln, gezielt eine zollseitige Gefährderansprache erhalten hätten. „Deutschland hat nicht genügend Sensibilität dafür, welche politischen oder militärischen Folgen solche Exporte nach sich ziehen können.“ Entsprechend schwach seien deutsche Zollbehörden bei der polizeilichen Verfolgung von Außenwirtschaftskriminalität und zur Sanktionsdurchsetzung von der Politik aufgestellt.
Katharina Neckel berichtet, dass inzwischen viele Unternehmen einen Null-Bescheid beantragen: Eine Bestätigung der Behörde, dass für einen konkret beschriebenen Export keine Genehmigungspflicht besteht: „Damit schaffen sich Unternehmen rechtliche Sicherheit für den Einzelfall. Allerdings ersetzt ein Null-Bescheid weder die eigene Prüfpflicht der Unternehmen noch allgemeine Kontrollen durch BAFA oder Zoll. Gleichzeitig schützen die Unternehmen sich vor rechtlichen Risiken und möglichen Reputationsschaden.“
Unternehmen haften für den Endverbleib ihrer Produkte
Doch weder BAFA noch Zoll tragen am Ende alleine die Verantwortung: Die Geschäftsführung der exportierenden Unternehmen haftet dafür, wohin ihre Güter gelangen: Die Endverbleibsklausel verpflichtet Hersteller genau zu wissen, wo ihre Produkte am Ende landen. Sie soll verhindern, dass Güter beispielsweise über Zwischenhändler weiterverkauft oder reexportiert werden – doch in der Praxis machen einige Unternehmen damit einfach weiter: „Genau das ist ein zentrales Problem der Russland-Sanktionen und der europäischen Exportkontrollen“, sagt Christian von Soest. Wobei versuchte oder tatsächliche Verstöße gegen die Sanktionen gemeldet werden müssen. Es drohen Bußgelder oder sogar strafrechtliche Folgen.
Die Wege, über die Waren ab 2022 vom europäischen Kontinent nach Russland gelangten, sind sehr unterschiedlich: Einige Lieferungen passierten offenbar direkt, weil sie durch die Kontrollen rutschten. In anderen Fällen wurden wohl Lieferdokumente unterwegs ausgetauscht. Häufig erfolgte der Export jedoch über Drittstaaten und Zwischenhändler, um die Sanktionen zu umgehen.
Laut dem Datensatz, der CORRECTIV.Europe und seinen Partnern vorliegt, gelangten Produkte von Dürr Ndt vor allem nach der Vollinvasion 2022 nicht mehr direkt nach Russland, sondern über die Türkei und China. Das Deutsche Unternehmen Dürr Ndt reagierte auf entsprechende Nachfragen der Redaktion nicht.
Offiziell ist es noch möglich, dass für Güter wie die Scanner von Dürr Ndt eine Sondergenehmigung zur Ausfuhr erteilt wird – vorausgesetzt, dass sie humanitäre oder medizinische Zwecke erfüllen. Grundsätzlich könnten die Produkte von Dürr Ndt diesen Anschein erwecken. Doch die Liste von Referenzen auf ihrer Webseite gibt auch eine andere Richtung vor. Unter anderem sind Namen wie Airbus defence & space, Rheinmetall, Shell und Areva gelistet, letzteres ein Unternehmen aus der Nukleartechnik.
Die Exporte von Dürr Ndt mit dem Ziel Newcom Ndt liefen bis mindestens Anfang 2024. Noch nach Kriegsbeginn erreichten Waren im Wert von fast 1,7 Millionen US-Dollar so den russischen Markt. In mehreren Zoll-Einträgen ist vermerkt, dass die Geräte ursprünglich aus Deutschland stammen.
Im Februar 2025 stellte Newcom Ndt erneut einen Antrag bei russischen Behörden, um weitere CR 35-Geräte aus Deutschland einzuführen. Ob in Absprache mit Dürr Ndt kann die Redaktion nicht nachvollziehen.
Russland weicht auf Importe aus Drittstaaten aus
Dass immer wieder gegen die Exportsanktionen verstoßen wird, zeigt unter anderem eine weitere Recherche von CORRECTIV. „Seit Beginn des Angriffskrieges sind vor allem die Ausfuhren aus Europa über Zwischenhändler in Ländern wie der Türkei oder China stark angestiegen“, sagt Christian von Soest. Der abrupte Anstieg neuer Produktgruppen und Exporte, die ab 2022 aus diesen Staaten geliefert wurden, ließe sich in der Regel nicht durch ihre eigene Produktion erklären. Der Sanktionsexperte sieht hier einen Hinweis auf mögliche Weiterexporte nach Russland.
Außerhalb des Europäischen Kontinents spielen für die Umgehung der Importsanktionen für Russland gerade zentralasiatische Staaten eine wichtige Rolle. Denn Russland ist Mitglied der Eurasischen Wirtschaftsunion. Exporte in ein Mitgliedsland dieser Zollunion können mit geringeren bis keinen weiteren Zollkontrollen direkt eingeführt werden. China ist zwar nicht Mitglied, hat jedoch eine Kooperationsvereinbarung, die unter anderem die Zollkontrollen entschärfen soll.
Uwe Cantner, Volkswirt an der Universität Jena, erklärt, dass Umgehungen über China vor allem zu Beginn des Angriffskrieges wichtig waren. Zwar importiert Russland noch immer mehr Werkzeugmaschinen von dort als vor 2022, doch könne China inzwischen qualitativ mit deutschen Herstellern mithalten. Außerdem seien die Produkte im Vergleich kostengünstiger. „Vor 20 Jahren wären Importbeschränkungen für Dual-Use-Güter eine wirksame Sanktion gewesen – heute nicht mehr.“
Auch von Soest plädiert für eine realistische Erwartungshaltung: Sanktionen seien ein wichtiges politisches Signal, ihre Wirkung hänge aber stark von ihrer Umsetzung ab. „Sie treffen Russland als Ganzes und erhöhen die Kosten der Kriegsführung. Allein können sie aber keinen Kurswechsel erzwingen.“
Zudem zeigen Umgehungen, wie schwierig es ist, die Sanktionen wirksam zu implementieren: „Handel und Zahlungen verlagern sich oft in Schattennetzwerke“, sagt von Soest. Deswegen müssten laufende Sanktionen sowie Exportkontrollen ständig nachgeschärft werden.
Es sei schwer, die Wirkung der EU-Sanktionen in Russland genau einzuschätzen, meint Cantner. Aussagen aus dem Land ließen sich kaum auf ihre Glaubwürdigkeit prüfen. „Wirtschaftliche Sanktionen sind immer besser als militärische Maßnahmen. Auch wenn Europa dafür Kosten trägt, betrifft das in der Regel Geld, nicht Menschenleben.“
Am 9. November postet Sergey wieder einen Fund einer bewaffneten Gerbera-Drohne in seinem Telegram-Kanal und schreibt: Es müsse davon ausgegangen werden, dass der Sprengsatz noch scharf ist und selbst wenn die Drohne gelandet sei, aus der Ferne zeitversetzt ausgelöst werden könne. Der Krieg in der Ukraine zählt bis dahin 1.354 Tage und mehr als 14.000 tote Zivilisten.
Recherche und Text: Dylan Carter, Lilith Grull, Frida ThurmDaten und Visualisierung: Luc Martinon, Dylan CarterRedaktion: Justus von DanielsFaktencheck: Marius Münstermann, Rose Mintzer-Sweeney
Design: Mohamed Anwar
Collage: Ivo Mayr