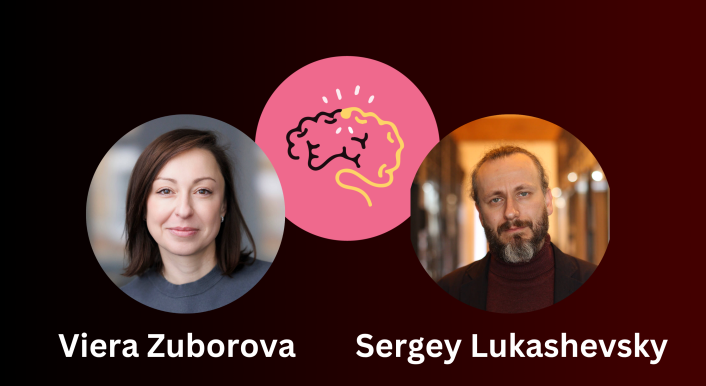Auf den zweiten Blick: Slowakei – ein autokratisches Coming-out?
Die slowakische Regierung unter Premier Robert Fico untergräbt die Pressefreiheit, schränkt regierungskritische Kulturschaffende ein und bedient sich auch sonst diverser Techniken autokratischer Herrschaft. Wir geben Einblicke in ein gespaltenes Land und fragen uns, warum in Europa kaum einer hinschaut.

In dieser Artikel-Serie werfen wir einen zweiten Blick auf aktuelle Ereignisse in Ländern, die in der deutschen Berichterstattung oft nur ein Schlaglicht bleiben. Gemeinsam mit lokalen Expertinnen und Experten fragen wir: Welche politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen stecken hinter den aktuellen Ereignissen, die wir in den Nachrichten sehen? Was bedeutet das für Demokratie und Medienfreiheit? Mit unserer Exil-Expertise wollen wir globale Zusammenhänge aufzeigen und verstehen, was wir daraus für ein freies, demokratisches Zusammenleben lernen können.
Für diese Folge haben wir mit Peter Hanak (Journalist, Aktuality.sk), Ivana Laučíková (Animationsfilmerin, Academy of Performing Arts) und Michal Vašečka (Soziologe, Bratislava Policy Institute) gesprochen.
Ich bin Viera Zuborova, die Direktorin von CORRECTIV.Exile. Am 17. November 2021 – einem Tag, der für Freiheit und den Sturz der damaligen Diktatur steht – verließ ich das Land, das ich mein ganzes Leben lang Heimat genannt hatte. Es war keine Flucht, sondern ein stilles, enttäuschtes Gehen. Ich ging nicht, weil die Slowakei mir nicht mehr wichtig war – ich ging, weil sie es noch immer ist.
Als ich ging, bedrohte niemand meine Arbeit oder meine Finanzierung als Politikwissenschaftlerin. Doch genau das betrifft heute viele zivilgesellschaftliche Akteure, Forscherinnen und Forscher sowie NGOs. Sie werden entmachtet, zum Schweigen gebracht oder verdrängt – nicht, weil sie versagt hätten, sondern weil sie nicht in das enge Regierungsbild nationaler Identität passen. Vier Jahre mögen zu kurz erscheinen, um zu behaupten, dass sich die Slowakei in einen illiberalen oder gar autoritären Staat verwandelt hat. Doch das Tempo und die Drastik des Wandels – im öffentlichen Diskurs, in kulturellen Institutionen und im politischen Leben – sind beunruhigend. Zwar war der autoritäre Umbau bereits zuvor schleichend erkennbar, etwa durch staatlich gelenkte Kampagnen in öffentlich-rechtlichen Medien, doch heute sind die Folgen massiver.
Für andere Demokratien in Europa – auch für Deutschland – ist das ein ernstzunehmendes Warnsignal. Autokratische Narrative schleichen sich nicht plötzlich, sondern Stück für Stück in den politischen und gesellschaftlichen Diskurs ein. In meinen vier Jahren in Deutschland habe ich solche Tendenzen auch hier erlebt. Und doch sehe ich in der deutschen Gesellschaft und ihren Institutionen eine Stärke: die Fähigkeit, polarisierende und sensible Themen offen zu diskutieren. Diese Offenheit gibt Anlass zur Hoffnung – und unterscheidet sich deutlich von der Situation in der Slowakei, wo eine ernsthafte Auseinandersetzung mit der autoritären Vergangenheit nie stattgefunden hat, wo Gewalttaten verdrängt und Diskussionen oft durch Selbstzensur erstickt werden. Diesen stillen Umbau haben ich und meine Kollegin Minou Becker uns gemeinsam mit drei Experten und Betroffenen genauer angeschaut –, um den weißen Fleck, der die Slowakei für viele auf der europäischen Landkarte ist, etwas auszumalen und zu zeigen, was dortige Geschehnisse auch für Deutschland und Europa bedeuten.
Was bisher geschah
Robert Fico, der slowakische Premierminister, hat viele Gesichter. In intellektuellen und journalistischen Kreisen wird er oft spöttisch als „getaufter Kommunist“ bezeichnet, was seine politische Laufbahn treffend beschreibt. Anfangs war er Sozialdemokrat, bildete jedoch seine erste Regierung (2006-2010) überraschend mit slowakischen Nationalisten und Mečiars HZDS, die in den 90ern für autoritäre Politik standen. In seiner zweiten Amtszeit (2012-2018) regierte er erneut mit Nationalisten, diesmal sogar mit der ungarischen Minderheitenpartei – eine ungewöhnliche, aber geschäftsorientierte Konstellation.
In diesen beiden Phasen baute Fico sich ein Netzwerk aus wirtschaftlichen Interessengruppen, mafiösen Kreisen und korrupten Personen auf, was nach dem Mord am investigativen Journalisten Ján Kuciak 2018 öffentlich wurde und zum Sturz der damaligen Regierung führte. Doch seit 2023 ist Fico erneut Regierungschef. Aktuell verfolgt er in seiner dritten Amtszeit das gleiche Ziel: ein autoritäres Regime, diesmal aber durch einen grundlegenden Umbau des politischen Systems von innen heraus. Ein Wendepunkt kam am 15. Mai 2024, mit einem in der Slowakei beispiellosen Ereignis: dem versuchten Attentat auf Ministerpräsidenten Robert Fico. Obwohl er überlebte, veränderte dieser Moment den Kurs des Landes grundlegend. Die Kommunikation seiner Regierung ist offen feindselig geworden – nicht nur gegenüber inländischen Kritikern, sondern auch gegenüber den traditionellen Verbündeten der Slowakei. Er hat die Mitgliedschaft der Slowakei in der NATO und der EU infrage gestellt und verwendet eine Rhetorik, die mit der des Kremls übereinstimmt. Was einst undenkbar schien, ist heute Regierungssprache.
Das reiche Buffet journalistischer Wahrheiten
Bereits kurz nach dem Attentat machte Fico die Medien für die Tat verantwortlich, sieht sie als wichtigsten Gegner seiner politischen Führung und Verbreiter von Hass und Hetze in der Gesellschaft. Mit Worten wie “Blutdürstige Bastarde” oder “Anti-Slawische Prostituierte” feuert er immer wieder öffentlich gegen Journalistinnen. Mit Konsequenzen. Peter Hanak ist Journalist bei der größten slowakischen Nachrichtenplattform Aktuality.sk. Er sieht, dass die Stimmung seit dem Anschlag zunehmend feindlicher geworden ist: ”Sie machen uns zur Zielscheibe. Wir sehen das mittlerweile täglich und es wird immer schlimmer.” Hassnachrichten, Einschüchterungsversuche und tätliche Angriffe auf offener Straße sind seit dem letzten Jahr Teil der journalistischen Realität geworden.
Nicht nur rhetorisch, sondern auch mit rechtlichen Mitteln greift Fico das slowakische Mediensystem an. Zuletzt im Juni 2024 durch die Umstellung des öffentlich-rechtlichen Medienangebots hin zu einem Staatsrundfunk – ein Schritt, der von Expertinnen als Zensur der Meinungsfreiheit bewertet wird und innerhalb des Landes großes Aufsehen und Proteste auslöste. Dazu kommt, dass der TV-Markt im Besitz von Oligarchenfamilien ist, die enge Geschäftsbeziehungen zum slowakischen Staat pflegen, wodurch es immer wieder zu staatsnaher Propaganda und Kampagnen kommt. Das führt immer wieder zu gezielter Verbreitung von Desinformationen, wie Hanak berichtet. Freie Medienhäuser bestehen weiterhin, sind jedoch auf die Finanzierung internationaler Sponsoren oder Spenden der Bevölkerung angewiesen.
Doch auch die Qualität der unabhängigen Medien sinkt, ihre Berichterstattung wird laut Hanak immer verkürzter, teilweise faktisch falsch. Er vergleicht die Informationslage mit einem großen Buffet – reich gedeckt mit allen Narrativen, die man sich vorstellen kann. “Alle nehmen sich davon, was gerade für sie am besten klingt”. Dabei scheinen die begehrtesten Mahlzeiten russische Desinformationskampagnen zu sein und immer krudere Verschwörungstheorien tauchen auf. So erklärte etwa der slowakische Politiker Lukas Machala in einer Live-Sendung, dass es nicht verkehrt wäre zu behaupten, die Erde sei eine Scheibe. Es gäbe nicht ausreichend Beweise für das Gegenteil, jede Meinung sollte eine Daseinsberechtigung haben, gerade in den Medien. Während dieser Kampf der Narrative herrscht, wird die wirkliche Medienfreiheit weiter beschnitten, doch die Slowaken kümmert diese Beeinflussung nach Hanak nicht mehr, “keiner sorgt sich mehr um Medienfreiheit”. Das Überangebot fülle bereits alles aus – zwischen Netflix, YouTube und dem TV-Markt sinke der Wunsch nach unabhängigen Journalismus immer weiter. Absurderweise ist jedoch das Vertrauen in die Medienfreiheit in der Slowakei das größte in der ganzen Region, wie eine Studie des Think-Tanks GLOBSEC von 2024 zeigt. Vertrauen, dass sich darin äußert, dass 40 Prozent der Slowaken ihre Identität durch liberale Demokratien bedroht und 70 Prozent Migranten als Gefahr sehen.
Journalisten führt dieses Ringen zwischen oligarchischen, staatlichen und den wenigen freien Medien, zwischen Desinformationen und gesellschaftlicher Spaltung in eine Notlage. Viele hören mit dem Job auf, wenden sich anderen Feldern zu. Andere arbeiten aus finanziellen Sorgen für die oligarchischen Medien. Hanak selbst befürchtet, dass auch sein Medium irgendwann aufgekauft werden könnte: “Wir müssten wieder von vorne anfangen, unsere eigenen Werte und Projekte verteidigen, immer und immer wieder von null.”

Die Ministerin der Unkulturen
Anders als Hanak ist Ivana Laučíková nicht zynisch, sie ist wütend. Für die Animationsfilmerin und Dozentin, die seit langem in der slowakischen Kunst- und Kulturszene aktiv ist, war es kein schleichender Prozess, sondern ein Knall. Fico wird 2023 zum Ministerpräsidenten gewählt, kurz darauf ist “die slowakische Landkarte der Kultur eine komplett andere”, wie sie sagt. Der rasante Wandel, oder besser gesagt Umbau, wird von der Kulturministerin Martina Šimkovičová orchestriert. Innerhalb von knapp zwei Jahren ist es der Rechtspopulistin gelungen, praktisch alle Schlüsselpositionen in der staatlich geförderten Kulturszene mit ihren Gefolgsleuten zu besetzen. Ob diese Kenntnisse oder Bezug zu Kunst und Kultur haben, ist dabei offensichtlich zweitrangig. Wichtiger sind Beziehungen und Loyalität, so wurde etwa die Nachbarin der Kulturministerin kurzum zur Leiterin des neuen Staatsfernsehens ernannt. In kürzester Zeit ist die kulturelle Freiheit des Landes damit in politische Hand gefallen, wie Ivana Laučíková sagt: “Sie nehmen den Fachleuten und der Kulturgemeinschaft in der Slowakei die Entscheidungsgewalt und legen die gesamte Kontrolle in politische Hände.“ Vom Nationaltheater über das Naturkundemuseum bis hin zu kleineren Institutionen – Šimkovičová, auch “Ministerin der Unkulturen” genannt, entlässt die kritischen Stimmen und geht gezielt gegen eine vielfältige, offene Slowakei vor. So werden etwa regimekritische Ausstellungen eingestellt oder Theaterstücke mit queeren Thematiken aus dem Programm genommen. Der Schwerpunkt der Kulturförderung der neuen Ministerin liegt offenbar woanders, so wurde etwa kürzlich eine Truckshow mit 175.000 Euro aus Steuergeldern gefördert.
Am schlimmsten trifft es nach Laučíková die slowakische Nationalgalerie. “Fast 100 Personen haben die Institution verlassen, und das waren die kreativen Köpfe – die Kuratorinnen, Historiker und Pädagoginnen, diejenigen, die sich um Kunstvermittlung gekümmert haben.“ Es wird immer drastischer und betrifft mehr und mehr Institutionen, sagt Laučíková. Wie weit es noch gehen wird, weiß keiner, denn Martina Šimkovičová ist für Laučíková “wie eine tickende Zeitbombe. Keiner weiß, wann sie wie reagieren wird.”
Das gleiche gilt für die finanzielle Ebene der Kulturbranche. Fördertöpfe wurden eingestellt und finanzielle Mittel gestrichen. Und dennoch, Kulturschaffende wissen sich zu helfen, sagt Ivana Laučíková – es ist die Zeit für kreative Förderantrage gekommen. So verschleiern viele immer wieder, worum es wirklich in ihren Projekten geht und versuchen im Sinne der recht-konservativen Kulturführung Projekte zu schreiben. So wurde etwa das größte feministische Festival Artwife unterstützt, warum, das kann sich Laučíková bis heute nicht erklären. Doch das sind die Ausnahmen, alles weitere hängt an mühsamen Crowdfunding-Kampagnen oder großzügigen Privatunternehmern. Ivana Laučíková belastet diese Anbiederung an das staatliche System: “Es ist eine Art Selbstzensur, die in Zeiten wie diesen leider unvermeidlich ist.” Eine Selbstzensur, die für viele in der Branche trotz Scham die einzige finanzielle Sicherheit bedeutet.
Trotzdem wehren sich die Kulturschaffenden. Unnachgiebig, wie man am Beispiel von Ivana Laučíková sieht. Gemeinsam mit Kreativen aus Theater, Film, Literatur und vielen weiteren Sparten hat sie die Plattform Otvorená Kultúra (Offene Kultur) gegründet. Hier sammeln sie mit Hilfe von Anwälten Vorwürfe und klären über die Vorgänge und Rechte von Kulturschaffenden auf. So konnte die Plattform etwa eine Petition für die Entlassung von Kulturministerin Martina Šimkovičová anstoßen. Diese wurde mit 190.000 Unterschriften die bis dahin stärkste Petition der Slowakei, führte jedoch nicht zur Entlassung. Doch Ivana Laučíková bleibt laut, gerade auf den slowakischen Straßen. Seit vielen Monaten organisiert ihre Gruppe Proteste gegen die Zensur in der Kultur, den Medien und der Justiz. Gemeinsam mit Verbänden, Studierenden und weiteren Gruppen bringen sie tausende Menschen auf die Straßen und schreien über Monate dem Kulturministerium entgegen.
Von staatlicher Seite kommt wenig Reaktion und wenn, dann ist sie abfällig, im Sinne der Fico-Rhetorik. Am Ende wird für Ivana Laučíková gerade auch ein Kampf um die slowakische Identität geführt, ein Kampf, der die tiefe Spaltung des Landes verdeutlicht. Die Fico-Regierung spricht dabei immer wieder von der wahren slowakischen Herkunft, Martina Šimkovičová etwa von der “natürlichen slowakischen Essenz” und Lebensart. Für viele Slowaken repräsentieren sie damit einen Nationalstolz. “Diese Menschen sind sehr konservativ, auf der Suche nach starker Führung – sie sprechen meist von ‚wir‘ und ‚sie‘ und spalten die Nation über die Sprache.” Laučíková vertritt die andere Seite. Sie will gegen russische Einflussnahme aufstehen und ein normales europäisches Leben im 21. Jahrhundert führen, wie sie sagt. Die propagierten traditionellen Werte sind für sie ein Irrglaube: “Es ist doch eine Mischung aus kulturellen Einflüssen und internationalen Inspirationen – so etwas wie eine reine slowakische Kultur hat nie existiert.” Laučíková will bei diesem Kräftemessen das Wir wieder auf den gespaltenen Tisch bringen, auch wenn sie nicht weiß, ob sich die Slowakei in nächster Zeit auf irgendeine Art einen lässt. Doch für sie ist es die Aufgabe ihrer Generation, eine Aufgabe, die an ein Versprechen zu ihrer Heimat gebunden ist: “Ich muss hierbleiben, denn das ist mein Land, das sind meine Berge, meine Seen, meine Städte, meine Leute.”

Der stille Umbau zur Autokratie
Welche Taktik fährt Fico mit seiner autoritären Linie? Diese Frage stellt sich der Soziologe Michal Vašečka tagtäglich. Seine Antwort: Ein stilles Überleben.
Die Beobachtungen des Journalisten Hanak und der Künstlerin Laučíková sieht er aus wissenschaftlicher Perspektive bestätigt. Gerade seit dem versuchten Attentat analysiert Vašečka, wie Fico in Rhetorik und Politik aggressiver und paranoider wird. Pressekonferenzen gibt er kaum und Interviews verweigert er. Fico schottet sich weitgehend ab, verschwindet zunehmend von der Bildfläche und sammelt einen engen Kreis politischer Vertrauter um sich. “Er tut im Grunde das, was wir bei vielen autoritären Führern sehen, die schon lange an der Macht sind. Sie koppeln sich zunehmend von der Realität ab.” Laut Vašečka spielt Fico ein doppeltes Spiel: Im Inland gibt er sich hart und verfolgt strikte innenpolitische Ziele, während er sich bei außenpolitischen Auftritten mit einem zurückhaltenden Lächeln tarnt, um nicht aufzufallen. Gerade dieses Spannungsverhältnis sieht Vašečka als Beweis dafür, wie Fico im Stillen seine Machtposition ausbaut und festigt. Dabei sind seine politischen Positionen so voller nationalistischer, anti-LGBT und migrantenfeindlicher Sentiments, dass er im deutschen Kontext rechts der AfD stehen würde. Doch der internationale Aufschrei ob des stetigen autoritären Umbaus bleibt aus, schließlich ist die Slowakei für viele ein weißer Fleck auf der Landkarte. Genau darin liegt jedoch eine Gefahr, da Fico es ausnutzt, übersehen zu werden.
Wird über in deutschen Medien über die Slowakei berichtet, fällt das Land oft in einem Atemzug mit Ungarn. Ein Vergleich, der laut dem Soziologen Vašečka nur teilweise gerechtfertigt ist. Zwar übernimmt die slowakische Regierung in Teilen die autoritäre Rhetorik Viktor Orbáns – dennoch lassen sich die beiden Länder nicht einfach über einen Kamm scheren. Denn die politischen Intentionen unterscheiden sich grundlegend, so Vašečka: „Ungarn ist ein kleines Land, das glaubt, viel größer zu sein, als es ist. Während die Slowakei ein kleines Land ist – das tatsächlich glaubt, noch kleiner zu sein, als es ist.“ Orbán präsentiert sich selbstbewusst auf der internationalen Bühne und inszeniert sich als autoritärer Anführer, der Einfluss auf die europäische Politik nehmen will – und das mit Erfolg, wie etwa ein Blick auf seine strategischen Allianzen zeigt.
Fico hingegen strebe laut Vašečka nicht nach internationalem Einfluss. Sein Ziel sei die umfassende Kontrolle über die Slowakei. Dabei wolle er außenpolitisch möglichst unauffällig bleiben, niemanden provozieren und sich keiner Seite zuordnen. Während Orbán offen mit rechten europäischen Kräften wie der italienischen Lega oder der AfD sympathisiert, fehle Fico jegliche außenpolitische Ambition. Ihm gehe es, so Vašečka, lediglich darum, bestimmte Interessen slowakischer Oligarchen zu vertreten, seine Macht im Inland auszubauen – und darüber hinaus nicht weiter aufzufallen.
Mit Blick auf die Zukunft zeichnet Vašečka ein düsteres Bild seiner Heimat. “Fico wird die Gesellschaft weiterhin mit Verschwörungstheorien vergiften. Und viele Teile der Gesellschaft werden einfach aufgeben – die freie Slowakei geht gerade unter.” Schwer, ihm zu widersprechen. Die Wirtschaft steckt in der Krise, die Proteste verlieren an Kraft, während der autoritäre Umbau weiter voranschreitet – nahezu unbeachtet von der internationalen Öffentlichkeit. Vašečka sieht keine aufkeimenden Kräfte des Widerstands. Er stimmt der Dokumentarfilmerin Laučíková zu, die ihr Land als gespalten beschreibt – zwischen proeuropäischen Kräften und Anhängern Ficos, die sich einen autoritären, traditionellen Führer für die Slowakei wünschen.
Seit dem versuchten Attentat auf Robert Fico ist kaum ein Jahr vergangen – ein Jahr, das für den Journalisten Peter Hanák und die Künstlerin Ivana Laučíková von Zensur und Repression geprägt war. Die autoritären Tendenzen Ficos sind nicht neu, doch die Geschwindigkeit, mit der sie nun umgesetzt werden, ist beispiellos. Die Slowakei zeigt exemplarisch, wie ein einst demokratisches Land – nahezu unbeachtet von europäischer Öffentlichkeit – Schritt für Schritt, Gesetz für Gesetz, Wort für Wort in eine Autokratie umgebaut wird. Fico nutzt die politische Bühne, um Kontrolle auszuweiten und kritische Stimmen zu marginalisieren. Zwar finden weiterhin Proteste statt, doch die kommenden Monate werden entscheidend sein: Kann die Slowakei ihre demokratische Integrität wahren – oder rutscht sie weiter in die autoritäre Herrschaft ab?

Auf den zweiten Blick: Lehren aus der Slowakei
Erstens: Der langsame Umbau der Slowakei zeigt, wie autoritäre Systeme sich nicht über Nacht etablieren – sondern über Jahre hinweg vorbereitet, mit einem Knall umgesetzt und dann Stück für Stück normalisiert werden. Wer verstehen will, wie Demokratien erodieren, muss auf die Zwischentöne achten: auf Sprache, auf Narrative, auf die gezielte Dämonisierung von Medien, Minderheiten und zivilgesellschaftlichen Akteuren. Spaltung beginnt nicht mit Gesetzen, sondern mit Worten.
Zweitens: Die Slowakei darf kein weißer Fleck auf der europäischen Landkarte bleiben. Was dort passiert, ist keine nationale Ausnahme, sondern ein lehrbuchhaftes Beispiel für die autoritäre Strategie im 21. Jahrhundert – auch innerhalb der EU. Es zeigt, wie still ein Staat kippen kann, wenn internationale Aufmerksamkeit fehlt und demokratische Institutionen nicht rechtzeitig verteidigt werden.
Drittens: Gerade deshalb müssen unabhängige Kultur- und Bildungseinrichtungen gestärkt werden – als Räume, in denen kritisches Denken, Vielfalt und demokratische Werte lebendig bleiben. Sie sind nicht bloß Kulisse, sondern Bollwerk gegen autoritäre Umdeutungen nationaler Identität.
Und schließlich: Auch wenn die Lage düster scheint – Gewalt ist keine Antwort. Autoritäre Regime leben von der Eskalation. Es braucht beharrlichen Dialog, friedlichen Protest, kreative Formen des Widerstands und vor allem eine klare Haltung: für Freiheit und für Offenheit.
Wie kann ich auf dem Laufenden bleiben?
- The Slovak Spectator ist eine englischsprachige Zeitung in der Slowakei.
- VIA IURIS ist eine der ältesten zivilgesellschaftlichen Organisationen der Slowakei. 1993 unter dem Namen Center for Environmental Public Advocacy gegründet, war ihr ursprüngliches Ziel, eine breite Palette von Bürgerinitiativen und ähnlichen Organisationen, die für Fairness kämpften, zu unterstützen.
- Open Culture! ist eine überparteiliche Bürgerinitiative einer Kulturgemeinschaft aus der gesamten Slowakei.
- Globsec, ein Think Tank mit großer Expertise zu politischen Entwicklungen in der Slowakei.
- Visegrad Insight – Plattform für politische Debatten und Analysen mit Mitteleuropa-Fokus.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Redigatur: Nora Pohl
Grafiken: Otvorena Kultura
Kommunikation und Social Media: Katharina Roche