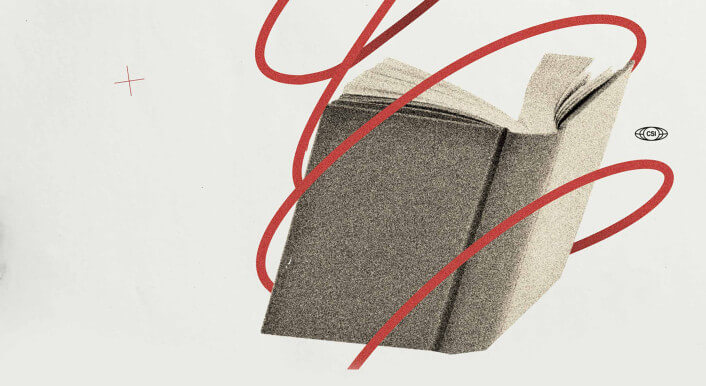Trotz Kritik: Forschungsministerium fördert umstrittenes Projekt gegen Antisemitismus
Das Forschungsministerium fördert seit Juli 2025 ein Projekt gegen Antisemitismus an Schulen. Das Projekt wird von dem Islamismus-Experten Ahmad Mansour geleitet. Doch von CORRECTIV gesichtete Unterlagen lassen vermuten, dass wissenschaftliche Standards verletzt werden.

Update vom 13. November 2025: Seit Veröffentlichung des Artikels wurde in mehreren Publikationen Bezug auf die Recherche genommen. In der Debatte gab es auch Kritik: Die Perspektive der Projektbeteiligten sei nicht ausreichend beachtet worden. CORRECTIV hatte frühzeitig die Universitäten und Ahmad Mansour angefragt. Persönliche Gespräche oder eine gesonderte Stellungnahme der beteiligten Universitäten wurden von ihnen aus verschiedenen Gründen abgelehnt. CORRECTIV hat das Ministerium und die Projektbeteiligten schließlich auch vor Veröffentlichung konfrontiert und ihre Antworten abgebildet.
Zur Klarstellung: Bei Forschungsförderungen sollten verschiedene wissenschaftliche Qualitätskriterien eingehalten werden. Das Forschungsministerium trägt die Verantwortung, die wissenschaftliche Qualität eines Projekts zu gewährleisten. In diesem Fall sind die Verantwortlichen des Ministeriums dieser Aufgabe nicht vollumfänglich nachgekommen, da das Projekt nicht abschließend begutachtet wurde. Dadurch gibt es kein Prüfsiegel, das die Wissenschaftlichkeit des Projekts bestätigt.
Es geht um Beleidigungen und tätliche Übergriffe, um Schmierereien und Hassbotschaften: Die Zahl der antisemitischen Vorfälle in Deutschland hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Einen großen Anstieg registrierten Behörden und Nichtregierungsorganisationen infolge des Angriffs der Terrororganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 und den daraufhin von Israel ausgerufenen Kriegszustand: 2024 zählte die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (RIAS) rund 8.600 gemeldete antisemitische Vorfälle. Das sind mehr als dreimal so viele wie 2022. Auch in deutschen Klassenzimmern hat sich die Lage zugespitzt. So erfasste RIAS 2024 284 antisemitische Vorfälle an Schulen. Darunter 17 Angriffe, die sich gegen jüdische oder israelische Schülerinnen und Schüler richteten.
Das Forschungsministerium wollte dieser Entwicklung etwas entgegensetzen – und genehmigte ein Antisemitismus-Projekt der gemeinnützigen Gesellschaft Mind. In behördeninternen Unterlagen priesen die Verantwortlichen das Projekt mit dem Namen Dis-Ident als „neuartiges hybrides Vorhaben, bei dem Praxis und Forschung mit einem starken Fokus auf Prävention zusammenkommen“. Die Fördersumme: knapp neun Millionen Euro.
Ziel des Projekts ist es laut Beschreibung des Unternehmens Mind, Strategien gegen israelbezogenen Antisemitismus und islamistische Radikalisierung an deutschen Schulen zu entwickeln. Das Projekt richtet sich vor allem an muslimische Schülerinnen und Schüler mit Migrationsbiografien. Sie sollen lernen, antisemitische Vorurteile zu reflektieren, zum Beispiel in Theater-Workshops und Rollenspielen. Die wissenschaftlichen Partner der Ludwig-Maximilians-Universität in München, der Universität Köln, der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und der Universität Heidelberg sollen das Vorhaben mit der entsprechenden Forschung unterfüttern.
Gründer und Geschäftsführer von Mind ist ein Mann, der durch diverse Talkshow-Auftritte und Interviews auch einer breiten Öffentlichkeit bekannt ist: Ahmad Mansour. Der studierte Psychologe gilt als einer der bekanntesten deutschen Islamismus-Experten. Mansour veröffentlichte mehrere Bücher, engagiert sich seit Jahren in der Präventionsarbeit und wurde mehrfach für seine Arbeit ausgezeichnet. Wegen islamkritischer Äußerungen ist Mansour aber auch umstritten. So sagte er beispielsweise im Juli 2021 in einem Podcast der FAZ: „Der Islam hat sich noch nie in eine andere Kultur integriert und wird es auch nicht in Europa tun.“ Auf der Plattform X schrieb Mansour, Gebetsräume in Schulen seien ein „gefährlicher Kompromiss“. Unter streng gläubigen Muslimen, aber auch unter Linken gilt Mansour angesichts solcher Bemerkungen als Reizfigur.
Ist Mansours mit öffentlichen Mitteln gefördertes Präventions- und Forschungsprojekt ein wirksames Instrument gegen Antisemitismus, das vor allem junge Muslime erreichen kann? Von CORRECTIV gesichtete interne Unterlagen des Forschungsministeriums nähren Zweifel. Denn ergebnisoffen liest sich die Beschreibung nicht, wie man es bei einem Forschungsprojekt erwarten würde. Vielmehr spiegelt es das Weltbild, für das Mansour in der Vergangenheit bereits kritisiert wurde. Und auch vom Ministerium beauftragte Fachleute äußerten die Sorge, dass die geplanten Maßnahmen Kinder und Jugendliche mit Migrationsbiografie und muslimischem Glauben diskriminieren könnten. Außerdem würden wissenschaftliche Standards verletzt. Von CORRECTIV befragte Experten bestätigen die Einwände.
FDP trieb Projekt voran
Bemerkenswert ist schon, wie das Projekt entstanden ist. Denn, dass das Unternehmen Mind Mittel des Forschungsministeriums erhalten soll, wurde in einer Sitzung des Haushaltsausschusses im November 2023 entschieden. Genauer: in der Bereinigungssitzung, in der die Abgeordneten bis spät in die Nacht die letzten Gelder für das kommende Jahr verteilen.
In dieser Sitzung entschieden die Abgeordneten, dem Forschungsministerium bis 2028 Mittel „zur Weiterentwicklung, Verstetigung und Professionalisierung“ des Unternehmens Mind bereitzustellen. Das Ministerium wurde damals noch von Bettina Stark-Watzinger (FDP) geleitet. Offenbar trieben vor allem FDP-Abgeordnete das Projekt voran. Aus internen Dokumenten des Ministeriums geht hervor, dass sich Christoph Meyer, damals stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Liberalen, einige Monate nach dem Beschluss des Haushaltsausschusses vom Ministerium versichern ließ, dass das Projekt planmäßig genehmigt würde.
Anders als oft bei öffentlichen Projektförderungen mussten sich Mansour und seine Partner also nicht in einem kompetitiven Verfahren um die Gelder bewerben. In solch einem Verfahren schreibt das Ministerium ein Forschungsprogramm aus, die Forschungseinrichtungen bewerben sich mit verschiedenen Konzepten. Diese werden von Fachleuten geprüft. Das Ministerium fördert schließlich die besten Ideen. Im Fall von Mansours Projekt entschieden die Abgeordneten, das Forschungsministerium solle das Unternehmen Mind ohne ein solches Verfahren bezuschussen. Eine Entscheidung, die Fragen aufwirft.
Denn Mansour ist kein Wissenschaftler, sondern Islamismus-Experte und Fachmann für Präventionsangebote – und so gestaltete das von ihm geführte Unternehmen Mind offenbar auch den im Mai 2024 eingereichten Förderantrag.
Verheerende Kritik von Gutachtern
Wie in solchen Fällen üblich, beauftragte das Forschungsministerium externe Wissenschaftler, die die Projektbeschreibung prüfen sollten. Die Namen der Fachleute machte das Ministerium „zum Schutz der Persönlichkeitsrechte“ auf Anfrage der Redaktion nicht öffentlich, doch die im Sommer 2024 vorgelegten Gutachten liegen CORRECTIV vor. Sie fielen verheerend aus.
Über die Plattform Frag den Staat hat CORRECTIV Anfragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) gestellt und so die Projektanträge, die interne Kommunikation des Forschungsministeriums zum Projekt und die vorliegenden Gutachten erhalten. Alle Unterlagen sind nun hier öffentlich zugänglich:
Die Experten bemängelten die fehlende „Darstellung von empirisch überprüfbaren Hypothesen und Forschungsfragen“. Ebenfalls vermissten sie eine detaillierte Darstellung des Forschungsdesigns und der Methoden, und wie diese angewendet werden sollen. Der Antrag sei stellenweise unsystematisch und sprachlich uneindeutig, bleibe deutlich hinter den Erwartungen zurück und werfe die Frage auf, ob sich die Antragstellenden der Herausforderungen der personellen und finanziellen Ressourcen einzelner geplanter Projekte überhaupt bewusst seien.
Der Antrag zeige zudem einen „defizitorientierte[n] Blick auf Menschen mit Migrationsbiographien und muslimischer Religiosität“. Die formulierten Thesen würden auf der Vorannahme basieren, dass in einem „muslimischen Kulturkreis“ antisemitische Einstellungen „per se gegeben“ seien. Laut Gutachten werde eine solche „Verkürzung“ den „Forschungen nicht gerecht“. Dass Mansour und seine Partner explizit muslimische Jugendliche ansprechen wollen, weil sie dort antisemitische Einstellungen verorteten, sei laut der beauftragten Fachleute „ungeeignet“ als Ausgangspunkt „einer Studie und darauf basierenden Praxisformaten“.
Das übereinstimmende Fazit der vom Ministerium beauftragten Experten: Das Projekt sei „aus verschiedenen Gründen nicht förderungswürdig“.
Zusage ohne erneute Prüfung
Das zuständige Fachreferat des Forschungsministeriums reagierte und bat Mansour und seine Partner, den Projektantrag zu überarbeiten. Am 29. Oktober 2024 reichte das Unternehmen Mind schließlich einen zweiten Entwurf ein.
Der überarbeitete Projektantrag umfasst 77 Seiten. Doch für die Prüfung brauchte das Ministerium nicht lange. Bereits einen Tag später schrieben die Verantwortlichen im zuständigen Fachreferat des Ministeriums in einer internen Einschätzung von „substantiellen Überarbeitungen“. Die Frage von CORRECTIV, welche Überarbeitungen konkret festgestellt wurden, ließ das Ministerium inhaltlich unbeantwortet.
Der damalige zuständige Staatssekretär Jens Brandenburg (FDP) zeigte sich nach der Einschätzung des Fachreferats schnell überzeugt – und stimmte Anfang November 2024 der Vorbereitung einer sogenannten „unverbindlichen Inaussichtstellung“ zu. Also eine Art vorläufige und rechtlich unverbindliche Zusage, die den Antragstellenden Vorbereitungen für das Projekt ermöglicht, beispielsweise Stellenausschreibungen. Bedingung war, dass sich die Gutachtenden zu einem späteren Zeitpunkt nochmals mit dem neuen Antrag befassen sollten.
Der mutmaßliche Grund für die Eile: Staatssekretär Brandenburg und seine Mitarbeiter wollten wohl verhindern, dass die Mittel, die vom Haushaltsausschuss für das Jahr 2024 bewilligt wurden, verfallen. Eine für das Projekt zuständige Mitarbeiterin des Ministeriums warnte in einer behördeninternen Mail, dass nicht abgerufene Mittel „nicht in folgende Haushaltsjahre verschoben werden“ könnten.
Gutachter glaubten nicht mehr an redliche Zusammenarbeit
In der Zwischenzeit zerbrach die Ampelkoalition und die FDP-Ministerinnen und- Minister legten ihre Ämter nieder. So auch Stark-Watzinger (FDP). Der Grünen-Politiker Cem Özdemir übernahm das Forschungsministerium. Dieser ließ kurz vor Jahresende, im Dezember 2024, die vorläufige Zusage für die Genehmigung des Projekts ausstellen, also die sogenannte „Inaussichtstellung“.
Die Gutachtenden kontaktierte das Ministerium drei Tage nach dieser Entscheidung. Die Fachleute sollten prüfen, ob der überarbeitete Projektantrag nun förderungswürdig sei.
Doch zu dieser zweiten Prüfung kam es nie. Denn die Experten fühlten sich offenbar brüskiert. In einem Treffen mit dem Ministerium im Januar dieses Jahres erklärten sie, die Projektverantwortlichen hätten „Entscheidungen bereits vorgenommen“, wie interne Dokumente des Forschungsministeriums zeigen. Die Fachleute bezogen sich damit offenbar auf die vorläufigen Zusagen des Ministeriums. Eine „redliche und vertrauliche weitere Begutachtung“ sei somit „nicht mehr möglich“, formulierten die Gutachtenden. Es erscheine ihnen „fraglich“, wie ihre „inhaltlichen Anregungen“ zu diesem Zeitpunkt noch eingebunden werden könnten. Daher entschieden sie, „diese Rolle für sich“ abzulehnen.
Das Unternehmen Mind teilt auf Anfrage von CORRECTIV im Namen aller Projektbeteiligten mit: „Die Behauptung, die Gutachtenden hätten sich nach Ausstellung der Unverbindlichen In-Aussicht-Stellung (UIA), zurückgezogen, entzieht sich unserer Kenntnis.“ Zudem sei Ihnen mitgeteilt worden, dass die zuvor genannten Kritikpunkte aufgegriffen und im späteren Antragsentwurf eingearbeitet worden seien.
Aus den behördeninternen Unterlagen, die CORRECTIV vorliegen, geht hervor, dass die vorgebrachten Argumente der Gutachter für das zuständige Fachreferat „nachvollziehbar und schlüssig“ waren. Um die wissenschaftliche Qualität nach ihrem Abtreten gewährleisten zu können, wurde im Ministerium ein wissenschaftlicher Beirat angesiedelt, der das Projekt begleiten soll. Zudem wird es extern evaluiert.
Im Mai 2025 war es dann soweit: Das Ministerium bewilligte das Projekt nunmehr auch rechtsverbindlich und endgültig. Das Projekt Dis-Ident konnte starten – der Einwände der Fachleute zum Trotz.
Schaden für Wissenschaft und Politik
CORRECTIV hat den internen Prozess des Ministeriums und die Antragsunterlagen von unabhängigen Expertinnen und Experten einordnen lassen. Nicole Deitelhoff, Vorstandsmitglied des Leibniz-Instituts für Friedens- und Konfliktforschung, hält das Vorgehen im Fall von Mansours Forschungsprojekt für ungewöhnlich.
„Wenn bei einer Entscheidung über eine Forschungsförderung wissenschaftliche Gütekriterien hinten angestellt werden, wirft das ein schlechtes Licht auf Politik und Wissenschaft“, sagt Deitelhoff. Dass Mansours Projekt offenbar politisch gewollt war, sei legitim. Bei einer Forschungsförderung müsse die wissenschaftliche Qualität aber „ein ebenso wichtiges Kriterium sein wie die politische Prioritätensetzung“.
„Das scheint in diesem Fall nicht umgesetzt worden zu sein“, sagt sie. Schließlich sei die Förderentscheidung erfolgt, ohne dass die vom Ministerium beauftragten Fachleute das Projekt ein zweites Mal geprüft hätten. Und das, obwohl diese zuvor „grundlegende Überarbeitungsanforderungen“ festgestellt hätten.
Auf die Frage, warum sich das Ministerium trotz der Kritik der eigens beauftragten Fachleute dazu entschied, das Projekt zu fördern, schreibt eine Sprecherin, dass die Gutachtenden im Januar 2025 zwei zentrale Auflagen formuliert hätten, „die auf die kontinuierliche externe Qualitätssicherung des Vorhabens abzielen“. Dies betreffe die „begleitende externe Evaluation und den beim BMFTR angesiedelten wissenschaftlichen Beirat“. Beide Empfehlungen würden umgesetzt.
Forscher sieht nur oberflächliche Überarbeitung
CORRECTIV liegt die finale Vorhabensbeschreibung des Projekts von November 2024 vor – die letzte Formalie, bevor Mansours Vorhaben endgültig genehmigt wurde. Die Redaktion stellte hierzu mehreren Expertinnen und Experten die Unterlagen zur Verfügung und ließ prüfen, ob das Vorhaben nach der Bewertung der vom Ministerium beauftragten Fachleute ausreichend verbessert wurde.
Thomas Scheffer, Professor an der Universität Frankfurt mit dem Schwerpunkt interpretative Methoden, sagt, dass das Unternehmen Mind und die wissenschaftlichen Partner eher „kosmetisch“ auf die Kritik der Gutachten eingegangen seien. Eine „skeptisch-forschende Auseinandersetzung“ mit den aufgestellten Hypothesen finde nicht statt, das methodische Vorgehen bleibe weiterhin „nebulös“. Zudem lese sich der Antrag so, als „wären alle Fragen im Grunde schon beantwortet“. Forschung lebe aber von der Bereitschaft, sich irritieren zu lassen. „Das passiert in diesem Antrag an keiner Stelle“, sagt Scheffer.
Er wies zudem darauf hin, dass eine kritische Reflexion fehle, ob das Projekt womöglich selbst die „Diskriminierung muslimischer Jugendlicher“ vorantreibe. Es sei Standard, sich vor Beginn eines Projekts mit solchen wichtigen ethischen Fragen zu befassen. Schließlich könne die Forschung auch unbeabsichtigte, etwa stigmatisierende Folgen für die Studienteilnehmenden – in diesem Fall die Jugendlichen – haben: „Das ist vorher abzuklären, nicht nachher.“
Was konkret mit den Jugendlichen im Projekt geplant sei und wie ihre Rechte gewahrt würden, bleibe zudem unklar. Dazu gehöre etwa, wie die Jugendlichen und ihre Erziehungsberechtigten über mögliche Risiken und Folgen aufgeklärt werden, wie die Datenverarbeitung organisiert sei und wie sie die Teilnahme am Projekt ablehnen oder von Experimenten zurücktreten könnten.
Ethikprüfung steht noch aus
CORRECTIV fragte das Ministerium, wie es sicherstelle, dass die Rechte der Jugendlichen geschützt werden. Eine Sprecherin antwortete, dass die „Zuwendungsempfänger“ die „umfassende Verantwortung“ für die „Einhaltung wissenschaftlicher Standards“ tragen würden. Dies sei im Zuwendungsbescheid festgehalten.
CORRECTIV konfrontierte das Unternehmen Mind und alle beteiligten Universitäten mit der Kritik der Experten und Expertinnen. Die Universitäten äußerten sich nicht. Stattdessen antwortete die Mind im Namen aller Projektbeteiligten. Das Unternehmen teilte mit, dass das Projekt „allen ethischen und datenschutzrechtlichen Standards“ folge. Dazu gehöre zum Beispiel, dass für alle psychologischen Vorhaben noch ein Ethikvotum der Deutschen Gesellschaft für Psychologie (DGPS) eingeholt werde. Die DGPS bewertet als unabhängiges Gremium, ob ein Forschungsprojekt ethisch vertretbar ist.
Eine Bewertung, die normalerweise vor Projektbewilligung erfolgt. Auf die weiteren Kritikpunkte der von CORRECTIV befragten Expertinnen und Experten schrieb das Unternehmen Mind im Namen aller Projektverantwortlichen, dass die Vorhabensbeschreibung „den wissenschaftlichen Standards der beteiligten Universitäten“ entspreche.
Das Projekt Dis-Ident ist nach der Genehmigung durch das Ministerium unterdessen im Juli dieses Jahres offiziell angelaufen, die ersten empirischen Arbeiten und Datenerhebungen sollen Anfang 2026 starten. Das Unternehmen Mind wirbt auf seiner Webseite: Es wolle Demokratie und Vielfalt stärken – mit „praxisnahen, wissenschaftlich fundierten Angeboten“.
Redaktion: Justus von Daniels
Redigat: Miriam Lenz
Faktencheck: Miriam Lenz, Martin Böhmer, Leonie Georg