Koalitionsvertrag: Wie Union und SPD gegen Desinformation vorgehen wollen
Im Koalitionsvertrag stellen Union und SPD vor, wie sie die Gesellschaft vor der Verbreitung bewusster Falschinformationen schützen wollen. Sofort entbrennt eine Debatte über ein angebliches „Lügen-Verbot“. Wir schauen uns an, was da dran ist.
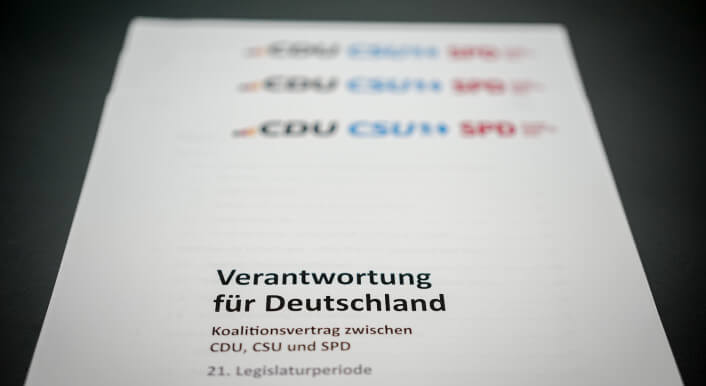
Fünfmal steht das Wort „Desinformation“ im Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD. Das ist im Vergleich zu anderen drängenden Herausforderungen unserer Zeit eher wenig; zum Vergleich: Das Wort „Klima“ kommt 80 Mal vor. Aber wie möchte die Koalition die Verbreitungen von gezielten Falschmeldungen angehen? Und was steckt hinter dem Vorwurf, sie wolle die Meinungsfreiheit beschneiden?
Den Maßnahmen gegen Desinformation widmet der Koalitionsvertrag ein eigenes kurzes Kapitel. Über eine Formulierung darin wurde in den vergangenen Wochen hitzig diskutiert:
„Die bewusste Verbreitung falscher Tatsachenbehauptungen ist durch die Meinungsfreiheit nicht gedeckt. Deshalb muss die staatsferne Medienaufsicht unter Wahrung der Meinungsfreiheit auf der Basis klarer gesetzlicher Vorgaben gegen Informationsmanipulation sowie Hass und Hetze vorgehen können.“
Das gefährde die Meinungsfreiheit, schrieb beispielsweise ein Gastautor bei Focus Online. So sah es, wenig überraschend, auch die AfD-Fraktion Sachsen. Bei der Berliner Zeitung hieß es, die Bundesregierung wolle „Lügen tatsächlich verbieten“. „Kommt jetzt das Lügen-Verbot?“, fragte die Bild. Auch das Faktencheck-Portal Mimikama interpretierte den Koalitionsvertrag so, dass die Bundesregierung „,bewusst falsche Tatsachenbehauptungen‘ vom Schutz der Meinungsfreiheit ausnehmen“ wolle. Doch das ist irreführend.
Bewusst falsche Tatsachenbehauptungen sind schon jetzt nicht von der Meinungsfreiheit geschützt
Das Grundgesetz verankert für jeden und jede das Recht, seine Meinung „in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten“. Falsche Tatsachenbehauptungen sind aber bereits jetzt nicht von Artikel 5 geschützt: Es handelt sich nicht um Meinungen. Das bestätigen uns auf Nachfrage mehrere Rechtswissenschaftler, darunter Hubertus Gersdorf, Professor für Staats- und Verwaltungsrecht und Medienrecht an der Universität Leipzig.
So urteilte das Bundesverfassungsgericht beispielsweise im Jahr 1982: „Was (…) nicht zur verfassungsmäßig vorausgesetzten Meinungsbildung beitragen kann, ist nicht geschützt, insbesondere die erwiesen oder bewußt unwahre Tatsachenbehauptung. Im Gegensatz zur eigentlichen Äußerung einer Meinung kann es also für den verfassungsrechtlichen Schutz einer Tatsachenmitteilung auf die Richtigkeit der Mitteilung ankommen.“ Diese Auffassung spiegelt sich in zahlreichen Gerichtsurteilen wider, auch in neueren Entscheidungen wie einem Urteil von 2018.
Dass etwas nicht explizit vom Grundgesetz geschützt ist, bedeutet aber nicht, dass es verboten oder gar strafbar ist. Wie Hubertus Gersdorf erklärt, braucht es dafür eine gesonderte Verbotsnorm beziehungsweise einen Straftatbestand. Davon gibt es einige, zum Beispiel Beleidigungen, Verleumdung oder üble Nachrede einer Person. Wenn sie keine persönlichen Rechte verletzen, sind Falschinformationen nur in sehr wenigen Fällen strafbar, zum Beispiel bei Volksverhetzung. In Deutschland ist die Leugnung des Holocausts und anderer Völkerrechtsverbrechen der Nazis strafbar.
Wie zwei Gastautoren im Rechtsblog Legal Tribune Online aufführen, ist die Trennung von Meinungsäußerung und Tatsachenbehauptung aber nicht immer so einfach. So könne „eine Äußerung, die sowohl Elemente der Meinung als auch der Tatsache enthält, im Schwerpunkt als Meinung zu qualifizieren sein, wäre dann aber im rechtlichen Sinne keine Lüge.“
Soll das Verbreiten von Desinformation in Deutschland grundsätzlich strafbar werden?
Kurz gesagt: Mit der aktuellen Rechtslage ist es nicht generell strafbar, Falschinformationen zu verbreiten. Sondern nur dann, wenn Persönlichkeitsrechte oder ein anderes Gesetz verletzt werden. Der Koalitionsvertrag wird an vielen Stellen so interpretiert, als wolle die neue Bundesregierung das ändern und jede Lüge strafbar machen. So sagte ein Rechtsanwalt in der Bild auf die Frage, wer sich künftig strafbar machen werde: „Das wird sich zeigen, wenn entsprechende Gesetzesentwürfe vorgelegt werden. Bisher existieren diese nicht.“
Für solche Pläne gibt es aber aktuell keine Anhaltspunkte. Auf Nachfrage heißt es aus der SPD-Bundestagsfraktion, der Absatz im Koalitionsvertrag werde fehlinterpretiert, „teils sicher auch sehr bewusst“. Man weise zurück, dass es sich um einen Angriff auf die Meinungsfreiheit handele. Schon jetzt seien unwahre Tatsachenbehauptungen keine Meinungen und nicht von der Meinungsfreiheit gedeckt.
Fast identisch äußert sich ein Sprecher der SPD: „Der Koalitionsvertrag wiederholt geltende Rechtslage: Gezielte Desinformation ist keine Meinung und genießt keinen Schutz durch die Meinungsfreiheit.“ Von der CDU/CSU erhielten wir keine Rückmeldung.
„Ein allgemeines Lügenverbot lässt sich der genannten Passage des Koalitionsvertrags kaum entnehmen“, resümieren die Autoren bei Legal Tribune Online.
Was sich ändern soll: Aufgaben der Medienaufsicht
Im Koalitionsvertrag steht, die „staatsferne Medienaufsicht“ solle „unter Wahrung der Meinungsfreiheit auf der Basis klarer gesetzlicher Vorgaben“ gegen „Informationsmanipulation sowie Hass und Hetze“ vorgehen können. Gemeint seien damit die Landesmedienanstalten, heißt es aus der SPD-Fraktion. Sie sollten etwas gegen „Desinformationskampagnen insbesondere auf sozialen Plattformen“ tun – wie genau, müsse aber noch ausgestaltet werden.
Die Begriffe „Informationsmanipulation“ und „Hass und Hetze“ sind rechtlich nicht genau definiert. Im Koalitionsvertrag geht es im nächsten Satz um manipulative Verbreitungstechniken, zum Beispiel durch Bots. Das könnte mit „Informationsmanipulation“ gemeint sein und passt zur Aussage der SPD, es gehe um Desinformationskampagnen auf Sozialen Plattformen.
Auf Nachfrage teilt eine Sprecherin der Landesmedienanstalt Berlin-Brandenburg CORRECTIV mit, die Begriffe „beschreiben (rechts-)politische Zielsetzungen“. Bestimmte Formen von Informationsmanipulation oder Hass und Hetze fielen schon jetzt unter Straftatbestände oder Vorschriften zur Einhaltung journalistischer Sorgfaltspflichten. Teilweise gebe es aber Regelungslücken oder Modernisierungsbedarf bestehender Gesetze, zum Beispiel in Bezug auf koordinierte „Desinformationskampagnen, politische Werbung oder Sperrung von Angeboten verfassungswidriger Organisationen“.
Auf die Frage, ob den Landesmedienanstalten hierzu Gesetzesvorhaben der Union/SPD bekannt seien, antwortete die Sprecherin: „Medienrecht ist Ländersache. Die Bundesländer arbeiten derzeit an Novellen des Medien- und des Jugendmedienschutzstaatsvertrags, die nach unserer Einschätzung die vorgenannten Themen adressieren dürften.“
Der ehemalige Verfassungsrichter Peter Michael Huber kritisierte gegenüber dem Stern die Formulierung „Hass und Hetze“ als mögliche „Einfallstore“, um „ideologische Vorstellungen vor allem aus dem links-grünen Milieu“ durchzusetzen. Der „Korridor des Sagbaren“ werde seiner Meinung nach verengt und die Abgrenzung zum Strafrecht verschwimme.
Solche Kritik teilt Professor Hubertus Gersdorf von der Universität Leipzig nicht: „Hass und Hetze“ seien nur dann unzulässig, wenn sie gegen Verbotstatbestände, insbesondere gegen Persönlichkeitsrechte verstoßen, das sei nichts Neues. „Neu ist nur das Gefährdungspotenzial, weil unter den Bedingungen des Internet Massenkommunikation eine Jedermann-Freiheit geworden ist.“
Digital Services Act: Neue Regierung will bestehendes EU-Recht konsequent durchsetzen
Abgesehen von möglichen neuen Befugnissen für die Landesmedienanstalten enthält der Koalitionsvertrag zum Thema Desinformation wenig Neues. Die Parteien betonen, dass die Tech-Plattformen in die Pflicht genommen werden müssen. Die entsprechenden EU-Gesetze sollen durchgesetzt werden, „damit Plattformen strafbare Inhalte entfernen und systemische Risiken wie Desinformation aktiv angehen“.
Mit Plattformen sind Soziale Netzwerke wie Instagram, X oder Tiktok gemeint. Und das relevante Gesetz ist der Digital Services Act (DSA). Ein „systemisches Risiko“ sind für die EU zum Beispiel „nachteilige Auswirkungen auf die gesellschaftliche Debatte und auf Wahlprozesse und die öffentliche Sicherheit“.
Im DSA steht, Plattformen sollten analysieren, inwiefern ihre Algorithmen und Empfehlungs- oder Werbesysteme solche Risiken fördern. Und ob es zu gezielter Manipulation kommt, zum Beispiel durch automatisierte, koordinierte Prozesse, Bots und Scheinkonten. Die Plattformen sollen dann Maßnahmen dagegen treffen – das heißt nicht immer nur Löschen, möglich sind auch Werbeverbote oder das Hervorheben seriöser Informationen.
Forderung im Koalitionsvertrag: Verbot manipulativer Verbreitungstechniken
Diese Regulierung, also der DSA, ist längst in Kraft und somit keine Neuheit, die die neue Bundesregierung umsetzen würde. Aber im Koalitionsvertrag stehen einige Punkte, die eine Verschärfung dieser bestehenden Regeln beinhalten. Zum Beispiel steht da, die Einführung einer verpflichtenden Identifizierung von Bots werde geprüft.
Und „systematisch eingesetzte, manipulative Verbreitungstechniken wie der massenhafte und koordinierte Einsatz von Bots und Fake Accounts“ soll, geht es nach Union und SPD, komplett verboten werden. Die Koalition will zudem prüfen, ob die Plattformen stärker für die Inhalte, die bei ihnen verbreitet werden, haftbar gemacht werden können.
Klar ist also: Mit der potenziellen neuen Bundesregierung sollen die Zügel im Kampf gegen Desinformation in Sozialen Netzwerken angezogen werden. Wie das in der Praxis aussehen wird, zeigt sich in den kommenden Jahren.
Mitarbeit: Sophie Timmermann
Redigatur: Max Bernhard, Steffen Kutzner


