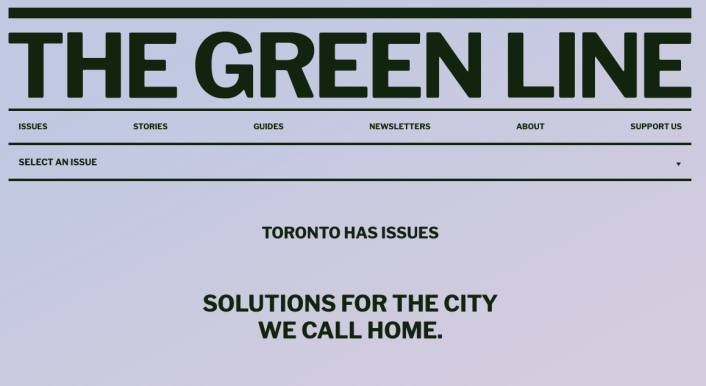Mit Community-zentrierter Wahlberichterstattung näher an den Menschen vor Ort
„Deine Stimme, deine Themen" zeigt, wie Lokaljournalismus Wahlberichterstattung neu gestalten kann: Indem die Fragen und Anliegen der Bürgerinnen und Bürger im Mittelpunkt stehen, entsteht eine Berichterstattung, die näher an der Lebensrealität der Menschen ist, politische Themen greifbar macht und die Beteiligung der Community in den Vordergrund stellt.

Wahlen prägen das demokratische Leben einer Stadt – und doch wirken viele klassische Wahlformate heute austauschbar. Häufig richten sich Beiträge nach Parteiprogrammen oder den Positionen der Kandidierenden. Dabei bleibt eine zentrale Frage oft unbeantwortet: Spiegelt diese Art der Berichterstattung tatsächlich wider, was Bürgerinnen und Bürger vor Ort bewegt?
Community-zentrierte Wahlberichterstattung setzt genau hier an. Sie stellt nicht politische Akteur*innen in den Mittelpunkt, sondern die Fragen, Sorgen und Ideen der Menschen vor Ort. Nicht Wahlkampfbotschaften bestimmen, was berichtet wird – sondern die Themen, die die Bewohner*innen einer Stadt als relevant benennen, von fehlender Infrastruktur bis zu sozialer Ungleichheit.
Mit dem Projekt „Deine Stimme. Deine Themen“ hat der CORRECTIV.StartHub diesen Ansatz gemeinsam mit sechs unabhängigen Lokalredaktionen erprobt: zunächst im Rahmen der Bundestagswahl 2025, später bei der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen. Inspiriert vom Citizen’s Agenda Modell aus den USA zeigt das Projekt, wie ein konsequenter Perspektivwechsel gelingt und Wahlberichterstattung wieder näher an der Lebensrealität der Menschen anknüpft.
Aus den Erfahrungen entstand ein Leitfaden, der anderen Redaktionen als Orientierung dient – von der frühen Projektplanung bis zur Auswertung nach der Wahl.
Wie community-zentrierte Wahlberichterstattung funktioniert
-
Frühzeitig Commitment sichern (6+ Monate vor der Wahl)
Ein solches Projekt benötigt viele Ressourcen und interne Unterstützung. Entscheidend ist, dass eine Redaktion frühzeitig festlegt, wer das Projekt trägt, welche Kapazitäten verfügbar sind und welchen Stellenwert die Initiative haben soll. Nur so lässt sich der Prozess über mehrere Monate hinweg verlässlich umsetzen.
-
Ziele, Mission und Zielgruppen definieren (ca. 4 Monate vorher)
Zu Beginn empfiehlt sich ein Mission Statement: Welche Ziele verfolgt die Redaktion? Sollen bestehende Leser*innen eingebunden oder neue Zielgruppen erreicht werden? Gleichzeitig werden Erfolgsindikatoren definiert – etwa Reichweite, Relevanz oder die Diversität der Teilnehmenden. Auch die Beteiligungsstrategie spielt eine Rolle: Wie wird die Zielgruppe eingebunden und wie erfolgt der Austausch nach dem Sammeln der Fragen?
-
Beteiligung starten und Themen sammeln (3-4 Monate vorher)
Sobald die Grundlagen stehen, beginnt die zentrale Phase: das Sammeln der Fragen und Anliegen der Menschen. Dies kann digital erfolgen – über Online-Formulare oder Social Media – oder analog, etwa über Straßenaktionen, Haustürgespräche, Veranstaltungen oder in Kooperationen mit lokalen Organisationen. Ziel ist es, Menschen dort zu erreichen, wo sie sich im Alltag aufhalten.
-
Die Wahlagenda erstellen (2-3 Monate vorher)
Die gesammelten Beiträge werden sortiert, analysiert und thematisch gebündelt. Daraus entsteht die Wahlagenda: eine Liste der wichtigsten Themen der Befragten, ergänzt um jeweils bis zu fünf konkreten Fragen pro Thema. Nach Fertigstellung wird die Agenda an die Teilnehmenden zurückgespielt – verbunden mit Dank und gegebenenfalls mit Einladung zu weiteren Formaten.
-
Berichterstattung entlang der Agenda entwickeln (1-2 Monate vorher)
Die Wahlagenda bildet den roten Faden der journalistischen Arbeit. Mögliche Umsetzungen umfassen:
- Formatserien zu den wichtigsten Themen
- Partei-Checks entlang der gesammelten Fragen
- Interviews, bei denen Kandidierende konkret mit der Agenda konfrontiert werden
- Hintergrundrecherche und Erklärstücke
- Veranstaltungen zum Austausch über die relevantesten Themen
Transparenz bleibt dabei zentral: Redaktionen sollten offenlegen, wie die Wahlagenda entstanden ist und aus welchen Gründen sie den Ansatz gewählt haben. Das schafft Legitimität gegenüber der Politik und Vertrauen gegenüber den Bürger*innen.
-
Wahl begleiten und einordnen
Am Wahltag selbst lässt sich der Ansatz fortführen: Live-Berichterstattung, Einordnung der Ergebnisse und Erklärformate greifen die zuvor gesammelten Themen auf und zeigen, wie politische Entscheidungen diese betreffen.
-
Nach der Wahl auswerten (0-2 Monate danach)
Im Anschluss folgt die Reflexion: Welche Ziele wurden erreicht? Welche Formate haben gut funktioniert? Wurden neue Zielgruppen erreicht? Die Ergebnisse können anschließend dokumentiert und mit anderen Redaktionen geteilt werden, um das gemeinsame Lernen zu fördern.
-
Verstetigen
Community-Journalismus endet nicht mit dem Wahltag. Die Methoden des Zuhörens und Einbindens lassen sich auf viele Kontexte übertragen – Bürgerentscheide, Themensammlungen oder Crowdrecherchen. Der Ansatz stärkt langfristig die Beziehung zwischen Redaktion und Community.
Warum sich Community-zentrierte Wahlberichterstattung lohnt
Der Ansatz führt zu einer Wahlberichterstattung, die näher an der Lebenswelt der Menschen ist. Er macht sichtbar, was Bürger*innen bewegt, stärkt Vertrauen und eröffnet neue Perspektiven auf lokale Politik. Redaktionen gewinnen dadurch:
- klarere Orientierung an relevanten Themen
- bessere und originellere Geschichten
- höhere Beteiligung, Sichtbarkeit und neue Zielgruppen
- eine stärkere Bindung zu den eigenen Leser*innen
- neue, vielfältigere und inklusivere Sichtweisen
Community-zentrierte Wahlberichterstattung schafft einen echten Mehrwert – weit über den Wahltermin hinaus.
„Durch ‚Deine Stimme, deine Themen‘ hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, wirklich zu wissen, was die Wählerinnen und Wähler wollen. Als ich diese 400 Fragen von unseren Leserinnen und Lesern gesehen habe, hatte ich ein Gefühl dafür, was die Menschen wirklich umtreibt. Das hat bei mir etwas verändert – aber auch bei den Politikerinnen und Politikern, die sich viel Zeit für die Antworten genommen haben.“ – Christian Herrendorf, Mitgründer von VierNull
Das Playbook: Einstieg leicht gemacht
Das „Deine Stimmen, deine Themen“-Playbook bietet eine Schritt-für-Schritt-Anleitung durch den Prozess der Community-zentrierten Wahlberichterstattung, konkrete Vorlagen und Beispiele aus der Praxis. Es unterstützt kleine Medienprojekte, etablierte Redaktionen sowie zivilgesellschaftliche Organisationen dabei, den Ansatz selbst umzusetzen – strukturiert, praxisnah und erprobt.
Direkt loslegen: Das Playbook kostenlos herunterladen.
Darüber hinaus bietet der CORRECTIV.StartHub Workshops zu Community-Journalismus an. Mit den Tools beabee und CrowdNewsroom wird zudem die nötige technische Infrastruktur zur Verfügung gestellt, um Beteiligungsprojekte und datenbasierte Recherchen durchzuführen.
Dieses Projekt ist Teil des Angebots vom CORRECTIV.StartHub, der Anlaufstelle für alle, die ihr eigenes Community-zentriertes Medienprojekt im Lokalen starten wollen.
Du willst keine Neuigkeiten verpassen?
Jetzt den StartHub-Newsletter abonnieren!Weitere Methoden, Templates und Best-Practice-Beispiele für deine Community-zentrierte Mediengründung findest du außerdem im Community-Journalismus Wiki