Die Meinungsfreiheit, die sie meinen
Unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit arbeiten Vertreter der AfD und Personen in ihrem Umfeld daran, Volksverhetzung zu normalisieren und zu legalisieren. Wie gehen sie vor und wie erfolgreich sind sie dabei?
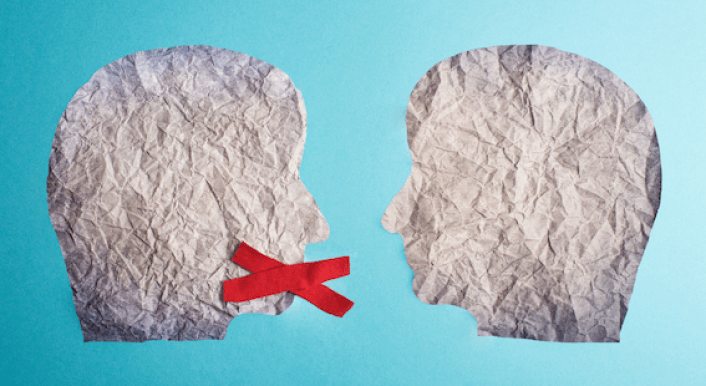
Als ein verurteilter Volksverhetzer in Haft muss, springt Björn Höcke ihm zur Seite. Der Verurteilte ist der rechtsradikale Youtuber Aron Pielka, besser bekannt unter dem Pseudonym Shlomo Finkelstein.
Zu einem Bild von Shlomo, das Höcke auf Facebook postet, schreibt er nicht das Wort „Volksverhetzung“, sondern „Meinungsfreiheit“. Höcke ist selbst wegen mutmaßlicher Volksverhetzung angeklagt. Er ist es auch, der den Straftatbestand der Volksverhetzung abschaffen oder zumindest einschränken wollte.
Damit ist er nicht alleine.
Der Fall „Shlomo“ ist nur ein Beispiel dafür, wie Vertreter der AfD und Personen in ihrem Umfeld die Meinungsfreiheit umdeuten. Manche verdrehen dabei Tatsachen, andere greifen das Justizsystem an. Das offenkundige Ziel: Die Grenzen des Sagbaren zu verschieben – und wenn es nach Einzelnen geht, sogar die Grenzen des Gesetzes.
Wie sehen die Strategien dahinter aus und was wäre, wenn sie erfolgreich sind?
Strategie Eins: Volksverhetzung als Meinungsfreiheit abtun
Ende 2020 wurde der Youtuber Aron Pielka alias „Shlomo Finkelstein“ vom Amtsgericht Köln unter anderem wegen Volksverhetzung auf Bewährung verurteilt, weil er antisemitische Darstellungen veröffentlicht und rassistische Lieder und islamfeindliche Koranverbrennungen abgespielt hat. Abgesehen davon war er in den inoffiziellen EU-Wahlkampf für die AfD verwickelt. Im August 2024 wurde er wegen Verstößen gegen seine Auflagen verhaftet.
In der AfD feiert man ihn als Helden. Da gibt es nicht nur Höckes Zuspruch, auf Landesebene werden von Lena Kotré, einer Abgeordneten in Brandenburg, „Free Shlomo“-T-Shirts verlost, auf Bundesebene tönt der Abgeordnete Matthias Helferich, Finkelstein könne jederzeit bei ihm im Bundestag auftreten und auf europäischer Ebene will Abgeordneter Alexander Jungbluth „den Fall auf die Tagesordnung der Plenarsitzung“ setzen.
Die Delikte des Youtubers werden von Teilen der AfD als Volksverhetzung in Anführungszeichen bezeichnet, seine Verurteilung als „Angriff auf die Meinungsfreiheit“. Die AfD Bundespartei schrieb mit Bezug auf „Shlomo“: „Die Zeiten, in denen das Äußern einer freien Meinung dazu führt, dass man hinter Gittern landet, müssen endlich vorbei sein“.
Ali B. Norouzi, Mitglied im Strafrechtsausschuss des Deutschen Anwaltverein, korrigiert diese Einschätzung: „Er hat gegen Bewährungsauflagen verstoßen und damit das Vertrauen widerlegt, auf dem die Bewährungsstrafe beruhte. Deshalb ist er verhaftet worden. Und seine Äußerungen waren nach Bewertung des Gerichts Volksverhetzung und nicht mehr von der Meinungsfreiheit gedeckt. Deshalb ist er bestraft worden“, so der Jurist im Gespräch mit CORRECTIV.Faktencheck.
Der X-Post der AfD verschwand im Laufe dieser Recherche, auf eine Anfrage antwortete die Bundespartei nicht. Auch alle weiteren Vertreterinnen und Vertreter der Partei, die CORRECTIV.Faktencheck zu dieser Recherche kontaktiert hatte, antworteten nicht.
Wo hört Meinungsfreiheit auf und wo fängt das Strafrecht an?
Die AfD zeichnet offenbar ihr eigenes Bild der Meinungsfreiheit – doch was umfasst die tatsächlich?
Die Meinungsfreiheit ist im Artikel 5 des Grundgesetzes geregelt, da heißt es: „Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten (…)“. Dann jedoch steht im nächsten Absatz: „Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze (…)”. So kommen strafrelevante Paragrafen wie Volksverhetzung (Paragraf 130 StGB) oder auch das Verbot verfassungswidriger Kennzeichen ins Spiel (Paragraf 86a StGB).
Was steht im Paragrafen 130, was im Paragrafen 86a?
Paragraf 130 im Strafgesetzbuch regelt den Straftatbestand der Volksverhetzung. Dabei geht es um verschiedene Formen der Hasskriminalität, etwa darum, „gegen eine nationale, rassische, religiöse oder durch ihre ethnische Herkunft bestimmte Gruppe, gegen Teile der Bevölkerung oder gegen einen Einzelnen wegen dessen Zugehörigkeit zu einer vorbezeichneten Gruppe oder zu einem Teil der Bevölkerung zum Hass aufstachelt, zu Gewalt- oder Willkürmaßnahmen“ aufzufordern. Es geht auch darum, die Menschenwürde anderer anzugreifen oder Handlungen der Nationalsozialisten zu billigen, zu leugnen oder zu verharmlosen. Der Strafrahmen reicht je nach konkretem Delikt von drei Monaten bis zu fünf Jahren oder Geldstrafen.
Paragraf 86a betrifft das „Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen“. Bis zu drei Jahre Haft oder eine Geldstrafe stehen darauf, wenn jemand etwa Abzeichen oder Parolen von verfassungswidrigen Parteien oder Vereinigungen verbreitet oder verwendet. Darunter fällt zum Beispiel das Hakenkreuz, das SS-Totenkopfsymbol oder die Grußformel „Sieg Heil“ – allerdings spielt in der Frage der Strafbarkeit auch der Kontext, in dem ein Symbol geteilt wird, eine Rolle, zum Beispiel, ob die Verwendung eines Symbols der Aufklärung dient.
Das heißt: Schon im Grundgesetz steht, dass die Meinungsfreiheit nicht grenzenlos ist. Auf der anderen Seite schützt die Meinungsfreiheit aber jene, die eine strittige Aussage machen.
Wenn nun die AfD auf X postet, der Paragraf zur Volksverhetzung sei „schwammig und längst ein beliebtes Werkzeug politisierter Strafverfolger“, dann ist das nach Ansicht von Strafrechtler Norouzi eine „plakative Zuspitzung“, die die bisherige Rechtssprechung – auch zugusten der AfD – ausblende. Er verweist da etwa auf den Fall Gauland: Der damalige AfD-Parteivorsitzende hatte 2017 über die damalige Integrationsbeauftragte Aydan Özoğuz gesagt, man könne sie „in Anatolien entsorgen“. Die Staatsanwaltschaft entschied mit Verweis auf frühere Urteile des Bundesverfassungsgerichts, dass die Äußerung im Rahmen der freien Rede lag.
Zuletzt urteilte das Bundesverwaltungsgericht im Falle von Compact: Auch wenn manche Inhalte des Magazins gegen die Menschenwürde verstießen, seien andere Inhalte – in diesem Fall etwa „Verschwörungstheorien und geschichtsrevisionistische Betrachtungen“, die in Compact Platz fanden – von der Meinungsfreiheit geschützt. Ein Verbot wäre nur dann gerechtfertigt gewesen, wenn die „verfassungswidrigen Aktivitäten“ überwogen hätten.
AfD-Vertretende nutzen Regierungsvorhaben zur Stimmungsmache
Nicht nur im Fall „Shlomo“ deuten AfD-Vertretende die Meinungsfreiheit um. So auch etwa im Zusammenhang mit Plänen der Union und SPD. Die Regierungskoalition will Menschen, die mehrfach wegen Volksverhetzung verurteilt wurden, das passive Wahlrecht entziehen und den Straftatbestand verschärfen. Ein solcher Vorschlag stieß in der Vergangenheit unter Fachleuten auf Kritik. AfD-Bundestagsabgeordnete Christina Baum nutzt ihn, um Volksverhetzung als „Äußerung von Meinungen“ abzutun.
Das stimmt schon allein deshalb nicht, weil juristisch unter Volksverhetzung nicht nur Meinungen fallen können, schreibt Jurist Mustafa Temmuz Oğlakcıoğlu, Professor für Strafrecht und Rechtsphilosoph an der Universität des Saarlandes und selbst Richter, auf Anfrage von CORRECTIV.Faktencheck. Der Paragraf umfasst etwa auch die Leugnung oder Verharmlosung der Nazi-Verbrechen. Oğlakcıoğlu formuliert das so: „Die Ermordung von sechs Millionen Juden stellt keine Meinung dar, sondern eine Tatsache.”
Strategie Zwei: Das Justizsystem sabotieren
Manche gehen deutlich weiter, als Volksverhetzung öffentlich zu bagatellisieren. Zum Beispiel der X-Account „Wuppi“, der dem rechten Aktivisten Patrick Kolek zugeordnet wird. „Wuppi“ kämpft auf eine andere Art für seine Version der Meinungsfreiheit: Er hat das Justizsystem im Visier. Auch wenn seine Reichweite dabei überschaubar ist, so ist er ein Bindeglied zur AfD. Er hat für sie gearbeitet und würde das offenbar gerne wieder tun.
Im Visier hat „Wuppi“ etwa jenen Staatsanwalt, der laut ihm gegen „Shlomo Finkelstein“ vorging. „Wuppi“ veröffentlichte nicht nur dessen Namen und Foto, er schrieb auch, er wolle ihm „ein wenig auf die Finger schauen“, der Staatsanwalt komme auf den „Prüfstand“. Der Staatsanwalt, so scheint es, steht für Kolek stellvertretend für den Rechtsstaat und für das, was Kolek als Einschränkung der Meinungs- oder Redefreiheit versteht. Weil er den Staatsanwalt exponiert habe, gab es eine Hausdurchsuchung bei ihm, das sagt auch Kolek in einem Video.
„Wuppi“ ruft in seinem „Rechtskampf“ auch dazu auf, „Material zu Staatsanwälten und Richtern“ einzusenden, um sie „unter die Lupe“ zu nehmen und dazu, deren Namen zu veröffentlichen. Auf Anfrage von CORRECTIV.Faktencheck schreibt Kolek, es gehe dabei um den „transparenten Ansatz, den Urteilen und Entscheidungen ein Gesicht zu geben. Ich träume von einem gläsernen Staat und Justizapparat“. Eine Bedrohung sieht er darin nicht.
Vor allem aber stellt Kolek selbst dutzende Anzeigen und andere Nutzer folgen seinem Beispiel. Etwa 60 Anzeigen sollen es bislang sein. Viele davon sind öffentlich, häufig geht es um angebliche Delikte von Volksverhetzung oder dem Zeigen verbotener Symbole. So veröffentlichte „Wuppi“ etwa eine Anzeige gegen den Stern, nachdem dieser im Rahmen seiner Berichterstattung ein Hakenkreuz auf dem Cover hatte, oder gegen den ehemaligen Gesundheitsminister Karl Lauterbach, weil dieser den Arm angeblich zum Hitlergruß gehoben habe. Von einer Staatsanwaltschaft, bei der gleich 19 derartige Anzeigen liegen, heißt es: „Zu einem nicht unerheblichen Teil sind die Verfahren eingestellt beziehungsweise Ermittlungen gar nicht erst aufgenommen worden.“
Werden solche Fälle eingestellt, sagt Strafrechtler Norouzi, bleibe die Botschaft übrig: „Soweit kann man noch gehen. Da passiert einem noch nichts“. Und: So könne man „das System gut sabotieren“, indem man Arbeit verursacht. Bei „Wuppi“ klingt das auf X so: „Wenn ihr keine Hausdurchsuchungen bekommt, dann sind wir vielleicht daran schuld“.
Fallen die Beiträge vom X-Account „Wuppi“ unter die Meinungsfreiheit?
Nicht nur die Anzeigen, auch andere Beiträge von „Wuppi“ scheinen die Grenzen der Meinungsfreiheit auszuloten. Abschließend bewerten kann man solche Beiträge auf Anhieb nicht, betonten von uns befragte Expertinnen und Experten. So sei etwa ein Meme, in dem es heißt, er arbeite daran, dass „Rassismus zum Alltagshumor wird”, auf den ersten Blick wohl keine Volksverhetzung, meint Strafrechtler Norouzi. „In diese Richtung“ gehe aber ein Bild vom sprechenden Hut aus den Harry-Potter-Filmen, der ein schwarzes Kind nach Askaban – also ins Gefängnis – schickt. Zu einem Beitrag, den Wuppi als Repost geteilt hat und in dem es um Geschlechtsverkehr zwischen Migranten und Ziegen geht, sagt Norouzi: „Da habe ich ein Störgefühl, da würde ich als Staatsanwalt schon mal genauer drauf schauen“.
Kolek schreibt dazu auf Anfrage: „Ich bin Redefreiheitsmaximalist und mache mir nicht viel daraus, wenn die Gefühlchen einzelner Leute, die mich hassen, tangiert werden“. Er betont: Erst kürzlich sei eine Volksverhetzungsanzeige gegen ihn eingestellt worden.
Aktivist, der gegen Staatsanwälte vorgeht, als Bindeglied zur AfD
„Wuppis“ X-Beiträge werden nur wenig geteilt, seine Reichweite hält sich in Grenzen. Gleichzeitig hat er Verbindungen zur Identitären Bewegung und zahlreiche Anknüpfungspunkte zur AfD.
Die AfD Köln stellte ihn 2020 als Referent der Kölner Ratsfraktion und als Kandidat für die damals anstehende Stadtratswahl vor – in den Stadtrat kam er nicht. Kolek bestätigt zudem auf Anfrage von CORRECTIV.Faktencheck, dass er einst die Social-Media-Betreuung für die AfD Wuppertal gemacht habe, die „endgültige Kündigung“ sei erst kürzlich erfolgt. Ein Amt habe er bei der AfD nicht, aber sei reguläres Mitglied. Die AfD Wuppertal antwortete nicht auf eine Anfrage von CORRECTIV.Faktencheck.
Von Vertreterinnen und Vertretern der AfD wird sein selbsternannter „Rechtskampf“ öffentlich verfolgt und augenscheinlich unterstützt. So fragt etwa Lena Kotré aus dem Brandenburger Landtag nach weiteren Details zu dem durch „Wuppi“ exponierten Staatsanwalt.
Bindeglied zur AfD und ihrem rechten bis rechtsextremen Vorfeld
Auf der einen Seite erhält „Wuppi“ für sein Vorgehen etwa Zuspruch von Erik Ahrens, einem rechtsextremen Aktivisten. Ahrens schreibt auf X, Kolek verteidige „die Ehre der SA“. Auch Martin Sellner, Kopf der österreichischen Identitären Bewegung (IB) warb für eine Petition Koleks zur „Freien Rede“. Die IB steht auf einer Unvereinbarkeitsliste der AfD – und Kolek offenbar sehr nahe. Die Adresse einer Agentur, deren alleiniger Inhaber Kolek laut eigenen Angaben ist, ist auch der Firmensitz von drei Unternehmen, die der IB zuzuordnen sind: der Kohorte UG, Schanze Eins und Gegenuni.
Auf der anderen Seite gibt es zahlreiche Anknüpfpunkte zur AfD: So tauschen sich etwa Thorsten Weiß aus der Berliner Fraktion und „Wuppi“ sich in lockerem Ton über Abschiebungen aus. Und dann ist da noch der in der AfD umstrittene Bundestagsabgeordnete Maximilian Krah, der sich mit „Wuppi“ öffentlich über die Kostenerstattung von 200 T-Shirts streitet, die „Wuppi“ offenbar im Zuge einer Aktion des „Stolzmonat“ ausgelegt haben soll. „Stolzmonat“ ist eine rechtsextreme Kampagne als Reaktion auf den Pride-Month. Krah antwortete nicht auf eine Anfrage von CORRECTIV.Faktencheck dazu.
Laut einem X-Beitrag von „Wuppi“ soll auch Steffen Kotré den „Stolzmonat“ finanziell unterstützt haben, auf Anfrage schreibt Kolek widerum, es habe keine „finanziellen Ströme“ gegeben. Steffen Kotré antwortete nicht auf eine Anfrage von CORRECTIV.Faktencheck, veröffentlichte anlässlich dessen aber ein Video, in dem er eine Verlosung zum „Stolzmonat“ startet.
Kolek macht klar, was sein Ziel ist: Dass Straftatbestände wie Volksverhetzung oder das Verwenden von verfassungswidrigen Symbolen abgeschafft werden – und so der Rahmen der Meinungsfreiheit endgültig neu gesetzt wird. Mit diesem Ziel ist er nicht der Einzige.
Strategie Drei: Konkrete Gesetzesänderungsanträge
Den Straftatbestand der Volksverhetzung wollten auch schon Hans-Georg Maaßen, Chef der rechtskonservativen Werteunion, oder der rechtsextreme Aktivist Erik Ahrens abgeschafft sehen. Der Paragraf „behindert den Rechtsruck, indem er Rassismus kriminalisiert“, schreibt Ahrens.
Keine Partei äußert sich so häufig zum Thema wie die AfD
CORRECTIV.Faktencheck hat sich im Zuge dieser Recherche ein Bild davon gemacht, wer sich in der Deutschen Politik innerhalb der vergangenen zwölf Monate besonders häufig zum Thema Meinungsfreiheit geäußert hat. Ausgangspunkt dafür war ein Datenpool an Social-Media-Accounts von Partei-Vertretenden der AfD, Grüne, BSW, CDU/CSU, FDP, Linke und SPD. Die Suche erfolgte über die Stichwörter „Meinungsfreiheit“, „Volksverhetzung“ und die in diesem Zusammenhang relevanten Paragrafen aus dem Strafgesetzbuch. Grundlage der durchsuchten Accounts waren die „Datenbank Öffentlicher Sprecher“ sowie Recherchen von CORRECTIV.
Im Vergleich zur AfD spricht keine andere Partei, beziehungsweise ihre Vertretenden, in einem solchen Ausmaß über die Meinungsfreiheit und die Abschaffung des Straftatbestands der Volksverhetzung.
Auch aus der AfD kommen immer wieder Forderungen Einzelner. Medienberichten zufolge stellte Björn Höcke beim AfD-Parteitag einen Antrag, um Paragraf 130 größtenteils abzuschaffen. In das Wahlprogramm der AfD hat es sein Antrag nicht geschafft.
Doch es gibt andere Anläufe, Gesetze im Namen der Meinungsfreiheit zu ändern. Erst Ende Juni brachte die AfD-Bundestagsfraktion einen Gesetzentwurf ein, mit dem Paragraf 188 im Strafgesetzbuch (Gegen Personen des politischen Lebens gerichtete Beleidigung, üble Nachrede und Verleumdung) abgeschafft werden soll – um die Meinungsfreiheit zu stärken, wie es zu dem Antrag heißt.
Im Dezember 2023 und im Oktober 2024 hat die Fraktion zwei Anträge unter dem Schlagwort „Keine Beschränkung der Meinungsfreiheit in den sozialen Netzwerken“ eingebracht. Darin fordert sie, das EU-Gesetz über digitale Dienste, den Digital Services Act, abzuschaffen. Es sieht vor, dass Online-Plattformen, wie Facebook oder Tiktok, auf illegale Inhalte angemessen reagieren müssen. Demnach müssen Plattformen rechtswidrige Inhalte „entfernen oder den Zugang dazu sperren“, sobald die Plattform „tatsächliche Kenntnis“ davon erlangt. Ihrem Antrag zufolge will die AfD das EU-Gesetz abschaffen, damit die Meinungs- und Informationsfreiheit nicht „noch weiter“ beschränkt würde.
Auf Anfrage von CORRECTIV.Faktencheck, ob die Bundestagsfraktion plant, einen Antrag auf Abschaffung von Paragraf 130 einzubringen, kam keine Antwort.
Wie würde eine Welt ohne Volksverhetzung als Straftat aussehen?
Was aber wäre, wenn der Paragraf 130 doch einmal fallen sollte? Eine Verschärfung oder zu strikte Verfolgung von Äußerungsdelikten sieht Oğlakcıoğlu kritisch – weil das auf längere Sicht auch missbraucht werden könnte.
Aber: Würde man Volksverhetzung als Delikt einfach abschaffen, würden auch Passagen fallen, die es verbieten, den Nationalsozialismus so zu verherrlichen und verharmlosen, dass es den öffentlichen Frieden stört. „Gerade in diesen Zeiten“ sei man aber auf so ein „Erinnerungsstrafrecht“ angewiesen, schreibt Oğlakcıoğlu.
Auch Strafrechtler Norouzi verweist darauf, dass der Nationalsozialismus immer weiter in die Vergangenheit rückt. Er vergleicht den Paragrafen der Volksverhetzung mit einem Stoppschild, das aufgestellt wird, damit bestimmte Tabus nicht fallen. Im Idealfall brauche es so ein Stoppschild nicht, „weil die Menschen so anständig sind, dass sie gewisse Dinge nicht sagen, dass sie nicht gegen Minderheiten polemisieren, nicht zum Hass auf Minderheit aufhetzen“. Aber: „Ich glaube, so weit sind wir leider noch nicht“.
Auch wenn die Meinungsfreiheit im Grundgesetz ist, braucht es keine Verfassungsmehrheit, um sie neu zu definieren. Damit Stoppschilder wie Paragrafen zur Volksverhetzung oder dem Verwenden verfassungsfeindlicher Kennzeichen fallen, reicht eine einfache Mehrheit im Bundestag. Momentan hat die AfD die nicht.
Redigatur: Sophie Timmermann, Paulina Thom
