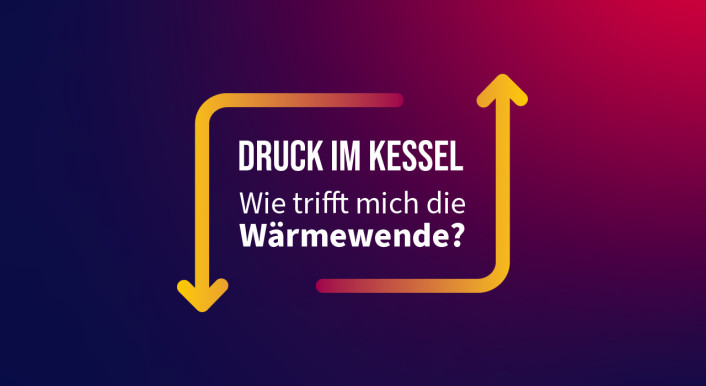Wärmewende: Sanierungsziele der Kommunen kaum erreichbar
Klimaziel 2040: Kommunen in Baden-Württemberg setzen auf erneuerbare Wärme und Einsparungen. Doch die geplanten Sanierungsraten sind teils viermal so hoch wie heute – und kaum realistisch.

Die Heizung nicht so stark aufzudrehen, reicht nicht aus. Um das baden-württembergische Klimaneutralitätsziel einzuhalten, müsste Waiblingen seinen Wärmebedarf bis 2040 mehr als halbieren. Das zeigt der Wärmeplan der Stadt. Wie hunderte andere Kommunen in Baden-Württemberg hat die Kommune geprüft, wie Haushalte, öffentliche Gebäude und Unternehmen bis zum Zieljahr mit erneuerbaren Wärmequellen auskommen können. Vor allem Bürgerinnen und Bürger sollen viel Heizenergie sparen.
Doch dafür müssten Eigentümer viel schneller Häuser dämmen, Dächer erneuern und Fenster tauschen als bisher. „Die Sanierungsrate liegt aktuell unter einem Prozent“, sagt Jeffrey Brencher, Klimaschutzbeauftragter der Stadt. „Eigentlich müssten wir auf vier Prozent kommen, damit der Wärmeplan aufgeht.“
Eine andere Stadt in Baden-Württemberg will bis 2040 etwa ein Fünftel weniger Heizenergie verbrauchen. Wie das gelingen soll? Trickserei, so die Bürgermeisterin, die anonym bleiben will. Denn damit ihre Stadt bis zum Zieljahr fast vollständig mit erneuerbarer Heizwärme auskommt, müssten Hausbesitzer laut Wärmeplan jedes Jahr rund drei Prozent aller Wohngebäude sanieren. „Das ist nur so hingerechnet“, kritisiert die Bürgermeisterin im Gespräch mit SWR und CORRECTIV. Es fehlten Material und Handwerker, außerdem könnten gerade ältere Menschen es sich nicht leisten, ihr Haus für viele Tausend Euro zu dämmen. Für sie steht fest: „Der Plan ist unehrlich.“
Wie erleben Sie die Wärmewende in Baden-Württemberg?
Baden-Württemberg möchte 2040 und damit fünf Jahre früher als der Bund klimaneutral sein. Ohne Wärmewende klappt das nicht. Deswegen möchten CORRECTIV und SWR im gemeinsamen Projekt „Druck im Kessel – Wie trifft mich die Wärmewende?“ von Ihnen wissen: Sorgen Sie sich um Ihre Heizkosten? Steht bei Ihnen ein Heizungstausch an? Oder sind Sie schon umgestiegen? Beteiligen Sie sich über diesen Link an unserer Umfrage und berichten Sie uns von Ihren Erfahrungen!
Fast alle Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg planen hohe Einsparungen: Um durchschnittlich ein Drittel müsste ihr Energiebedarf sinken, damit sie komplett mit erneuerbarer Wärme auskommen. Das zeigt eine Recherche, für die CORRECTIV und SWR 215 Wärmepläne ausgewertet haben.
Einige Kommunen wollen ihren Bedarf sogar – wie Waiblingen – auf weniger als die Hälfte reduzieren. Spitzenreiter ist die Stadt Hockenheim: 82 Prozent weniger Wärme soll dort verbraucht werden. Ein Ziel, das nur „theoretisch unter optimalen Bedingungen“ zu schaffen sei, merkt die Hockenheimer Stadtverwaltung gegenüber CORRECTIV und SWR an.
Auch Befragungen anderer Kommunen zeigen: Viele sorgen sich um ihre Sparziele – und manche Städte und Gemeinden rechnen sich die Wärmewende regelrecht schön.
Wärmewende bis 2040: Nicht ohne Energiesparen – vor allem zuhause
Dabei steht fest: Nur wenn der Wärmeverbrauch von Unternehmen, öffentlichen Gebäuden und Wohnhäusern sinkt, kommen die Städte und Gemeinden auch ohne Öl und Erdgas aus. Die Auswertung der Wärmepläne zeigt: Den größten Anteil müssten die Bürgerinnen und Bürger in Baden-Württemberg zuhause einsparen. Denn bislang entweicht zu viel Wärme durch schlechte Wände, alte Dächer und einfache Fenster.
Ganze zwei Drittel aller deutschen Wohngebäude rechnet der Bundesverband energieeffiziente Gebäudehülle e.V. (BuVEG) den Klassen D und abwärts zu. Die tiefroten, also schlechtesten, Energieeffizienzklassen G und H seien gar für 50 Prozent des gesamten deutschen Energieverbrauchs von Gebäuden verantwortlich.
Bislang ändert sich das nur im Schneckentempo: Seit mehr als 20 Jahren dümpelt die deutsche Sanierungsrate bei rund einem Prozent, im vergangenen Jahr erreichte sie laut BuVEG einen neuen Tiefstand von 0,69 Prozent.
Sanierungsquote
Auch im Südwesten dürfte die Sanierungsrate unter einem Prozent liegen, schätzt die Klimaschutzagentur Baden-Württemberg (KEA). Damit die Kommunen ihre Sparziele erreichen, müssten laut Geschäftsführer Volker Kienzlen mindestens doppelt so viele Häuser saniert werden. Doch dafür legen die Städte und Gemeinden in ihren Wärmeplänen zu wenige Maßnahmen vor, so Kienzlen im Gespräch mit CORRECTIV und SWR. Es sei fraglich, ob die Kommunen ihre Sparziele einhalten können.
Vor allem am Geld hapert es: Viele Hausbesitzer konzentrieren sich auf den Heizungstausch und sparen sich eine umfassende energetische Sanierung, so Tobias Nusser, Energieexperte bei EGS-plan. Für mehrere Städte und Gemeinden hat sein Ingenieurbüro schon Wärmepläne erstellt und Vorschläge gemacht, wie sie Heizenergie sparen können. Bei öffentlichen Gebäuden wie Schwimmbädern oder Schulen könnten die Kommunen mit gutem Beispiel vorangehen. Doch bei Wohnhäusern seien in der Regel die Eigentümer oder Wohnungsunternehmen gefragt.
Pflichten und Vorgaben für Hausbesitzer
Hier könnten Kommunen aufklären, warum Energiesparen wichtig ist, wie viel es kostet und welche Förderprogramme es gibt, sagt der Wärmeplaner. Besonders wichtig seien dabei die Wohnhäuser mit den höchsten Wärmeverlusten.
Sein Fazit: Die aktuelle Sanierungsrate von rund einem Prozent könnte besser sein. „Eine Verdopplung auf zwei Prozent gilt in unseren Wärmeplänen bereits als sehr ambitioniert – kann mit den richtigen Maßnahmen aber ein sinnvolles Ziel sein.“
Sanierungsraten von drei Prozent und mehr, wie Waiblingen und die Stadt der anonymen Bürgermeisterin sie planen, sind demnach kaum zu schaffen. Doch mit den Energieeinsparungen wackelt in den betroffenen Kommunen auch die Wärmewende bis 2040 – und damit das Klimaneutralitätsziel des Südwestens.
Förderung des Bundes entscheidend für Sparziele der Städte und Gemeinden
Dennoch haben Kommunen mit unschlüssigen Wärmeplänen offenbar keine Konsequenzen zu befürchten. Zwar überprüfen die baden-württembergischen Regierungspräsidien die Konzepte. Doch auf Anfrage von CORRECTIV und SWR erklären diese, dass sie Kommunen mit besonders hohen oder niedrigen Sanierungsraten und Sparzielen lediglich um Erläuterungen bitten. Außerdem müssten die Kommunen ihren Fortschritt nach spätestens sieben Jahren prüfen und die Pläne dann gegebenenfalls anpassen.
Als Schönrechnerei wollen die Präsidien Unstimmigkeiten nicht bezeichnen. Wärmepläne würden nicht genau vorhersagen, was wirklich passiert. Das hänge unter anderem davon ab, wie viel Geld der Bund künftig für Sanierungen bereitstellt. Ein eindeutiger Wink an die Regierungskoalition, die laut Haushaltsentwurf für 2026 die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) kürzen möchte.
Ohne Förderung haben Kommunen kaum Chancen
Schon jetzt sind viele Eigentümerinnen und Eigentümer verunsichert, warnt Frank Hettler, Leiter von Zukunft Altbau, einem Programm der KEA. Damit die Sanierungsrate steigt, seien neben verlässlichen Vorgaben auch langfristig verfügbare und unkomplizierte Förderprogramme nötig.
Sogar ein Leitfaden im Auftrag der deutschen Wirtschafts- und Bauministerien stellt klar: Die Kommunen sind auf Bundesprogramme und ergänzende Landesförderungen angewiesen – sie haben sonst kaum Chancen, Eigentümerinnen und Eigentümer für Sanierungen zu gewinnen.
Wenn die Ziele fürs Heizen nicht aufgehen: Sorge ums Klima
Der Waiblinger Klimaschutzbeauftragte Jeffrey Brencher bestätigt: „Durch kommunale Zuschüsse könnten Kürzungen auf Bundesebene nicht aufgefangen werden.“ Dass die vier Prozent Sanierungsrate aus dem Plan seiner Stadt ohnehin kaum realistisch sind, weiß auch Brencher. „Das ist eher eine fiktive Berechnung, unter welchen Annahmen die Wärmewende bis 2040 zu schaffen wäre.“
Anders als die anonyme Bürgermeisterin, die von Frust spricht, findet Brencher die Planung mit dem Zieljahr 2040 dennoch sinnvoll: „Nur wenn wir ein Ziel vor Augen haben, suchen wir auch einen Weg.“ Sollten die Einsparungen und damit die Wärmewende bis 2040 nicht gelingen, sorge er sich weniger um rechtliche Konsequenzen – sondern vor allem um die Zukunft seiner Kinder. „Wir spüren doch jetzt schon, wie sich das Klima verändert“, sagt der Waiblinger. „Da reicht der Blick auf die Streuobstwiese.“
Dieser Artikel ist Teil der gemeinsamen Beteiligungsrecherche „Druck im Kessel – Wie trifft mich die Wärmewende?“ von CORRECTIV und SWR. Recherche: Madlen Buck, Katarina Huth, Jann-Luca Künßberg, Lena Schubert (CORRECTIV) Eberhard Halder-Nötzel, Philipp Pfäfflin, Matthias Zeller (SWR) Recherche und Datenauswertung: Tom Burggraf, Katharina Forstmair, Elisa Harlan (SWR Data Lab) CrowdNewsroom: Marc Engelhardt, Sven Niederhäuser (CORRECTIV) Projektleitung: Justus von Daniels (CORRECTIV), Eberhard Halder-Nötzel (SWR) Redaktion: Justus von Daniels, Martin Böhmer Faktencheck: Martin Böhmer Kommunikation: Esther Ecke, Anna-Maria Wagner, Nadine Winter