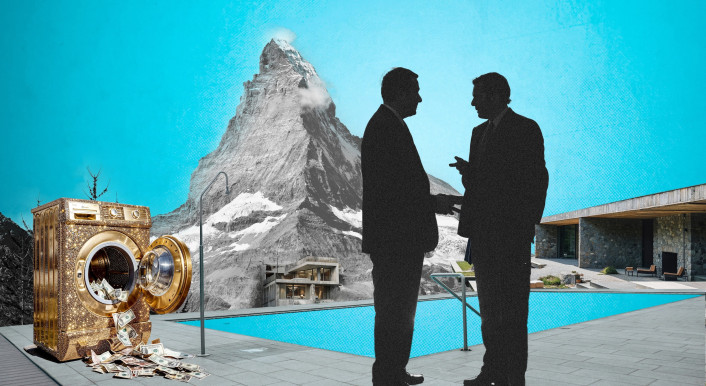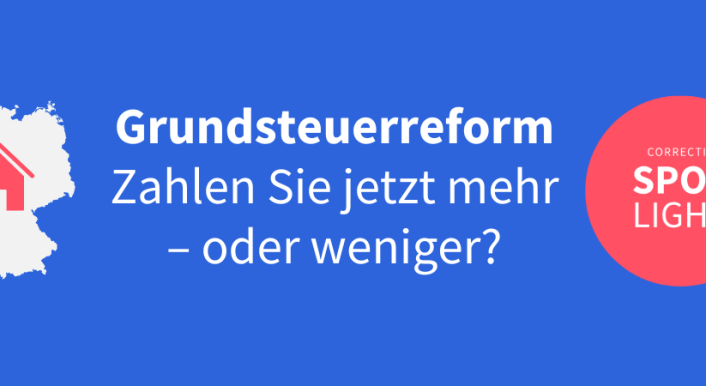Grundsteuer: Viele Kommunen missachten Steuerversprechen
Die Grundsteuerreform sollte die Besteuerung von Grundeigentum in Deutschland gerechter machen. Steuererhöhungen schloss der damalige Finanzminister Olaf Scholz 2019 aus. Doch eine Datenauswertung von CORRECTIV und Finanztip zeigt: Viele Kommunen erhöhen die Kosten – und missachten die Empfehlungen der Bundesländer. In Hessen überschreiten rund 80 Prozent der Gemeinden die Vorgaben, in Sachsen knapp ein Fünftel. Doch dafür gibt es Gründe.

„Abzocke“, „Schock“, „Frechheit“ – so ähnlich lauteten viele Schlagzeilen zur Reform. Hauseigentümer berichteten, plötzlich das Zehnfache zahlen zu müssen. Rentner erzählten, dass sie für ihr Nachkriegshäuschen so viel entrichten sollen wie andere für eine Luxus-Villa. Doch wie repräsentativ sind diese Fälle? Wie fair ist die Reform wirklich? Und greifen Städte und Gemeinden tiefer in die Taschen der Bürger, als sie dürften?
Dazu recherchiert CORRECTIV seit Monaten gemeinsam mit Leserinnen und Lesern und dem Portal Finanztip. Die erste Auswertung beleuchtet die Städte und Gemeinden zweier Bundesländer. Sie zeigt: Viele Kommunen erhöhen ihre Steuern für Eigentümer – und belasten damit in vielen Fällen auch Mieterinnen und Mieter.
CORRECTIV hat über 800 Kommunen in Hessen und Sachsen untersucht. Ein erster Trend: In Hessen erhöhen vier von fünf Kommunen die Hebesätze stärker, als das Bundesland empfiehlt. Sächsische Kommunen halten sich überwiegend an die Empfehlung des Landes.
Die Grundsteuer – ein Kurzüberblick
Die Grundsteuer zahlen alle Eigentümer von Grund und Boden – sie wird für ein Eigenheim ebenso fällig wie für Gewerbegrundstücke oder Wochenendgärten. Vermieter können sie allerdings auf die Mieterinnen und Mieter umlegen.
Die Höhe der Steuer hängt vom jeweiligen Grundstück ab – und vom sogenannten Hebesatz, den jede Kommune selbst festlegt. Der Hebesatz wirkt wie ein Hebel: Zeigt er nach oben, zahlen Eigentümer mehr, und die Kommune nimmt mehr ein. Zeigt er nach unten, sinken die Einnahmen. (Mehr zu den Details finden Sie in den ausklappbaren Boxen).
Grundwissen zur Grundsteuer
Die Grundsteuer zahlen Eigentümer auf ihren Grund und Boden. Sie wird von den Kommunen erhoben. Dabei wird im Wesentlichen zwischen Grundsteuer A und Grundsteuer B unterschieden. Grundsteuer A betrifft land- und forstwirtschaftliche Flächen. Grundsteuer B (relevant für diese Recherche) gilt hingegen für Grundstücke, die zu Wohn- oder Gewerbezwecken genutzt werden – oder etwa zur privaten Erholung.
Eigentümerinnen und Eigentümer können die Grundsteuer auf die Mietparteien umlegen.
Zusammensetzung der Grundsteuer:
Die Grundsteuer ergibt sich aus drei Faktoren: Dem Grundsteuerwert, der Grundsteuermesszahl und dem Hebesatz. Die drei Werte werden multipliziert und ergeben den zu zahlenden Beitrag. Die genaue Regelung ist abhängig vom Bundesland. Grob lässt sie sich so für das Bundesmodell zusammenfassen:
In den Grundsteuerwert fließen der Wert des Bodens, die Grundstücksfläche, die Grundstücksart, das Alter des Gebäudes und die Nettokaltmiete ein. Das Berechnungsmodell der Bundesländer beeinflusst ebenfalls die Grundsteuer. Das Finanzamt ermittelt den Grundsteuerwert.
Die Grundsteuermesszahl ist im Grundsteuergesetz des Bundeslandes festgelegt. Diese richtet sich nach der Nutzungsart. Beispielsweise ist sozialer Wohnungsbau niedriger besteuert als Einfamilienhäuser.
Den Hebesatz legen die Kommunen selbst fest. Er bestimmt, ob alle mehr oder weniger zahlen müssen.
Das Ergebnis der Datenauswertung
2019 versprach der damalige Finanzminister Olaf Scholz: Die Reform werde aufkommensneutral bleiben. Die Kommunen sollten also insgesamt nicht mehr einnehmen als zuvor. Einige Bundesländer berechneten dafür „faire Hebesätze“, die Steuererhöhungen vermeiden sollten. Doch diese Empfehlungen sind nicht verbindlich.
Jörg Leine, Steuerexperte des Geldratgebers Finanztip erklärt: „Das Versprechen von Scholz war von Anfang an ein leeres Versprechen. Denn damals wie heute gilt: Wie hoch der Hebesatz bei der Grundsteuer ist, legt jede Kommune völlig autonom für sich fest.“
Das bedeutet Aufkommensneutralität
Zur Recherche
Die Auswertung zeigt: In Hessen liegt der Hebesatz bei rund 80 Prozent der Kommunen über der Empfehlung des Landes. Über 56 Prozent der Gemeinden überschreiten die Vorgabe um mehr als fünf Prozent, einige sogar um über 100 Prozent. In Sachsen hingegen halten sich die meisten Kommunen an die Empfehlungen: Nur knapp jede Fünfte liegt mehr als fünf Prozent darüber.
Ist das die befürchtete Steuererhöhung?
Die Finanzexpertin Gisela Färber, Professorin für wirtschaftliche Staatswissenschaften, bestätigt: „Wer die Hebesatzempfehlungen ignoriert, betreibt de facto eine Steuererhöhung.“ Bei Abweichungen von mehr als zehn Prozent spricht sie von einer „spürbaren Erhöhung“ – vorausgesetzt, die Berechnungen der fairen Hebesätze sind korrekt.
Genau daran zweifeln einige hessische Gemeinden. In einem offenen Brief beklagt beispielsweise der Kreis Offenbach im Rhein-Main-Gebiet: Die vom Land empfohlenen Hebesätze seien fehlerhaft – und würden Haushaltslöcher in Höhe von mehreren Hunderttausend bis über eine Million Euro pro Kommune reißen. Der Grund: Das Land habe mit vorläufigen Steuerwerten gerechnet, von denen viele später – nach den Einsprüchen von Eigentümern – nach unten korrigiert worden seien. Auch eine Umfrage des Steuerzahlerbundes unter den Kommunen legt nahe, dass einige Empfehlungen des Landes fehlerhaft sein könnten. Etwa 70 hessische Gemeinden – rund ein Sechstel aller hessischen Gemeinden – gaben in der Erhebung vom Anfang des Jahres an, der empfohlene Hebesatz sei falsch berechnet.
Das hessische Finanzministerium weist diese Kritik CORRECTIV gegenüber zurück und besteht darauf, alles korrekt berechnet zu haben. Unabhängig überprüfen lässt sich das mit den vorliegenden Angaben jedoch nicht.
Das Problem ist der klamme Haushalt
Viele andere Kommunen, die den Steuerhebel nach oben gesetzt haben, bestätigen jedoch gegenüber CORRECTIV eine Steuererhöhung. Aus einem einfachen Grund: Die Kassen seien leer. Die Kosten für ihre Verwaltungsaufgaben seien in den letzten Jahren stark gestiegen, die Einnahmen aber nicht mitgewachsen. Daher müssten sie höhere Steuern nehmen, um ausgeglichene Haushalte vorlegen zu können. Die Grundsteuer ist für viele Gemeinden die wichtigste Einnahmequelle – vor allem dort, wo es kaum Unternehmen und damit kaum Einnahmen durch die Gewerbesteuer gibt.
Im Klartext heißt das: Die Haushaltslücke in den Kommunen müssen nun die Grundstückseigentümer füllen. Finanztip-Experte Jörg Leine erklärt: „Erhöht eine Gemeinde die Gewerbesteuer, könnten die Unternehmen abwandern. Erhöht sie die Grundsteuer, stellt sich dieses Problem nicht. Die Leute können nicht einfach weg.“
Werden Finanzprobleme auf die Bürger abgewälzt?
In manchen Kommunen sorgt das für Streit. Etwa in Eppstein im Main-Taunus-Kreis, einer 13.000-Einwohner-Kommune in malerischer Kulisse mit Burgruine. Hier liegt der Hebesatz bereits jetzt mehr als 30 Prozent über der Empfehlung des Landes. Die erste Stadträtin Sabine Bergold (CDU) will ihn sogar verdoppeln. Die SPD kritisiert das scharf: „In so einer Notsituation einfach das Problem auf die Bürgerinnen und Bürger der Stadt in Form einer saftigen Grundsteuererhöhung abzuwälzen, zeugt von Ideenlosigkeit“, schreibt ihr Vorsitzender Thomas Schäfer.

Bergold verteidigt die Erhöhung auf CORRECTIV-Anfrage: „In Eppstein hätte die Umsetzung der Empfehlung zu einem gravierenden Haushaltsdefizit geführt.“ Gründe seien vor allem gestiegene Personalkosten – etwa durch die jüngsten Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst. Zudem seien durch die Wirtschaftsflaute der letzten Jahre die Gewerbesteuereinnahmen gesunken und die finanziellen Abgaben an den Landkreis gestiegen.
Ähnliche Argumente nennen viele andere Kommunen gegenüber CORRECTIV. Viele bezeichnen die gestiegenen Kosten für Kinder- und Jugendbetreuung als einen der Haupttreiber: verursacht durch gestiegene Personalkosten und neue, vom Bund vorgegebene Standards.
Hinzu kommt, dass die finanzielle Unterstützung vom Land Hessen für wirtschaftsschwächere Kommunen geringer ausfällt als erhofft. Das bestätigt die Oberfinanzdirektion Hessen. Auch hier sei die schwache wirtschaftliche Gesamtentwicklung der Grund.
Immer mehr Aufgaben von Bund und Land
Die Finanzprobleme der Kommunen haben auch mit einer Verantwortungsverschiebung von oben nach unten zu tun. Das zeigt sich im etwa eine Autostunde von Eppstein entfernt liegenden Lindenfels, einer 5.000-Einwohner-Gemeinde mitten im Odenwald. Hier liegt der Steuerhebel um mehr als 60 Prozent über der Empfehlung des Landes. „Was bleibt den Kommunen anderes übrig?“, schreibt Bürgermeister Maximilian Klöss (SPD) an CORRECTIV. Schließlich würden Bund und Länder immer mehr Aufgaben an die Kommunen delegieren – ohne aber ausreichend Geld bereitzustellen.
In einem offenen Brief an die Koalitionsparteien im Bund beklagen das auch die anderen Bürgermeister seines Landkreises. Darin heißt es: „Berlin und Wiesbaden entscheiden – die Kommunen zahlen. So kann es nicht weitergehen.“ Sie fordern mehr Unterstützung: Wer bestellt, müsse auch bezahlen. Heißt: Wenn Bund und Länder den Kommunen neue Aufgaben vorschreiben, sollen sie das auch finanzieren.
Eine Forderung, der sich auch Expertin Gisela Färber anschließt.
Sachsen: Ein knappes Fünftel der Kommunen erhöht die Steuern
In Sachsen halten sich die meisten Kommunen an die Empfehlungen. Hirschstein im Landkreis Meißen ist jedoch einer der Orte, die die Vorgaben des Landes um mehr als fünf Prozent überschreiten. Hier leben rund 2.000 Menschen mitten im ländlichen Raum. Der Hebesatz liegt 31 Prozent über der Landesempfehlung. Bürgermeister Conrad Seifert (CDU) nennt – ähnlich wie die hessischen Kommunen – gestiegene Personalkosten und zusätzliche Aufgaben von Bund und Ländern als Gründe.
Die Grundsteuer sei der einzige Hebel. „Laut Landesentwicklungsplan dürfen wir weder große Gewerbegebiete noch sonst irgendetwas haben, höchstens Wölfe und Windräder.“ Hirschstein besitzt zwei Gewerbegebiete mit jeweils zwei Unternehmen. Die sächsische Landesentwicklung begrenzt aber neue Gewerbegebiete: Orte wie Hirschstein dürfen ihren lokalen Eigenbedarf nicht überschreiten. Das Gewerbe bringt demnach nur begrenzte Einnahmen. Für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt bedeute die Erhöhung des Hebesatzes laut Seifert konkret 25 Euro mehr im Jahr.

Eine genauere Analyse der Daten zeigt, dass es vielen kleinen Kommunen ähnlich geht: Mehr als vier von fünf sächsischen Kommunen, die die Empfehlungen um mehr als fünf Prozent überschreiten, zählen weniger als 5.000 Einwohner. Größere Städte hingegen halten sich an die Richtwerte des Landes.
Es gibt aber auch unter den kleinen Orten Ausnahmen. In Weißenborn etwa, einem Ort mit 2.400 Einwohnern am Fuß des Erzgebirges, liegt der Hebesatz fast 40 Prozent unter den Empfehlungen des Landes. Bürgermeister Udo Eckert (parteilos) erklärt: „Unsere Gewerbesteuereinnahmen bescheren uns eine sehr komfortable Situation, so dass wir unsere Einwohner nicht mit hohen Grundsteuern belasten müssen.“
Fazit
Die Umstände vor Ort sind entscheidend, wie die Beispiele demonstrieren. Dennoch zeigt die Datenauswertung der Hebesätze einen klaren Trend: In Hessen überschreiten die meisten Kommunen den vom Bundesland empfohlenen Korridor. In Sachsen passiert das deutlich seltener. Woran liegt das?
Gisela Färber vermutet die Sozialausgaben als Haupttreiber: „Die sächsischen Kommunen geben pro Einwohner weniger für Soziales aus und verzeichnen einen geringeren Kostenanstieg als Hessen.“ Beispiel Kita-Kosten: Westdeutschland hängt hinterher und muss besonders in Ballungsgebieten noch ausbauen. Währenddessen schließen Kindertagesstätten im Osten, weil viele Plätze leer bleiben.
Insgesamt hält Färber die Grundsteuerreform aber für im Großen und Ganzen gelungen – anders als es die eingangs erwähnten Artikel zur Grundsteuerreform nahelegen. Denn diese fokussieren vielfach auf besonders herausstechende Einzelbeispiele, nicht aber auf die Masse. Färber folgert: „Die Steuerlast wird vielerorts gerechter verteilt als zuvor.“
Dennoch zeigt diese Recherche: Für einige geht das mit Steuererhöhungen einher. Und auch ganz grundsätzlich gibt es noch Diskussionen – zum Beispiel, ob alle Modelle, die die Bundesländer jeweils gewählt haben, verfassungskonform sind. Mitte November sind am Bundesfinanzhof dazu mehrere Verfahren angesetzt – etwa zur Umsetzung in Hessen und Baden-Württemberg. CORRECTIV und Finanztip beobachten dies weiter.
Autoren: Tristan Devigne, Sebastian Haupt
Redigatur: Annika Joeres, Miriam Lenz
Faktencheck: Kilian Voß
Mitarbeit: Anette Dowideit, Bianca Poersch, Gabriela Keller
CrowdNewsRoom: Marc Engelhardt
Hinweis: Die Daten wurden sorgfältig geprüft, natürlich kann es trotzdem zu einzelnen Abweichungen kommen. In einigen Gemeinden finden beispielsweise nachträglich noch Anpassungen der Hebesätze statt. Sie haben dazu Hinweise oder einen Fehler entdeckt? Schreiben Sie gern an tristan.devigne@correctiv.org.