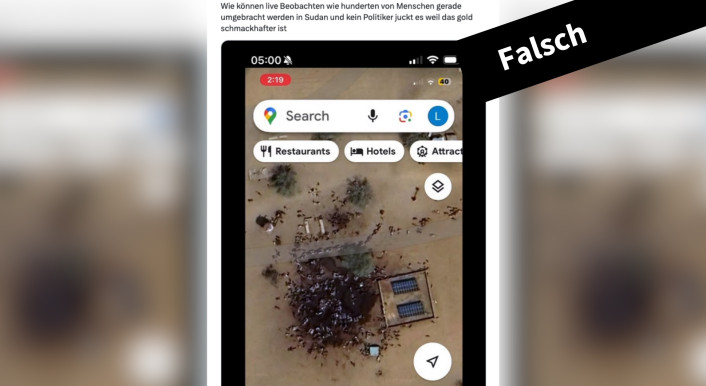Sudan: Europa muss nicht machtlos sein
Im Sudan spielt sich eine der größten humanitären Katastrophen der Menschheit ab. Wir in Europa schauen ungläubig zu – dabei könnten wir durchaus politisch mehr tun, schreibt die sudanesische Journalistin und Menschenrechtlerin Amal Habani.
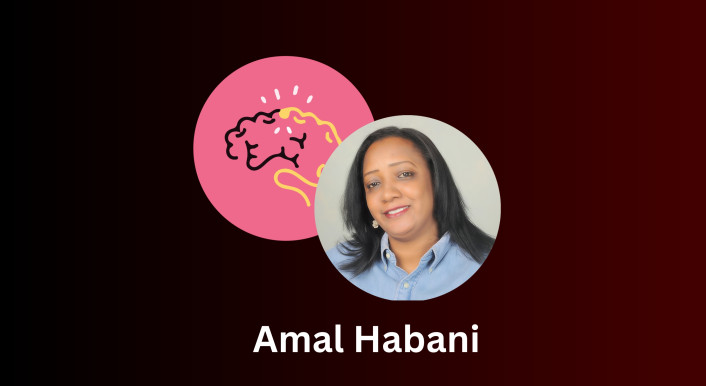
Seit April 2023 befindet sich der Sudan in einem Krieg, der sich still und leise zu einer der schlimmsten humanitären Krisen der Welt entwickelt hat.
Der Konflikt trifft ein Land, das zuvor jahrzehntelang unter einem unterdrückerischen Regime zu leiden hatte. Was als Machtkampf innerhalb des sudanesischen Militärs begann, hat sich zu einem Zusammenbruch der gesamten Nation ausgeweitet.
Gegenüber stehen sich vor allem die sudanesischen Streitkräfte (SAF) unter General Abdel Fattah al-Burhan auf der einen und die paramilitärischen Rapid Support Forces (RSF) unter Führung von Mohamed Hamdan „Hemedti“ Dagalo auf der anderen Seite.
Wie kam es noch mal zum Konflikt im Sudan?
Die Wurzeln des Konflikts reichen bis ins Jahr 2019 zurück. Damals trugen sudanesische Demonstranten dazu bei, den langjährigen Diktator Omar al-Bashir zu stürzen. In der darauf folgenden unsicheren Übergangsphase gewannen die RSF an Einfluss. Sie waren aus den berüchtigten Milizen des Darfur-Massakers hervorgegangen.
Politische Analysten warnten bereits damals: Der Sudan habe ein System geschaffen, in dem zwei bewaffnete Institutionen ohne nennenswerte zivile Kontrolle um die Macht konkurrierten.
Sowohl der General der sudanesischen Streitkräfte, Burhan, als auch der RSF-Anführer Hemedti unterhielten eigene militärische Netzwerke und Wirtschaftsimperien, einschließlich der Kontrolle über Goldminen und Schmuggelrouten. Wie die Washington Post damals feststellte, ging es bei der Rivalität weniger um Ideologie als um Macht, Geld und Überleben.
Wie sich die Gewalt im Sudan breit machte
Im April 2023 brachen nach Tagen angespannter Mobilisierungen die Kämpfe zwischen beiden Lagern aus. Sie erfassten sofort die Hauptstadt. Die RSF-Einheiten wurden von den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Libyschen Nationalarmee, dem Tschad und anderen politischen Einheiten unterstützt. Sie stürmten strategische Standorte in Khartum. Die sudanesische Armee reagierte mit Luftangriffen.
Die Gewalt breitete sich nach Darfur, in die Kurdufan-Staaten, nach Gezira und darüber hinaus aus. Al Jazeera und AP News berichteten von Zivilisten, die tagelang ohne Nahrung und Wasser in ihren Häusern gefangen waren, während Schüsse und Explosionen durch die Stadt hallten.
Im Laufe des Jahres 2023 und bis ins Jahr 2024 veränderte sich die Lage im Sudan ständig. Ende 2024 eroberten RSF-Kämpfer Wad Madani, die Hauptstadt des Bundesstaates al-Dschazira. Die Armee eroberte die Stadt Wochen später zurück.
In Nord-Darfur rückten die Milizen der RSF auf Städte wie Al-Maliha vor. Durch die folgenden Kämpfe wurden zehntausende Menschen vertrieben. In Omdurman, einer 2,4-Millionen-Stadt im Zentrum Sudans, wurde ein überfüllter Markt beschossen; Dutzende Menschen kamen ums Leben.
Der Guardian berichtete von Szenen, in denen Menschen durch Rauch rannten, während Leichen auf dem Boden lagen. In El-Fasher, der einzigen verbliebenen größeren Stadt in Darfur, die nicht unter der Kontrolle der RSF stand, wurde eine Entbindungsklinik von Drohnenangriffen getroffen. Die Organisation Ärzte ohne Grenzen beschrieb die Szene später als „jenseits von allem, was wir seit vielen Jahren gesehen haben“.
14 Millionen Vertriebene im Sudan
Anfang 2025 war die humanitäre Lage vollständig zusammengebrochen. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen belief sich die Zahl der Vertriebenen auf fast 14 Millionen, eine der größten Vertreibungen weltweit. Die Nachrichtenagentur AP News hob die fast hungersnotähnlichen Zustände in Teilen des Landes hervor, wo Familien sich von Blättern und Tierfutter ernähren. Das Gesundheitssystem brach zusammen.
In Gebieten mit knappem Trinkwasser brach die Cholera aus. Krankenhäuser wurden geschlossen oder zerstört. Teams von Ärzte ohne Grenzen, die in Darfur und den Kurdufan-Staaten arbeiten, warnten wiederholt vor einer zunehmenden Unterernährung von Kindern. Einige Kliniken berichten von Kleinkindern, die weniger als die Hälfte des gesunden Mindestgewichts wiegen.
Warum diplomatische Bemühungen im Sudan scheiterten
Die diplomatischen Bemühungen sind wiederholt gescheitert. Ein im saudi-arabischen Dschidda unter Beteiligung der USA und Saudi-Arabiens ausgehandeltes Waffenstillstandsabkommen brach laut Washington Post fast sofort zusammen. Die Europäische Union versuchte, die Vermittlung mit der Afrikanischen Union und der Intergovernmental Authority on Development (IGAD) zu koordinieren. Wie europäische Beamte gegenüber Reuters einräumten, will aber keiner der beiden Militärführer aus einer Position der Schwäche verhandeln.
Burhan besteht darauf, dass es keine politische Lösung geben wird, solange die RSF nicht aus allen besetzten Gebieten vertrieben sind. Hemedti präsentiert sich weiterhin als Verfechter eines „neuen Sudan“ – während er Truppen befehligt, denen einige der schlimmsten Gräueltaten in Darfur seit Anfang der 2000er Jahre vorgeworfen werden.
Was Europa im Sudan tun kann
Europa ist jedoch nicht machtlos. EU-Beauftragte für humanitäre Hilfe erklärten gegenüber der Nachrichtenagentur AP im Jahr 2025, dass Europa zu einem der größten Geldgeber des Sudan geworden sei und Nahrungsmittelhilfe, medizinische Operationen und Unterkünfte für vertriebene Zivilisten finanziere. Der Bedarf steigt jedoch weiter. Die Spendenmüdigkeit wird zu einer echten Bedrohung.
Europäische Diplomaten haben auch weitere gezielte Sanktionen, Reiseverbote und das Einfrieren von Vermögenswerten für Kommandeure ins Spiel gebracht, die den Frieden behindern oder in Kriegsverbrechen verwickelt sind. Einige dieser Maßnahmen sind bereits in Kraft, wie die Deutsche Welle und der Europäische Auswärtige Dienst berichten, auch wenn ihre Durchsetzung nach wie vor uneinheitlich ist.
Die größere Herausforderung ist langfristig. Der Sudan wird letztendlich mehr als nur Hilfe brauchen. Er wird Schulen wiederaufbauen, Straßen reparieren und Krankenhäuser sanieren müssen. Er wird eine Wirtschaft brauchen, die nicht von bewaffneten Gruppen kontrolliert wird. Um einen Dialog um die Zukunft des Landes führen zu können, brauchen sudanesische Bürgerinitiativen, Frauennetzwerke, Jugendorganisationen und Gemeindeälteste einen Platz.
Dies sind die Stimmen, die die Revolution von 2019 auslösten – und später beiseite gedrängt wurden, von Generälen, die Stabilität versprachen, aber den Zusammenbruch herbeiführten.
Europa kann diese Gruppen unterstützen, aber es kann keine politische Lösung erzwingen. Alle Bemühungen zur Beendigung dieses Krieges müssen vom Sudan selbst geleitet werden und lokal verankert sein. Dennoch hat Europa eine Rolle zu spielen: Es muss den Sudan auf der globalen Agenda halten, der Versuchung widerstehen, sich abzuwenden, und dazu beitragen, die humanitären Folgen so weit wie möglich abzumildern.
Die Lage im Sudan kann nicht länger ignoriert werden
Die Tragödie des heutigen Sudan liegt nicht nur in der Gewalt, sondern auch in dem Schweigen, das sie umgibt. Wie Reuters kürzlich in einer Meldung schrieb: „Ein Krieg dieser Größenordnung sollte nicht unsichtbar sein.“ Und doch ist er es oft. Das Leid im Sudan konkurriert mit vielen anderen globalen Krisen, und die Aufmerksamkeit der Welt wandert schnell weiter.
Aber die Menschen, die diesen Krieg durchleben, haben nicht den Luxus, wegzuschauen. Ihre Häuser sind zerstört, ihre Familien vertrieben, ihre Zukunft ungewiss. Dies ist ein Appell an die internationale Gemeinschaft, einschließlich Europa, den Sudan nicht als Nebensache zu behandeln, denn die Folgen werden noch jahrzehntelang in der gesamten Region nachwirken. Wenn sie sich für ein beharrliches und bescheidenes Engagement entscheidet, könnte der Sudan noch einen Weg zurück finden: zu Stabilität, Gerechtigkeit und Wiederaufbau.
Die Lage im Sudan kann nicht länger ignoriert werden, denn es handelt sich nicht nur um einen Krieg, sondern um einen Völkermord und eine ethnische Säuberung der indigenen Gemeinschaften im Sudan. Die Welt muss handeln.
***
Amal Habani ist Preisträgerin des Internationalen Preises der Pressefreiheit. Sie schreibt vor allem für das sudanesische Medium Al-Taghyeer und wurde bei ihrer journalistischen Arbeit mehrfach von offiziellen sudanesischen Behörden behindert.