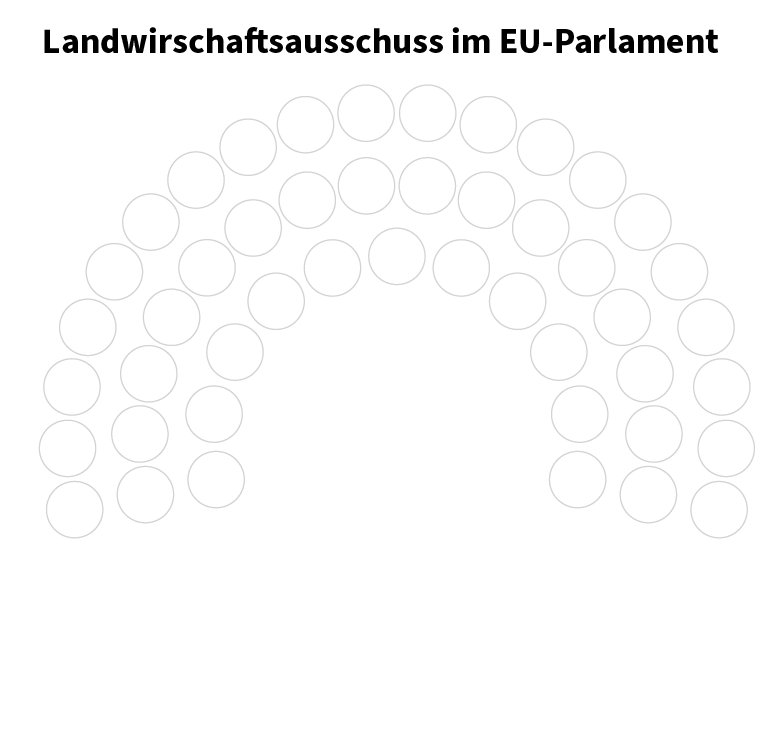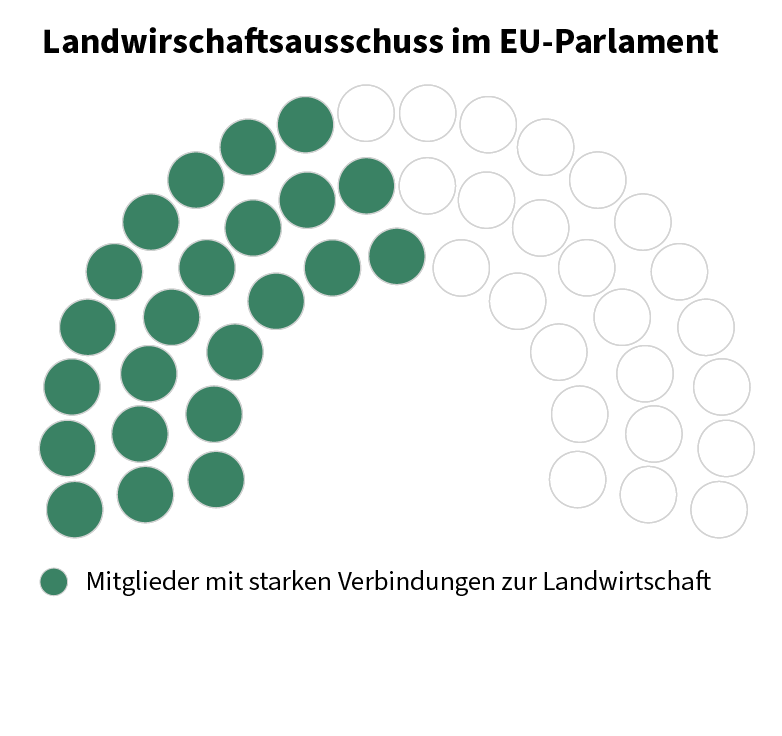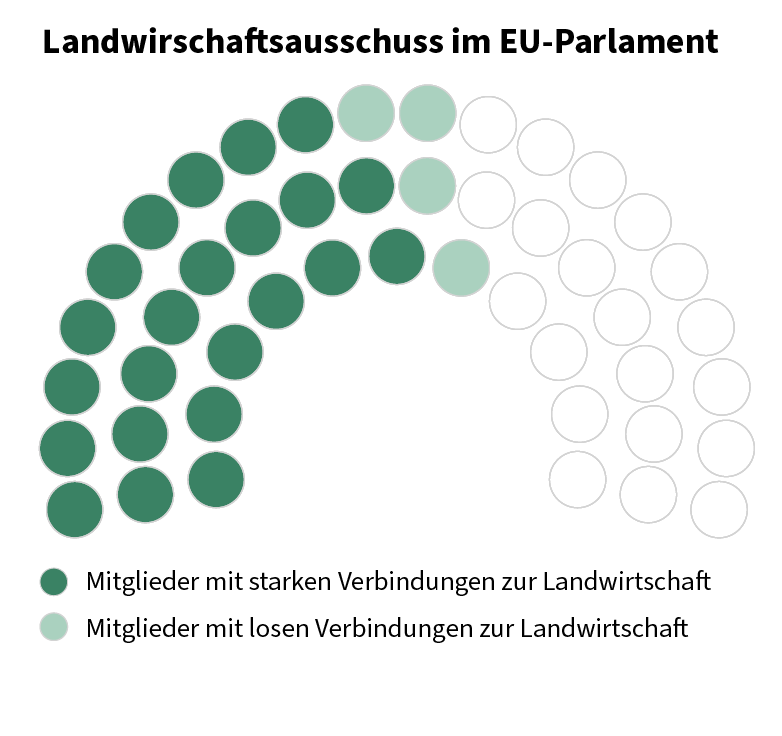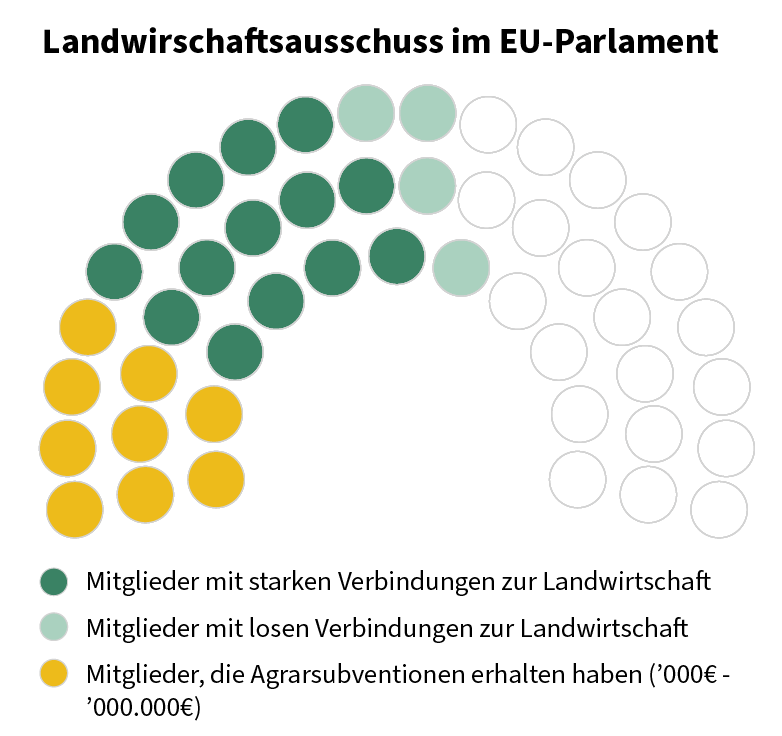„Nach acht Jahren nutzlosem Beschweren mussten wir einen härteren Schritt gehen“, sagt Gabór Zámbó. Der pensionierte Bürgermeister ist einer der Kläger. Für ihn sind die penetranten Dünste auch eine psychische Belastung.
„Ich schäme mich“, sagt der 65-Jährige. Früher bekamen er und seine Frau, vor allem im Sommer Besuch von Freunden. Doch statt appetitlichem Grillduft, dominierte die Note von Gülle die Sommertafel. „Ich habe eine große Familie, und wir standen uns nahe“, erklärt er. „Meine Schwester und ihre Kinder wohnten mit uns in der gleichen Straße – aber jetzt sind sie weggezogen. Sie kommen nicht einmal gerne zu Besuch.“
„Soziale Isolation ist eine häufige Folge, die ernsthafte Risiken für die psychische Gesundheit und auch körperliche Auswirkungen haben kann“, sagt Gesundheitsexpertin Smit.
Kisbér ist ein Fall von diversen Einzelschicksalen. Als Teil des Gerichtsverfahrens hat jeder der 119 Klägerinnen einen Zeugenbericht mit Bence Szentkláray, dem Anwalt, der die Bürgerinnen und die Stadt vertritt, aufgenommen.
„Da ist diese Frau mittleren Alters. Sie sitzt im Rollstuhl und leidet an Asthma“, sagt Szentkláray. Als sie aufgrund ihres Gesundheitszustands nicht mehr arbeiten konnte, zog sie mit ihrer Familie an den Stadtrand von Kisbér und suchte ein Leben in der Natur. Sie hatten sich vorgestellt, dass sie wenigstens an warmen Tagen im Garten an dem kleinen Bach sitzen können. „Jetzt ist sie dort gefangen, wo die Luft und das Wasser Gestank, Fliegen und Ratten zu ihr bringen“, erklärt der Anwalt. Schon seit einiger Zeit werde sie von Depressionen geplagt.
Es war ein langer Weg, 119 Menschen davon zu überzeugen, den Mut zu finden, für sich selbst einzutreten – auch wenn der Grund für die Klage eindeutig ist. „In Ungarn ist es immer noch verbreitet, Angst zu haben, gegen Unternehmen oder Politiker vorzugehen“, sagt Szentkláray. Einige berichten, dass sie sich unter Druck gesetzt fühlten. „Manche fürchten um ihren Arbeitsplatz, wenn sie ihre Meinung laut und öffentlich kundtun.“
Das erste Urteil im Rechtsstreit wurde nach zwei Jahren verkündet, zugunsten der Kläger. Es wurde jedoch nicht rechtskräftig, da Rechtsmittel eingelegt wurden.
Im April dieses Jahres entschied das Gericht zum zweiten Mal: Das Gericht stufte die Dünste als Geruchsbelästigung ein und führte sie auf die Handhabung von Gülle zurück. Zudem urteilte es, dass Bakony Bio Zrt. dadurch das Persönlichkeitsrecht auf Achtung des Privat- und Familienlebens der Klägerinnen verletzt. Bei der Urteilsverkündung wurde jedoch keine potenzielle Gesundheitsgefährdung mit einbezogen. Bakony Bio Zrt. soll Betroffene mit 300.000 HUF oder 500.000 HUF (1.000 Euro, 1.600 Euro) entschädigen. Ein Betrag, den sie als „lächerlich und beleidigend“ empfinden.
Die Klägerseite will jetzt in die nächste Instanz gehen.
Weder Vertreter der Bakony Bio Zrt, der Eigentümer Peter Pongrácz, noch deren Verteidiger war bereit, CORRECTIV ein Interview zu geben. Pongrácz sandte jedoch eine schriftliche Erklärung.
Bezüglich der Beschwerden der Anwohner von Kisbér behauptete Pongrácz, dass Geruchstests mehrmals von verschiedenen Behörden durchgeführt worden seien: „Es wurde jedes mal sichergestellt, dass weder die Biogasanlage, noch die Schweinefarm Geruchs-Emissionen abgeben, die geeignet wären, die Anwohner von Kisbér zu beeinträchtigen.“ Außerdem verfüge die Anlage über „alle erforderlichen Genehmigungen“, einschließlich der Umweltschutzgenehmigung, die „zum dritten Mal erneuert” wurde.
Er äußerte sich nicht zu dem Gerichtsverfahren, in dem nachgewiesen wurde, dass die Geruchsbelästigung durch die Bakony-Bio-Anlage in Kisbér die Anwohner unnötig belästigt.
Die Gesundheitsexpertin Lidwien Smit stimmt zu, dass solche Anlagen problematisch sein können, aber nicht nur wegen der Geruchsbelästigung: „Mehrere Studien kommen zu dem Ergebnis, dass die Ammoniakkonzentration in Bodennähe in der Nähe von Viehzuchtanlagen verhältnismäßig hoch ist“, sagt Smit. Langzeitstudien zeigen, dass Menschen, die den Emissionen solcher Höfe ausgesetzt sind, eine Verschlechterung der Lungenfunktion aufweisen und ein entsprechendes Krankheitsrisiko steigt.