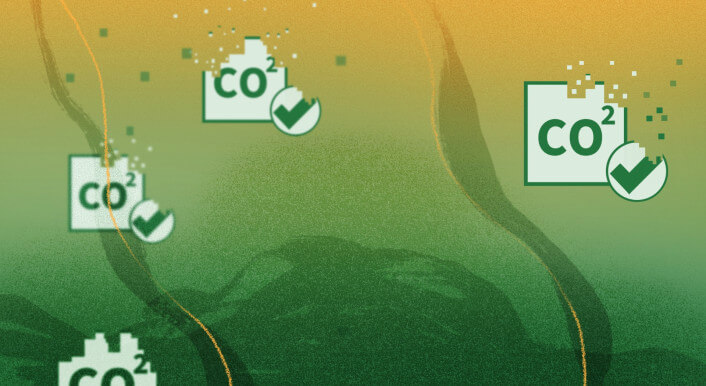Wärmewende: Kommunen kämpfen mit Milliardenlücke
Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg schlagen Alarm: Für die Wärmewende fehlen Geld und klare Regeln. Das Zieljahr 2040 wackelt – der Stand im Südwesten zeigt, welche Hürden deutschlandweit warten.

Eigentlich muss es in Schwetzingen jetzt richtig schnell gehen. Innerhalb der kommenden 15 Jahre will die Barockstadt in Baden-Württemberg von aktuell 70 Prozent Öl- und Erdgasheizungen auf klimaneutrale Wärme umgestiegen sein.
Doch dafür fehlt das Geld. Mit den aktuellen Förderungen sei der Umbau nicht zu schaffen, sagt Dagny Pfeiffer, die Klimaschutzmanagerin von Schwetzingen. Auf 90 Millionen Euro schätzt sie die Kosten für den 22.000-Einwohner-Ort.
„Das ist nicht zu schaffen“, so beschreibt es die Bürgermeisterin einer anderen Stadt, die anonym bleiben möchte. Das Zielszenario sei „völlig unrealistisch“. Ihr Resümee: Innerhalb von 15 Jahren kann die Wärmewende nicht klappen.
Ziel fürs Klima: Kommunen schlagen Alarm
Auch viele andere Kommunen im Südwesten fühlen sich ausgebremst. Es mangelt vor allem an Geld: Von 112 Kommunen, die sich an einer Umfrage von CORRECTIV und SWR beteiligt haben, geben 90 Prozent an, dass die Finanzierung ihnen die größten Sorgen macht. 66 Prozent brauchen mehr Personal. Und 88 Prozent wünschen sich gesetzliche Planungssicherheit. Von Land und Bund fühlen sie sich alleingelassen.
Dabei war Baden-Württemberg ursprünglich vorangegangen: Es war das erste deutsche Bundesland, das seine Städte zu einer detaillierten Planung für klimaneutrales Heizen verpflichtet hat, um die eigenen Klimaziele zu erreichen – bis 2040 und damit fünf Jahre früher als der Bund.
Um herauszufinden, wie diese Pionierarbeit in der Praxis funktioniert, haben wir 215 Wärmepläne ausgewertet und über das Online-Tool CrowdNewsroom erstmals Kommunen in Baden-Württemberg umfangreich zu ihrer Wärmewende befragt. Zahlreiche Bürgermeister und Klimaschutzmanagerinnen äußern sich.
Die Auswertung zeigt: Zahlreiche Kommunen zweifeln, ob sie die Ziele erreichen können – obwohl die meisten motiviert sind, die Mammutaufgabe Wärmewende anzugehen. Immerhin decken sie aktuell mehr als 73 Prozent ihres Wärmebedarfs durch Öl und Gas, wie die Analyse ihrer Wärmepläne zeigt. Nur bei Neubauten zeigte sich 2024 ein Trend zur Wärmepumpe.
Was aktuell im Südwesten passiert, betrifft ganz Deutschland. Denn die Vorreiterkommunen in Baden-Württemberg sind ein Gradmesser der Wärmewende: Ihr Fortschritt zeigt, ob die politischen Rahmenbedingungen taugen.
Wie erleben Sie die Wärmewende in Baden-Württemberg?
CORRECTIV und SWR möchten im gemeinsamen Projekt „Druck im Kessel – Wie trifft mich die Wärmewende?“ von Ihnen wissen: Sorgen Sie sich um Ihre Heizkosten? Steht bei Ihnen ein Heizungstausch an? Oder sind Sie schon umgestiegen? Beteiligen Sie sich über diesen Link an unserer Umfrage und berichten Sie uns von Ihren Erfahrungen!
Wärmeplanung: Landesregierung macht Hoffnung auf nachhaltiges Heizen
Baden-Württemberg hat bereits vor fünf Jahren für seine 104 kreisfreien und großen Kreisstädte eine verpflichtende kommunale Wärmeplanung eingeführt, die bis Ende 2023 vorliegen musste. Auch kleinere Gemeinden haben schon freiwillig ihre Planungen abgegeben. Mit der Pionierrolle hätten die Kommunen die Möglichkeit, früher „hin zu einer zukunftsträchtigen und nachhaltigen Wärmeversorgung zu kommen“, heißt es noch heute beim Landesumweltministerium in Stuttgart. Der Wissens- und Zeitvorsprung solle sich auszahlen. Doch genau das scheint nicht zu gelingen.
Während sich die Europäische Union und die deutsche Regierung um Klimaziele streiten, müssen die Kommunen sie umsetzen. Denn die Wende wird vor Ort gemacht: Tausende Heizungen müssen getauscht, Kraftwerke auf erneuerbare Wärme umgestellt, Altbauten gedämmt werden. Egal ob Hausbesitzer, Industrie oder Energieunternehmen – sie alle brauchen viel Geld und klare Vorgaben für die Wärmewende.
„Der bundespolitische Schlingerkurs bremst“
Wofür es aber künftig Bundesmittel gibt und wie lange Öl- und Gasheizungen erlaubt sein werden, kann keine Kommune selbst entscheiden – da ist vor allem die Regierung in Berlin gefragt.
Doch von der kommen bislang unklare Signale, zuletzt zweifelten Regierungspolitiker offen Deutschlands Ziel an, bis 2045 klimaneutral zu sein. Auch die Pläne der zuständigen Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) sind höchstens vage, auf schriftliche Fragen von CORRECTIV und SWR reagiert ihr Haus ausweichend. Gerade die von Reiche angekündigte Überarbeitung des Gebäudeenergiegesetzes, das umgangssprachlich als „Heizungsgesetz“ bekannt ist, verunsichert Hausbesitzer, Wärmebranche und Kommunen. Ziel der Bundesregierung sei es, „so bald wie möglich“ einen Gesetzesentwurf für das GEG vorzulegen, schreibt das Bundeswirtschaftsministerium auf Anfrage.
Was besagt das sogenannte „Heizungsgesetz“?
Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) regelt, wie Gebäude in Deutschland gebaut, saniert und beheizt werden müssen, um Energie zu sparen und CO₂ zu reduzieren. Es wurde ursprünglich 2020 von der CDU-geführten Bundesregierung eingeführt.
Im Oktober 2023 verabschiedete die darauffolgende Ampelkoalition eine umfassende Novelle des Gesetzes, seit dem 1. Januar 2024 ist sie in Kraft. Seitdem müssen Neubauten mindestens 65 Prozent ihrer Wärme aus erneuerbaren Energien beziehen – etwa durch Wärmepumpen, Solarthermie oder Fernwärme. Bestandsgebäude sollen Schritt für Schritt modernisiert werden.
Das GEG gilt als zentraler Baustein der Wärmewende und soll eine Klimaneutralität Deutschlands bis 2045 ermöglichen.
Den Kommunen läuft jedoch die Zeit davon. Sie sind rechtlich an die Ziele der Bundes- und Landespolitik gebunden. „Der bundespolitische Schlingerkurs bremst die machbare Transformation“, schreibt Georg Pins, der den Fachbereich Klima, Natur, Umwelt der Stadt Mannheim leitet, im CrowdNewsroom.
„Die Bundesförderprogramme sind eine Katastrophe“
Auch beim Geld hakt es: Fast alle der 112 Kommunen, die auf unsere Umfrage geantwortet haben, geben an, dass die Finanzierung die Pläne hemmt oder gar blockiert. Die geschätzten Kosten der lokalen Wärmewende erstrecken sich von wenigen Millionen Euro in kleinen Gemeinden mit ein paar tausend Einwohnern bis hin zu 16 Milliarden für 630.000 Stuttgarterinnen und Stuttgarter.
Geld, das viele Gemeinden nicht haben. Zur Kritik der Kommunen, dass die Förderprogramme nicht ausreichten, äußert sich das Bundeswirtschaftsministerium auf Anfrage nicht.
Mehrere Kommunen beklagen zudem die langsame Bewilligung von Bundesgeldern. Monate, teilweise sogar Jahre kann es laut der Umfrage dauern, bis der finale Bescheid für ein neues Wärmenetzgebiet oder ein Heizkraftwerk da ist. Zeit, die bei der Umsetzung fehlt.
Viele Kommunen ärgern sich über die langen Wartezeiten. „Die Bundesförderprogramme sind eine Katastrophe“, schreibt Susanne Widmaier, Bürgermeisterin in Rutesheim, im CrowdNewsroom. „Es dauert ewig und für uns eilt es sehr.“ Statt zäher Antragsprozesse schlagen viele Kommunen daher direkte Zahlungen vor. So fordert Petra Neubauer, Klimamanagerin für Villingen-Schwenningen: „Es muss leichter und schneller gehen.“
Auf Anfrage von CORRECTIV und SWR schreibt das Bundeswirtschaftsministerium dazu vage, dass es gemeinsam mit dem Kompetenzzentrum Kommunale Wärmewende in Abstimmung mit den Ländern und Vertretern der Kommunen an „schlanken Prozessen“ arbeite, auch, um kleinere Kommunen zu entlasten. Beispielsweise soll es einfacher werden, Wärmeplanungsdaten zwischen den Behörden zu übermitteln. Konkreter wird das Ministerium nicht. Zur Forderung der direkten Zahlungen äußert es sich nicht.
Wärmewende: Wer muss liefern – Bund oder Land?
Wärmeexperte Markus Fritz vom Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung hält das Landesklimaziel 2040 unter den aktuellen Rahmenbedingungen für kaum erreichbar. Lässt die Bundesregierung die Vorreiter im Südwesten mit ihren vorgezogenen Zielen also allein?
Gezielt fördern sollte die Bundesregierung die Kommunen in Baden-Württemberg jedenfalls nicht, findet Fritz. Denn das könne auch nach hinten losgehen: „Der Gesamttopf ist begrenzt, dann könnte für Bundesländer, die ohnehin schlechter dastehen, weniger Geld bleiben.“
Er sieht eher die Landesregierung in der Pflicht, mehr Verantwortung zu übernehmen: „Sie hat schließlich auch das vorgezogene Ziel 2040 gesetzt.“ Doch die verweist auf Anfrage vor allem wieder zurück auf den Bund. Immerhin setze sie sich dafür ein, dass die Förderprogramme auf Bundesebene länger laufen und finanziell aufgestockt werden.
Während Kommunen, Landes- und Bundesregierung aufeinander zeigen, bleibt die Wärmewende wegen Bürokratie, langer Wartezeiten und knapper Mittel stecken. Oft zum Ärger vor Ort – denn, auch das hat die Befragung von CORRECTIV und SWR ergeben: Viele Kommunen klingen motiviert, die Umsetzung endlich anzukurbeln.
Dieser Artikel ist Teil der gemeinsamen Beteiligungsrecherche „Druck im Kessel – Wie trifft mich die Wärmewende?“ von CORRECTIV und SWR. Recherche: Madlen Buck, Katarina Huth, Jann-Luca Künßberg, Lena Schubert (CORRECTIV) Eberhard Halder-Nötzel, Philipp Pfäfflin, Matthias Zeller (SWR) Recherche und Datenauswertung: Tom Burggraf, Katharina Forstmair, Elisa Harlan (SWR Data Lab) CrowdNewsroom: Marc Engelhardt, Sven Niederhäuser (CORRECTIV) Projektleitung: Justus von Daniels (CORRECTIV), Eberhard Halder-Nötzel (SWR) Redaktion: Justus von Daniels, Martin Böhmer Faktencheck: Martin Böhmer Kommunikation: Esther Ecke, Anna-Maria Wagner, Nadine Winter