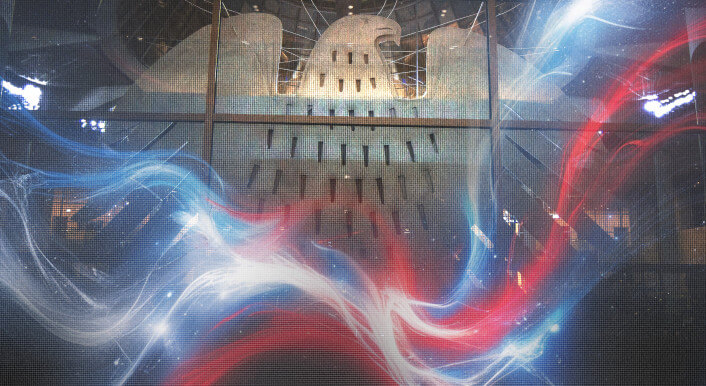Bezahlter Hass: Parteien schalten irreführende Werbeanzeigen auf Facebook und Instagram
Auf Meta-Plattformen schalten Politiker und Parteien im derzeitigen Bundestagswahlkampf billige Anzeigen, um Hass und eindeutige Falschinformationen zu verbreiten. Das ergibt eine Auswertung von CORRECTIV.
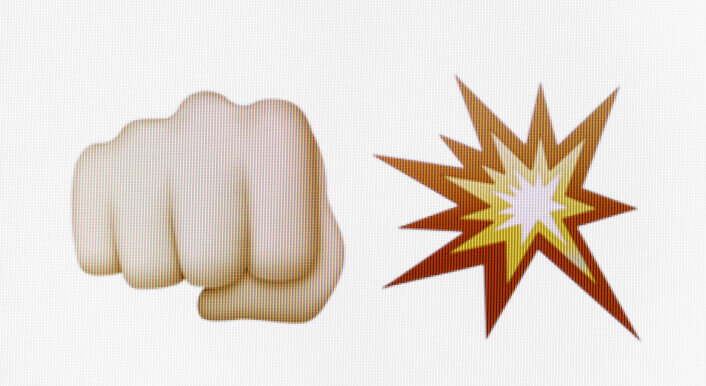
Hohe Asylbewerberleistungen als „Magnet“ für Geflüchtete oder „Linksextreme und junge Männer in sozialen Brennpunkten“ als „Hauptverdächtige“ für Angriffe in der Berliner Silvesternacht. Das erste ist eine nicht belegbare These, das zweite eine Falschbehauptung – nur ein kleiner Auszug aus politischen Facebook-Anzeigen der letzten Wochen.
In Deutschland tobt der Wahlkampf – auch online. Dabei verbreiten einzelne Parteien und Abgeordnete durch bezahlte Werbeanzeigen auch falsche Informationen, Hass gegen Minderheiten und irreführende, teils rechtsextreme Narrative – und erreichen damit potenziell Hunderttausende.
Wenig überraschend: die AfD setzt auf diese Strategie im Wahlkampf – aber auch in den Feeds und Timelines von demokratischen Parteien wie der FDP oder dem BSW finden sich Aussagen, die entweder irreführend, nicht belegbar, abwertend oder schlicht falsch sind. Das zeigt eine Auswertung von 141 Werbeanzeigen auf den Plattformen Facebook und Instagram durch CORRECTIV.
Auf Meta wirbt die FDP mit irreführenden Aussagen
So schaltete die FDP-Bundestagsfraktion im Dezember 2024 zwei Anzeigen, in denen behauptet wird, dass alle zwei Minuten ein Job in der Industrie verloren gehen würde. Verbunden mit Kritik am Verbrenner-Aus und der Warnung vor einer „existenziellen Bedrohung für die Automobilindustrie“. Auf Nachfrage gibt die Partei allerdings keine stimmige Quelle für diese Aussage an und bezieht sich generell auf den Rückgang der Beschäftigung in der Industrie.

Martin Gornig, Forschungsdirektor für Industriepolitik am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), kann die Aussagen der FDP nicht bestätigen. Es habe zwar in der Industrie Beschäftigungsverluste gegeben. „Die Erwerbstätigkeit lag im verarbeitenden Gewerbe im dritten Quartal 2024 um 1,4 Prozent niedriger als zwei Jahre zuvor.“ Aber ein Einbruch sei das nicht.
Ein Narrativ, das zwar irreführend ist, aber offenbar gut funktioniert: Insgesamt wurde die Facebook-Anzeige rund eine Million Mal angezeigt. Und auch auf Instagram wirbt die Partei mit dem massenhaften Jobverlust.
Beide Plattformen gehören zu Mark Zuckerbergs umstrittenem Konzern Meta, der jüngst ankündigte, künftig auf die Kooperation mit unabhängigen Faktencheck-Redaktionen zu verzichten. Zumindest in den USA. Ohnehin ausgeschlossen davon, Beiträge mit Warnhinweisen zu Faktenchecks zu versehen, sind Politiker und Parteien. So können sie ungehindert auch Falschbehauptungen oder irreführende Aussagen in Timelines von Tausenden und Hunderttausenden potenziellen Wählerinnen und Wählern spülen, wie diese Recherche belegt.
CORRECTIV konnte in den 141 ausgewerteten Anzeigen gleich mehrere Beispiele für eindeutige Falschinformationen und Hatespeech ausfindig machen. Also Informationen, die entweder falsche Fakten verbreiten, oder Aussagen, die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit wie Rassismus, Sexismus oder Antisemitimus propagieren.
Meinungsäußerungen sind nicht rechtswidrig
So schreibt Robert Lambrou, AfD-Abgeordneter im hessischen Landtag, von „unheilvollen“ Entwicklungen an Schulen, die ihren Ursprung darin haben, dass Mädchen in der Klasse sitzen, „deren Haare“ für die meisten Lehrer nicht mehr sichtbar seien. In anderen AfD-Werbeposts ist die Rede von Syrern und der „hemmungslosen Plünderung unseres Sozialsystems“, von christlichen Flüchtlingen, die – anders als muslimische Flüchtlinge – keine Straftaten begehen würden und von „Messermigranten“. Die letzte Anzeige wurde mittlerweile von Meta entfernt, da sie gegen die Werberichtlinien der Plattform verstößt.
Das Problem an Posts dieser Art: Sie gelten häufig als Meinungsäußerung und sind damit nicht rechtswidrig. Anke Stelkens, Rechtsanwältin und Vorsitzende der Kommission Digitales im Deutschen Juristinnenbund, sieht darin eine „kommunikationswissenschaftliche Strategie“. In Werbeanzeigen dieser Art würden „die Grenzen der Meinungsfreiheit“ sehr genau ausgelotet und es werde permanent versucht, diese zu weiten. Deshalb können auch Posts unterhalb der Rechtswidrigkeitsschwelle durchaus demokratiegefährdend sein.
In manchen Fällen reichen schon weniger als hundert Euro aus, um sich mit Falschbehauptungen in den Algorithmus zu kaufen. Wie in einer weiteren Werbeanzeige Lambrous. Er schreibt von „1000 Vergewaltigungsfällen von Moslems“ in der Kölner Silvesternacht. Laut dem Mediendienst Integration waren es 28 Anzeigen wegen versuchter oder vollendeter Vergewaltigung. Auch der Hinweis auf den muslimischen Glauben der vermeintlichen Täter ist falsch: die Religionszugehörigkeit wird bei Sexualdelikten laut Bundeskriminalamt nicht erhoben.
AfD setzt auf Angst im Bundestagswahlkampf
Was auffällt in der CORRECTIV-Analyse: Gerade die AfD und ihr politisches Personal nutzen immer wieder die gleichen Begriffe in ihrer Wahlwerbung, die allesamt rechtspopulistische, teils rechtsextreme Narrative bedienen. Von den 141 ausgewerteten Anzeigen wurden 105 von der AfD geschaltet.
„Ungeregelte Massenmigration“, „kriegsähnliche Zustände“, „Migrantengewalt außer Kontrolle“ sind nur drei Beispiele, die regelmäßig vorkommen. Auch der höchst umstrittene Begriff der „Remigration“ wird so von AfD-Politikern, Partei-Accounts und AfD-nahen Konten in den Diskurs gespült. Der rechtsextreme Tarnbegriff meint die Vertreibung von Millionen Menschen.
So fordert der AfD-Bundestagsabgeordnete René Bochmann in weißer Schrift auf AfD-blauem Hintergrund die baldige „Remigration“ von Syrern nach dem „Ende der Assad-Herrschaft“. Ähnlich äußert sich auch der verteidigungspolitische Sprecher der AfD im Bundestag, Rüdiger Lucassen. Mitte Dezember schaltete er eine Anzeige, in der er positiv hervorhebt, dass der Machtwechsel in Syrien eine „neue Perspektiven für die Remigration“ eröffne.
Hatespeech, Falschinformationen und Desinformation
- Desinformation meinte nach einer Definition der Europäischen Kommission die gezielte und nachweislich bewusste Verbreitung von falschen oder irreführenden Informationen. „Die zum wirtschaftlichen Vorteil oder zur absichtlichen Täuschung der Öffentlichkeit erstellt, präsentiert und verbreitet werden und der Öffentlichkeit Schaden zufügen können“.
- Falschinformationen sind falsche oder ungenaue Informationen, die auch ohne nachweisbare Intention verbreitet werden.
- Es gibt keine einheitliche wissenschaftliche Definition von Hatespeech. Sie kann deutlich zu erkennen sein oder auch unterschwellig auftreten. Meist geht es dabei um menschenfeindliche Aussagen, um gruppenbezogenen Hass wie Rassismus, Sexismus oder Antisemitimus. Bei Hatespeech unterscheidet Anke Stelkens, Rechtsanwältin und Vorsitzende der Kommission Digitales im deutschen Juristinnenbund, zwischen verbaler Gewalt mit oder ohne direkte Ansprache einer Person. Wird keine individuelle Person beschimpft, sind die Äußerungen oft noch von der Meinungsfreiheit gedeckt, weil sie nur in den engen Strafbarkeitsgrenzen der Volksverhetzung (§130 StGB) sanktionierbar sind.
Viel Geld muss die AfD für ihre Strategie dabei nicht aufbringen. Für den Großteil ihrer Anzeigen haben die parteinahen Accounts weniger als 100 Euro ausgegeben. Mit Erfolg: mindestens 1,2 Millionen Mal wurden die Anzeigen bisher aufgerufen.
„Alle Parteien setzen auf Emotionen im Wahlkampf“, sagt Simone Rafael, „die AfD setzt auf die Emotion Angst.“ Rafael ist Forscherin beim Center für Monitoring, Analyse und Strategie (Cemas), sie untersucht speziell Hassrede in sozialen Netzwerken und Rechtsextremismus. „Um die Angst anzusprechen, nutzt die AfD viele Adjektive und Dramatisierungen. Da ist es nicht Migration, sondern Massenmigration, und die ist dann auch noch ungeregelt.“
Eine bemerkenswerte Anzeige hat der schleswig-holsteinische AfD-Mann Gereon Bollmann geschaltet: „Wir leiden immer mehr unter der zunehmenden Massenmigration, hinter der sich der geplante Austausch unseres Volkes verbirgt“, schreibt der Bundestagsabgeordnete. „Heimlich still und leise läuft das internationale Programm der Globalisten ohne Unterbrechung weiter. Dies ist eben keine Verschwörungstheorie, sondern in den entsprechenden Planungen unserer Gegner fest verankert.“
Bevölkerungsaustausch? Globalisten? Keine Verschwörungstheorie? Joe Düker, Forscher beim Cemas, ordnet die Anzeige ein: „Globalisten ist ein gängiger Proxy für Juden, also ein Tarnbegriff, die eigentliche Bedeutung ist für die Zielgruppe klar.“ Ein vermeintlicher „Bevölkerungsaustausch“ sei laut Düker eine gängige Erzählung von Rechtsextremen, die es zum Ziel erklärt, weiße Bevölkerungsgruppen mit Migranten zu durchmischen oder gar abzuschaffen. „Hier wird wieder ein konkretes Bedrohungsszenario aufgemacht – wir gegen die anderen“, bewertet Cemas-Forscherin Rafael die Anzeige. Bei AfD-Politiker Bollmann steht diese vermeintliche Bedrohung gut eingebettet zwischen Trauer nach dem Anschlag in Magdeburg und Wünschen für besinnliche Weihnachten.
Wahlkampfthemen: Verbrenner-Aus und Deindustrialisierung
Migration ist nicht das einzige drängende Thema im Wahlkampf, wie die CORRECTIV-Auswertung zeigt. Umkämpft ist auch die deutsche Wirtschaft – und damit auch die deutsche Klimapolitik.
Vor allem die AfD-Accounts und rechte Akteure nutzen Begriffe wie Klimawahnsinn, Klimahysterie oder Klimasozialismus und bagatellisieren damit den menschengemachten Klimawandel und ziehen Fakten ins Lächerliche. Ein weiteres Narrativ, das die AfD bedient, ist die Deindustrialisierung Deutschlands. Schuld an dem vermeintlichen Niedergang der deutschen Wirtschaft ist mal die Regierung der Ampel und deren Politik, mal sind es die Pläne der Union und deren Kanzlerkandidaten Friedrich Merz.
Auswertung von Werbeanzeigen auf Facebook und Instagram: Unsere Methode
Die Meta Ad Library bietet Informationen über Werbeanzeigen an, die auf Meta-Plattformen, einschließlich Facebook und Instagram, veröffentlicht wurden. Zwischen dem 12. November 2024, dem Tag, an dem die Neuwahlen angekündigt wurden, und dem 12. Januar 2025 haben wir automatisiert Anzeigen gesucht, in denen Begriffe vorkommen, die oft im Zusammenhang mit Desinformation und Hatespeech verwendet werden oder auf strittige Wahlkampf-Themen hindeuten. Informationen zu der Seite, die die Anzeige geschaltet hat, sowie Ausgaben, Reichweite und Inhalte, haben wir gespeichert.
Insgesamt haben wir nach 86 Begriffen gesucht, die in die folgenden Kategorien fallen: Migration/Islamophobie, Antigender/Antifeminismus, Antisemitismus und Klimawandel-Leugnung. Die Kategorisierung und die Begriffe basieren auf unseren eigenen Recherchen sowie auf den folgenden Studien:
- RPC-Lex: A dictionary to measure German right-wing populist conspiracy discourse online (gemeinsame Studie der Universität Bremen und der Universität Basel)
- Klimadiktatur? Rechte Ideologie und Verschwörungsnarrative zur Klimapolitik in den sozialen Netzwerken (Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft)
In einem weiteren Schritt haben wir Facebook- und Instagram-Seiten verifiziert, die politischen Parteien oder Politikern zugeordnet werden können. Werbeanzeigen, die nicht irreführend sind oder nicht in den Bereich von Desinformation oder Hatespeech fallen, haben wir in der Auswertung nicht berücksichtigt.
Deindustrialisierung sei ein „politischer Kampfbegriff", sagt Axel Salheiser, wissenschaftlicher Leiter des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft (IDZ), gegenüber CORRECTIV. Es gehe darum, negative Emotionen auszulösen. „Gerade in Regionen und Schichten, die traditionellen Wertschöpfungsprozessen verbunden sind.“
Dazu passt, dass CDU, FDP, Freie Wähler und BSW ein ähnliches Narrativ spinnen: Dabei geht es um das Verbrenner-Aus, mit dem Deutschland vor dem Ruin stehe. Eine Behauptung, der Martin Gornig, Forschungsdirektor am DIW widerspricht: „Die Monokausalität Verbrenner-Aus gleich Verfall der gesamten Autoindustrie ist nicht korrekt.“
„Auch hier geht es um die Setzung von starken, emotionalen Bildern”, sagt Axel Salheiser vom IDZ. Fakten würden bewusst ausgeklammert. „Hier schwingt mit, dass einer traditionsreichen Technologie der Garaus gemacht wird. Das ist auch als Mobilisierung gegen Klimaschutz zu verstehen.“
Das Problem dieser düsteren Narrative: Sie bleiben hängen. Das bestätigt auch Salheiser: Viele Menschen seien ambivalent eingestellt, wenn es um Klimaschutz gehe. „Gerade wenn Wohlstand vermeintlich gefährdet ist, machen Leute dicht“.
Plattformen wie Meta tragen die Verantwortung
Doch wie umgehen mit irreführenden Aussagen, Hass gegen Minderheiten und Desinformation?
Simone Rafael vom Cemas sieht vor allem die Plattformen in der Pflicht: „Das ist eine Frage des Willens, nicht der Technik.“ Es stelle sich die Frage von Regulierung. „Einige Plattformen benehmen sich, als wären sie ein rechtsfreier Raum.“ Tatsächlich gelöscht werden muss nämlich nur, wenn ein Strafbestand wie Verleumdung oder Beleidigung vorliegt. Desinformation hat Meta als Meinungsäußerung erlaubt, sie werden aber derzeit noch mit Labeln von Faktencheckern versehen – wie dem Faktencheck-Team von CORRECTIV.
Oft sind in den Anzeigen die Grenzen zwischen Desinformation, Hassrede und irreführendem Kontext fließend. Laut Cemas-Forscherin Rafael können Politiker und Parteien daraus auch Kapital schlagen: „Eine Partei, die gern wahrheitsgetreu und faktenbasiert mit ihren Wähler:innen kommuniziert, der wird ein falscher Kontext oder eine Fehlinformation peinlich sein.“
CORRECTIV wollte von Meta wissen, wie der Konzern hinter Facebook und Instagram mit Hassrede und falschen Informationen umgeht. Antworten auf konkrete Fragen gab Meta nicht, verwies aber auf eigene Themenseiten, etwa zur Bundestagswahl 2025 und die öffentlich zugängliche Anzeigenbibliothek, in der auch Laufzeit oder Kosten zu sehen sind. Zur Wahl setze Meta ein zusätzliches Kontrollgremium ein.
Meta beteuert weiter, dass Anzeigen nicht zugelassen würden, wenn der Inhalt durch Faktenchecker widerlegt sei. Das mag stimmen, doch noch immer erreichen Hass und Falschinformationen potenziell Hunderttausende bei Facebook und Instagram.
Mitarbeit: Sarah Langner
Redaktion: Till Eckert, Alice Echtermann, Justus von Daniels
Faktencheck: Till Eckert
Foto: Ivo Mayr
Kommunikation: Esther Ecke, Luise Lange-Letellier