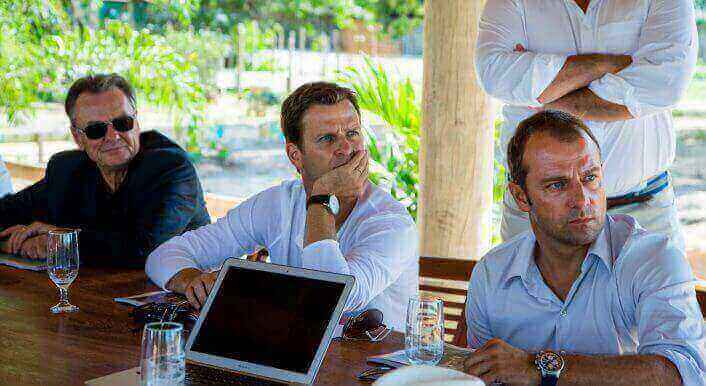Kostenexplosion vor Fußball-EM: Deutschland muss immer mehr zahlen
Die EM 2024 kostet die zehn Spielstätten mindestens 66 Millionen Euro mehr als geplant. Die Zusatzkosten tragen die Steuerzahler. Ein Grund sind Knebelverträge mit der Uefa – die gleichzeitig von Rekordeinnahmen spricht.

Vor dem Brandenburger Tor steht das größte Fußballtor der Welt. Zumindest bis Mitte Juli, bis zum Finalspiel der Fußball-Europameisterschaft der Männer, die kommende Woche beginnt. Vor dem Tor ist ein Rasen ausgerollt, der so groß ist wie zehn Fußballfelder. Mehr als 50.000 Menschen sollen hier gleichzeitig die EM-Spiele verfolgen können. Insgesamt rechnet Berlin mit 2,5 Millionen Fußballfans aus aller Welt und mit einem enormen wirtschaftlichen Schub, schließlich sei mit einer „Gesamtwertschöpfung von mindestens 600 Millionen Euro zu rechnen“, schreibt die Senatsverwaltung auf CORRECTIV-Anfrage.
Viele Fans reisen an, spektakuläre Bilder, hunderte Millionen Euro kommen in die Kasse. Ist die Rechnung wirklich so einfach?
Nein, denn erst einmal muss Berlin zahlen. Allein für die beiden Fanmeilen am Brandenburger Tor und vor dem Reichstag hat die Stadtverwaltung 24 Millionen Euro ausgegeben. Ein Bruchteil von dem, was die Europameisterschaft die deutschen Steuerzahler insgesamt kostet. Denn einen Großteil der Kosten für die EM tragen neben Bund und Ländern auch die zehn Städte, welche die Spiele ausrichten. Wie teuer das wird, war 2017 während des Bewerbungsprozesses offenbar noch nicht abzusehen. Das gilt nicht nur für Berlin, sondern auch die anderen neun Spielorte der Fußball-EM.
Nun wird klar: Die zehn EM-Spielorte zahlen mindestens 66 Millionen Euro mehr als ursprünglich kalkuliert. Das zeigen Recherchen von CORRECTIV.Lokal zusammen mit FragDenStaat. Allein in Frankfurt und Berlin haben sich die Kosten für die Städte seit 2017 fast verdoppelt. Die aktuellen Ausgaben – allein für die Spielorte – belaufen sich auf 295 Millionen Euro.
Grundlage sind Auskunftsanfragen an die Städte. Zudem haben die Medien Unterlagen und Verträge zwischen den Städten mit dem europäischen Fußballverband Uefa und dem DFB eingesehen. Dadurch zeigt sich neben den enormen Ausgaben zu Lasten der Steuerzahler: Die Uefa verdient prächtig, spricht sogar von einem Rekordgewinn von 1,7 Milliarden Euro.
Trotz gestiegener Millionen-Ausgaben: Uefa spricht von „Budgets mit Augenmaß“
Auf die hohen Kosten und das damit verbundene Risiko der Städte angesprochen, schreibt die Uefa an CORRECTIV.Lokal und FragDenStaat: „Im bisherigen Verlauf der Planungen ist festzuhalten, dass die Host Cities Budgets mit Augenmaß aufgestellt haben und diese eigenverantwortlich verabschiedet wurden.“ Der europäische Dachverband sieht kein finanzielles Risiko für die EM-Ausrichter, schließlich seien alle Investitionen planbar und die Städte hätten freie Hand darüber, wie sie die Plattform der Uefa Euro nutzen.
Dieses „Augenmaß“ bedeutet im Fall von Berlin zusätzliche Ausgaben in Höhe von 40 Millionen Euro, mit denen im Bewerbungsprozess noch nicht gerechnet wurde. Die Stadt erklärt, dass zu diesem Zeitpunkt „die Auswirkungen der Corona-Pandemie und der Energie- bzw. Inflationsbedingten Preissteigerungen“ noch nicht absehbar waren.
Die Stadt Köln, die laut eigenem Plan knapp sechs Millionen Euro mehr als 2017 bezahlt, erklärt auf CORRECTIV-Anfrage, dass nun einmal bei einem Projekt der Größenordnung einer Fußball-Europameisterschaft im Laufe der Zeit „zwangsläufig erhebliche Kostensteigerungen“ entstünden. So hätten sich insbesondere für die Sicherheit höhere Anforderungen ergeben.
In gleich drei Städten bleibt unklar, wie sich die Kosten seit dem Bewerbungsverfahren als EM-Stadt verändert haben: Hamburg und Düsseldorf nannten keine Zahlen. In Stuttgart soll es keine Kalkulation gegeben haben. Es konnte „naturgemäß keine Gesamtkalkulation erstellt werden“, schreibt uns ein Sprecher der Stadt. Was in der Praxis bedeutete: Über die vergangenen Jahre wurden immer mehr Ausgaben für den jeweiligen Haushalt angemeldet. Die Kosten stiegen sukzessiv.
Die Städte zahlen, die Uefa kassiert
Die enormen Kosten sind vor allem auf die umfangreichen Verpflichtungen seitens der Städte zurückzuführen. Für die Organisation der EM wurde die EURO 2024 GmbH gegründet, ein Gemeinschaftsunternehmen der Uefa und des DFB. Die Städte haben mit beiden Parteien verschiedene Verträge unterzeichnet.
Gemeinsam mit FragDenStaat hat CORRECTIV.Lokal die entsprechenden Verträge angefordert. Exemplarisch liegen diese von Hamburg und Dortmund vor und können bei FragDenStaat eingesehen werden. Die restlichen Städte gaben an, dass die Verträge weitgehend identisch sind. Wer die Details verstehen will, muss einige Dokumente wälzen. Sie bestehen aus umfassenden Garantie- und Verpflichtungserklärungen aus dem Bewerbungsprozess, sowie Verträgen und Zusatzvereinbarungen.
Was darin sichtbar wird: Die Städte – und damit letztlich die Steuerzahlenden – tragen die Kosten und Risiken der Veranstaltung, während die Uefa Rekordgewinne erzielt. Ein großer Kostenpunkt, zu dem sich die Städte in den Verträgen verpflichten, sind die oben beschriebenen Fanmeilen („Fan Zones“). In Berlin und München machen diese rund ein Viertel, in Köln sogar fast ein Drittel der Ausgaben aus.
Prominente Botschafter werben für die EM im eigenen Land
Die Städte verpflichten sich zu weiteren Ausgaben. Sie müssen eine „interne Organisationsstruktur“ schaffen, um Uefa und DFB bei der Vorbereitung und Organisation der EM zu unterstützen. Allein das kostet Hamburg mehr als eine Million Euro. Zudem verpflichten sich die Städte, „umfangreich an prominenten Plätzen“ für die EM zu werben und jeweils Hunderte Volunteers zu beschäftigen.
In jeder Stadt müssen offizielle EM-Botschafter ernannt werden. Der Fußballer Kevin-Prince Boateng wirbt in Berlin für das Turnier, die Fußballerin Anja Mittag in Leipzig. Beide ehrenamtlich. In anderen Städten wird „Aufwandsentschädigung“ für die Promis in nicht genannter Höhe benannt. So entstehen weitere Kosten für den Schiedsrichter Felix Brych und die Eishockeyspielerin Kathrin Lehmann in München, in Stuttgart werden der ehemalige Fußball-Nationalspieler Cacau und der Paralympics-Goldmedaillengewinner Niko Kappel bezahlt.

Wie umfangreich die Verträge sind, haben auch schon Spiegel und ZDF recherchiert. Ein Risiko, das nicht jede Stadt tragen wollte. So hat Kaiserslautern seine Bewerbung wegen der drohenden hohen Kosten zurückgezogen und die Stadt Bremen, die nicht allen Auflagen der Uefa ausnahmslos zustimmte, scheiterte laut Spiegel offenbar deshalb im Bewerbungsverfahren.
Offene Fragen zum Effekt einer EM in Deutschland
Inwieweit lassen sich das Turnier und die damit verbundenen Ausgaben refinanzieren? Das hat CORRECTIV.Lokal die zehn Austragungsstätten gefragt. Die Antworten fielen hier sehr unterschiedlich aus. Stuttgart (zur Erinnerung: Die Stadt ohne Kalkulation) erklärt, dass die Stadt auch hierzu keine Aussagen treffen möchte. Diese wären rein „spekulativ“, weil die „Rentabilität“ von verschiedenen Faktoren abhängen würde.
Die Stadt Köln erklärt, dass die Austragung der EM zwar „ökonomische Vorteile mit sich bringt“, betont aber auch, dass sich der Wert von Sportgroßveranstaltungen nicht monetarisieren lässt. Die Kölner und Kölnerinnen seien stolz darauf, Gastgeber zu sein und solche Veranstaltungen würden nicht zuletzt die Lebensqualität in der Stadt verbessern.
Andere Städte werden etwas konkreter. Berlin und München rechnen mit Einnahmen im dreistelligen Millionenbereich. Wie sich diese im Detail zusammensetzen, lassen die Städte aber offen. Leipzig legt CORRECTIV einen Ausschnitt einer „Potenzialanalyse“ vor, die vom Tourismus-Beratungsunternehmen DWIF durchgeführt wurde. Die Stadt rechnet mit einem Bruttoumsatz von fast 60 Millionen Euro, der sich zusammensetzt aus Ausgaben von Übernachtungs- und Tagesgästen und der lokalen Bevölkerung.
Berechnungen zum EM-Gewinn sind nicht belastbar
Glaubwürdig seien diese Berechnungen laut Wolfgang Maennig, Professor für Wirtschaftspolitik an der Uni Hamburg, nicht: „Es gibt keine nachweisbaren Effekte von Sportgroßveranstaltungen auf Beschäftigung, Einkommen, Steuermehreinnahmen und Übernachtungszahlen.“ Denn bei diesen Berechnungen würden verschiedene Effekte ignoriert oder fälschlicherweise in die Kalkulationen miteinbezogen.
„Viele der Städte sind über die Sommermonate sowieso gut besucht“, sagt Maennig. Zusätzliche Einnahmen in der Hotellerie entstehen also kaum. Die Ausgaben der Übernachtungs- und Tagesgäste seien zudem oft zu hoch angesetzt und auch die lokale Bevölkerung dürfe nicht wie im Fall der Stadt Leipzig in die Berechnungen miteinbezogen werden. „Der Leipziger gibt Geld aus, unabhängig von der Europameisterschaft“, erklärt Maennig. Diese Ausgaben steigen auch nicht durch Veranstaltungen wie die EM, schließlich stehe „jedem nur ein bestimmtes monatliches Nettoeinkommen zur Verfügung.“ Ist das aufgebraucht, muss es zu einem anderen Zeitpunkt auch wieder eingespart werden.
All das macht die EM für Maennig jedoch nicht weniger lohnend. Profitieren würden die Städte vor allem vom Erlebnisnutzen der lokalen Bevölkerung und von der internationalen Aufmerksamkeit. „Wir sprechen hier von kurzfristigen Effekten, die aber nicht zu unterschätzen sind“, sagt Maennig. Zweistellige Millionenbeträge an Ausgaben seien damit durchaus zu rechtfertigen, gerade weil anders als bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 nicht mehrere Stadien neu gebaut werden mussten.
Monopol-Stellung der Uefa
Dass die Uefa trotz Rekordgewinnen während des Turniers kaum Risiken tragen muss, hält Maennig aber nicht für gerechtfertigt. Sie nutze ihre „Monopol-Stellung“ und vergebe die Turniere quasi meistbietend im Auktionsverfahren. Dafür macht er allerdings nicht Bund und Städte verantwortlich, sondern vor allem die „einseitigen Interessen der Zuschauer“.
„Würden wir uns für alle Sportarten gleichermaßen interessieren, wäre das Monopol von Uefa und anderen Verbänden wie dem IOC gebrochen“, erklärt Maennig. Schließlich würden für die Fußball-Europameisterschaft Millionen von Menschen einschalten, deshalb seien die Städte auch bereit, diese hohen Summen auszugeben.
Dass das Interesse an Turnieren wie diesen kurz- oder mittelfristig abflacht, davon ist vorerst nicht auszugehen. Solange das so bleibt, verdient die Uefa fleißig weiter. Es wäre eine Überraschung, wenn es bei den knapp 300 Millionen Euro bleibt, die jetzt schon für die Allgemeinheit entstanden sind.
--
Sie haben Hinweise zur EM in Deutschland? Dann schreiben Sie uns an lokal@correctiv.org oder für sensible Informationen eine verschlüsselte Nachricht über unseren anonymen Briefkasten. CORRECTIV.Lokal arbeitet bei dieser Recherche mit Lokal- und Regionalmedien in allen Bundesländern zusammen, die in der Lage sind, auch Hinweise auf einzelne lokale Missstände zu verfolgen.
Redaktion: Stella Hesch, Jonathan Sachse, Pia Siber, Tim Wurster
Kommunikation: Valentin Zick, Esther Ecke