Warum es keine Option ist, auf Sonnencreme zu verzichten – und welche Unterschiede es gibt
Influencer Fabian Kowallik behauptet, Sonnencreme mit dem Inhaltsstoff Octocrylen sei krebserregend. Das stimmt so nicht – empfohlen ist bisher nur, dass solche Cremes nach Ablauf des Verfallsdatums entsorgt werden sollten. Zudem gibt es Alternativen.

Ob am Strand oder im Park: Brennt die Sonne vom Himmel, tragen viele Menschen Sonnencreme auf. So weit, so normal. Doch auf Telegram, Youtube und Instagram sind einige der Meinung, das sei der falsche Weg. So behauptet der Influencer Fabian Kowallik, der sich auf Instagram „Gesundheitsguru“ nennt: „Sonnencreme macht Krebs.“ Das liege am Inhaltsstoff Octocrylen. Der Stoff sei krebserregend und „besonders gefährlich“, wenn Sonnenlicht auf die Haut treffe. Darüber hinaus blockiere Sonnencreme auch positive Effekte von Sonnenstrahlung, etwa die Bildung von Vitamin D im Körper. Kowalliks Aussagen erreichten in Sozialen Netzwerken hunderttausende Nutzerinnen und Nutzer, er trat damit auch in einigen Podcasts auf.
Pauschale und irreführende Behauptungen über Sonnencreme verbreiten sich seit Jahren in Sozialen Netzwerken. Dabei sollte laut Medizinerinnen und Medizinern im Sommer niemand auf Sonnenschutz verzichten, dazu gehört neben langer Kleidung, Hut und Sonnenbrille auch Sonnencreme. CORRECTIV.Faktencheck hat recherchiert, worauf es ankommt.
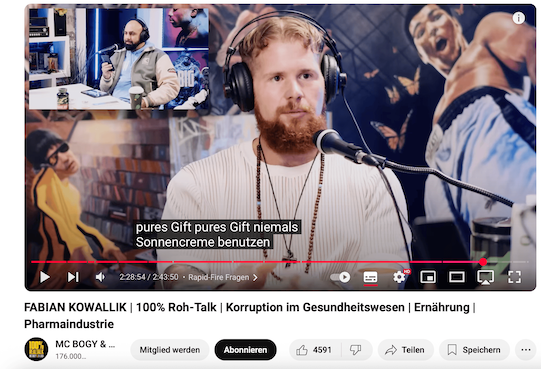
Hier direkt zum Thema springen:
UV-Filter in Sonnencreme: Keine Hinweise, dass Octocrylen krebserregend ist
Schon im Jahr 2019 schrieb die Krebsliga Schweiz, dass nach aktuellem Wissensstand der Nutzen von Sonnenschutzmitteln größer ist als mögliche Risiken. Laut Bundesamt für Verbraucherschutz werden handelsübliche Produkte „von den zuständigen Überwachungsbehörden regelmäßig überprüft“.
Auf dem Markt sind Produkte mit unterschiedlichen Stoffen, die UV-Strahlung der Sonne absorbieren. Die meisten enthalten organische (chemische) UV-Filter wie Octocrylen oder Benzophenone-3. Es gibt aber auch Cremes mit mineralischen (physikalischen) UV-Filtern wie Zinkoxid oder Titandioxid.
Fabian Kowallik unterstellt in Sozialen Netzwerken vor allem, der chemische UV-Filter Octocrylen sei „nachweislich krebserregend“. Der Europäischen Chemikalienagentur lagen jedoch bis 12. August 2025 keine Daten zur Karzinogenität, also zur krebserregenden Wirkung, vor.
Laut dem Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) wird der UV-Filter „inzwischen nur noch in wenigen Sonnenschutzmitteln eingesetzt“. Und wenn doch, dann gilt dafür in der EU ein Grenzwert von neun Prozent in Spraydosen und zehn Prozent in Kosmetikprodukten. Diese Octocrylen-Konzentration ist laut dem Wissenschaftlichen Ausschuss für Verbrauchersicherheit (SCCS) der EU-Kommission „sicher für die individuelle Anwendung“.

Octocrylen steht in der Kritik, weil es sich zu Benzophenon zersetzen kann
Dass der UV-Filter in der Kritik steht, liegt unter anderem an einem anderen Stoff namens Benzophenon. Benzophenon ist ein sogenanntes Zerfallsprodukt, das durch zu lange Lagerung aus den chemischen UV-Filtern Octocrylen oder Benzophenon-3 entstehen kann.
Kowallik verweist auf Nachfrage auf eine Untersuchung von Öko-Test aus dem Jahr 2021, bei der Benzophenon in sieben Cremes mit Octocrylen gefunden worden sei – in sechs Fällen in sehr geringer Konzentration. „Es stimmt, dass das nicht unbedingt krebserregend sein muss, aber es ist wahrscheinlich“, schreibt uns Kowallik per E-Mail. Was hat es damit auf sich?
Seit Dezember 2023 ist Benzophenon selbst per EU-Verordnung in kosmetischen Produkten, die auf dem europäischen Markt erhältlich sind, verboten. Denn die Internationale Agentur für Krebsforschung, die Teil der Weltgesundheitsorganisation ist, stuft Benzophenon als „möglicherweise krebserregend“ ein. Auch die Europäische Chemikalienagentur schreibt, Benzophenon ist „vermutlich krebserregend“. Diese Einstufung bedeutet, dass es Hinweise auf eine krebserregende Wirkung in Tierversuchen gibt, aber nur begrenzte bis unzureichende Hinweise bei Menschen (Stand: 31. Juli 2025).
Auch Carola Berking, Direktorin der Hautklinik am Uniklinikum Erlangen, sagt im Gespräch mit CORRECTIV.Faktencheck: Es gebe zwar Berichte über die „krebsfördernde Eigenschaften“ von Benzophenon, das sei aber nur in Laborexperimenten und nicht bei Menschen gezeigt worden.
Darum sind UV-Filter wie Octocrylen weiterhin auf dem europäischen Markt zugelassen, allerdings nur in geringen Mengen. Die Grenzwerte werden vom SCCS der EU festgelegt und angepasst.
Risiko durch Benzophenon vernachlässigbar – alte Sonnencreme vorsorglich nicht nutzen
Eckhard Breitbart, Dermatologe und Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Prävention (ADP), betont: Das Risiko durch Benzophenon sei vernachlässigbar. „Sonnenschutzmittel werden nach europäischen Kosmetik-Regularien geführt. Dafür gibt es internationale Standardisierungsvorschriften, die wir auch alle genauestens kennen. Kein Hersteller kann da irgendwas reinpacken, was in irgendeiner Form krebserregend sein könnte“, so Breitbart.
Zudem kann laut Bundesinstitut für Risikobewertung die Entstehung von Benzophenon durch die Zusammensetzung des Produkts so begrenzt werden, dass keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen für Verbraucherinnen und Verbraucher zu erwarten sind.
Die Verbraucherzentrale NRW und die Deutsche Gesellschaft für Toxikologie empfehlen: Wer auf Nummer sicher gehen will, solle vorsorglich keine alte Sonnencreme mit Octocrylen nutzen. Worauf man beim Kauf von Sonnencreme sonst noch achten sollte, steht auf der Webseite der Verbraucherzentrale.
Ich will es genau wissen: Woher kommt der Mythos von „gesunder Bräune“?
Eckhard Breitbart, Dermatologe und Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Prävention erklärt: „[Bräunung] ist nur der Versuch des menschlichen Körpers, mit diesem bisschen Pigment […] den weiteren Schaden, der durch die weitere UV-Strahlung kommt, zu reduzieren. Mehr nicht.“ Eine „gesunde Bräune“ gebe es nicht.
Durch die Entwicklung der ersten kommerziellen Sonnencreme um 1930 – damals als Bräunungscreme vermarktet – sollte eine Bräunung ermöglicht und der schmerzhafte Sonnenbrand verhindert werden, so Breitbart. Erst in den 1960ern erkannte die Forschung, dass UV-Strahlung DNA schädigt. Diese Information brauchte noch bis in die 1980er Jahre, um in der Gesellschaft anzukommen.
Das Ziel von Sonnenschutzmitteln sei heute immer noch das gleiche – Bräunung ohne Sonnenbrand – die Vermarktung sei aber angepasst worden, erklärt Experte Breitbart weiter. Sonnencreme könne ein falsches Sicherheitsgefühl vermitteln. Auch wenn sie unter perfekten Bedingungen aufgetragen sei, könne Sonnencreme die UV-Strahlen nämlich nicht gänzlich von der Haut fernhalten. Wer sich eingecremt in Sicherheit wiegt, setzt sich der Sonne dadurch nachgewiesenermaßen länger aus. Das konnte auch in mehreren Studien gezeigt werden.
Selbst gemischte Alternativen zu Sonnencreme sind mit Vorsicht zu betrachten
Kowallik behauptet in Interviews und auf seinen eigenen Kanälen mehrfach, dass er auf Sonnencreme verzichte oder man sie selbst mischen könne. Wenn er sich lange in der Sonne aufhalten müsse, dann nutze er als Alternative Kokosöl mit Zinkoxid, sagte er zum Beispiel im Podcast „ungeskriptet“ von Benjamin Berndt.
Eine Mitarbeiterin aus dem Podcast-Team von Berndt antwortet auf Anfrage: „Die Aussagen von Herrn Kowallik zur Sonnencreme spiegeln seine persönliche Meinung wider“.
Auf Anfrage von CORRECTIV.Faktencheck schreibt Fabian Kowallik: „Sonnencreme ist besser als einen Sonnenbrand zu bekommen. Aber noch besser ist es, einen vernünftigen Umgang mit der Sonne zu lernen, also maximal 10-30 Minuten Mittagssonne zu starten und die Sonnenzeit außerhalb zu nutzen. So spart der Konsument, umgeht potenzielle Risiken der Sonnencremes und hat das Beste aus beiden Welten.“
Fachleute sehen das anders: Zinkoxid wird zwar als mineralischer Filter in Sonnencremes eingesetzt, doch solche Cremes selbst zu mischen birgt Risiken. Laut Bundesinstitut für Risikobewertung sind zwar etwa bei Nano-Zinkoxid Konzentrationen bis zu 25 Prozent unbedenklich. Kokosöl bietet dagegen keinen starken Sonnenschutz: So zeigte eine Überblicksstudie im Jahr 2022, dass Kokosöl alleine lediglich einen Lichtschutzfaktor von 7 habe. Fachleute raten beim Sonnenbad eher zu Sonnencremes mit einem Lichtschutzfaktor von 30 oder 50.
In Hinblick auf Kowalliks Empfehlung hält Expertin Berking mehrere Faktoren für problematisch: das richtige Mischverhältnis sowie die Haltbarkeit und die toxikologischen Daten. Für Berking blieben viele Fragen offen: Wie die Inhaltsstoffe richtig vermischt würden, wie hoch dann der Lichtschutzfaktor wäre und welche Bereiche der UV-Strahlung abgedeckt würden. Produkte müssten verschiedene Tests durchlaufen, um zu gewährleisten, dass sie haltbar, stabil und steril seien. Dafür seien Laien nicht ausgebildet, so Berking.
Kowallik ging in seiner Antwort an CORRECTIV.Faktencheck nicht auf den Vorwurf ein, er würde problematische Empfehlungen zu „Sonnenschutz“ mit einem Gemisch aus Zinkoxid und Kokosöl teilen. Er schrieb, Zinkoxid sei ein offiziell zugelassener und risikofreier Sonnenschutz und man könne Sonnencremes mit Zinkoxid statt chemischem Schutz erwerben. Dann wiederholt er: „Immer noch ist es besser, einen vernünftigen Umgang mit der Sonne zu erlernen.“
Dass es mehr als Sonnencreme braucht, um sich vor schädlicher UV-Strahlung zu schützen, ist korrekt. Wie das am besten geht, zeigt dieses Video der Krebsliga in der Schweiz:
Sonnencreme blockiert die Aufnahme von Vitamin D unter normalen Umständen nicht
Kowallik stellt jedoch nicht nur die Inhaltsstoffe von Sonnencreme infrage, sondern behauptet auch, sie würde die Bildung von Vitamin D durch den Körper blockieren. Auf die Anfrage, ob er seine Behauptung korrigieren wolle, geht er nicht ein. Neben ihm verbreiten auch andere diese Behauptung in Beiträgen in Sozialen Netzwerken und in Blogs.
Mehrere Studien zeigen, dass die Verwendung von Sonnencreme die körpereigene Produktion von Vitamin D unter normalen Umständen nicht einschränkt. Der Körper stellt das benötigte Vitamin D größtenteils mithilfe von UVB-Strahlen selber her. Das bestätigt uns gegenüber Dermatologe Breitbart und sagt dazu: „Sie brauchen dafür die ganz kurzwellige UVB-Strahlung, die ist auch krebserregend, keine Frage“.
Um die Vitamin-D-Speicher zu füllen, reiche aber etwa die Hälfte der Zeit in der Sonne aus, bis ein Sonnenbrand entstehen würde, so Breitbart. Je nach Hauttyp sei die Zeitspanne dafür unterschiedlich. Bei heller Haut reiche eine geringe Zeit in der Sonne, beispielsweise wenn man zweimal in der Woche zum Einkaufen rausgehe. Das entspreche etwa zehn bis fünfzehn Minuten pro Woche. So lautet auch die Empfehlung des Bundesamtes für Strahlenschutz, die von zahlreichen Fachverbänden erarbeitet wurde.
Carola Berking stimmt zu, dass oft schon eine geringe Menge UVB-Strahlung ausreiche, um genug Vitamin D herzustellen, merkt aber an, dass wer sich extrem schützt, „also immer im Schatten ist, immer Sonnenschutz-Creme trägt und gar keine Sonne auf seine Haut lässt“, der könne tatsächlich in einen Vitamin-D-Mangel rutschen.

Sonne lässt Neurodermitis und Asthma nicht komplett verschwinden
Im Podcast von „Nizar & Shayan – Die Deutschen“ sagte Kowallik, dass die Sonne Erkrankungen wie Ekzeme, Neurodermitis und Asthma „weg“ gehen ließe. Er fügt später hinzu: „Wenn du jetzt mit Sonnencreme dich einschmierst, dann kommen diese Effekte halt nicht.“ Auf Anfrage schreibt er, es handle sich nicht um eine Empfehlung, sondern um seine eigene Erfahrung.
Es stimmt, dass die Bestrahlung entzündeter Zellen mit UV-Strahlen helfen kann, den Juckreiz bei Ekzemen und Neurodermitis zu verringern. Das geht aus der Medizinischen Leitlinie zu „Atopischer Dermatitis“ und einer Pressemitteilung der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft (DDG) hervor. Das bedeutet aber nicht, dass diese Krankheiten vollständig verschwinden. Neurodermitis – auch „atopisches Ekzem“ genannt – ist eine chronische Krankheit, die nicht heilbar ist.
Wichtig sei, wie Dermatologe Breitbart erklärt, sich über die Nebenwirkungen der Bestrahlung mit UVB im Klaren zu sein. Denn die Strahlung unterscheide nicht zwischen normalen und entzündeten Zellen. Es bestehe also das Risiko wegen der Strahlung, Jahrzehnte später Hautkrebs zu bekommen. Eine solche Behandlung gehöre in ärztliche Hände, so Breitbart. Das bestätigen auch Fachleute des Universitäts-Allergiecentrums in Dresden und raten von „unkontrolliertem Sonnenbaden“ ab.
Und inwiefern hilft die Sonneneinstrahlung gegen Asthma? Sarah-Christin Mavi ist Oberärztin an der Asklepios Lungenklinik Gauting. Sie erklärt, Atemnot, Husten oder Druckgefühl auf der Brust seien typische Symptome von Asthma, die „durch eine chronische Entzündung und Überempfindlichkeit der Bronchien“ entstünden. Sonne könne zwar das allgemeine Wohlbefinden verbessern, jedoch die Symptome weder lindern noch heilen.
Zu der Frage, ob Vitamin D nützlich für die Behandlung von Asthma ist, kommt eine Überblicksstudie zu dem Schluss, dass es dafür mehrdeutige und widersprüchliche Belege gibt.
Auch mit Sonnenschutz sollten sich Menschen der Sonne nicht zu lange aussetzen
Andere Aussagen von Kowalik sind hingegen nicht umstritten. Zum Beispiel rät er, sich durch Kleidung vor der Sonne zu schützen. Diese Empfehlung teilen auch das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) und die Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften in ihrer Gesundheitsleitlinie „Prävention von Hautkrebs“. Der Krebsinformationsdienst schreibt: „Den besten Schutz vor UV-Strahlung bietet Kleidung, die kein Licht durchlässt. Tragen Sie außerdem eine Kopfbedeckung, die Ohren und Nacken schützt.“

Ultraviolette (UV-)Strahlung ist laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) ein Risikofaktor für Hautkrebserkrankungen. Wie Dermatologe Eckard Breitbart erklärt, beschädigen UV-Strahlen ohne Zeitverzögerung DNA und Hautzellen. Dieses beschädigte Zellmaterial bliebe dann zurück. Daraus könne auch Jahrzehnte später Hautkrebs entstehen.
Auch Sonnencreme könne davor nicht gänzlich schützen. „Die Anwendung ist das Problem“, so Breitbart. Selbst, wenn Sonnencreme korrekt aufgetragen würde – also zwei Milligramm pro Quadratzentimeter Körperoberfläche – könnten nicht alle UV-Strahlen abgehalten werden, sagt der Experte. Für den richtigen Sonnenschutz empfiehlt er einen Blick auf den UV-Index für den Tag. Wenn der Tageshöchstwert bei 7 liegt, „brauche ich einen Hut mit breiter Krempe, […] T-Shirt, halblange Hose und Schuhe, die den Fußrücken bedecken“. Der Rest des Körpers solle dann mit Sonnenschutzmittel, beispielsweise mit Lichtschutzfaktor 30, das „sowohl im UVB als auch im UVA-Bereich schützen soll“ eingecremt werden. Außerdem solle man vermeiden, mittags rauszugehen und Aktivitäten in den Vormittag und Nachmittag legen, empfiehlt Breitbart. Dazu rät auch das Bundesamt für Strahlenschutz.
Kowallik wiederholt seine Aussagen in mehreren Podcasts, etwa „100% Realtalk – MC Bogy & B-Lash“ und „Nizar & Shayan – Die Deutschen“. Deren Autoren äußerten sich bis Redaktionsschluss nicht zu unseren Fragen.
Redigatur: Kimberly Nicolaus, Sarah Thust
Die wichtigsten, öffentlichen Quellen für diesen Faktencheck:
- Opinion on Octocrylene, Scientific Committee on Consumer Safety (SCCS), 31. März 2021: Link (Englisch, archiviert)
- Octocrylene, Europäische Chemikalienagentur (ECHA): Link (Englisch, archiviert)
- List of classifications, Internationale Agentur für Krebsforschung (IAER): Link (Englisch)
- Sonnencreme und Co.: Gibt es gesundheitliche Risiken?, Bundesamt für Risikobewertung und Bundesamt für Strahlenschutz, 10. Juli 2024: Link (archiviert)
- Benzophenone, ECHA, 31. Juli 2025: Link (Englisch, archiviert)
- Opinion on benzophenone – 3, Scientific Committee on Consumer Safety, 31. März 2021: Link (Englisch, archiviert)
- Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council of 30 November 2009 on cosmetic products, European Parliament and Council, 1. Mai 2025: Link (Englisch, archiviert)
- Sunscreen photoprotection and vitamin D status, T. Passeron et al., 3. April 2019: Link (Englisch, archiviert)
- Optimal sunscreen use, during a sun holiday with a very high ultraviolet index, allows vitamin D synthesis without sunburn, A.R. Young et al. 14. März 2019: Link (Englisch, archiviert)
- Konsentierte Empfehlung zu UV-Strahlung und Vitamin D, Bundesamt für Strahlenschutz, 29. März 2022: Link (archiviert)




