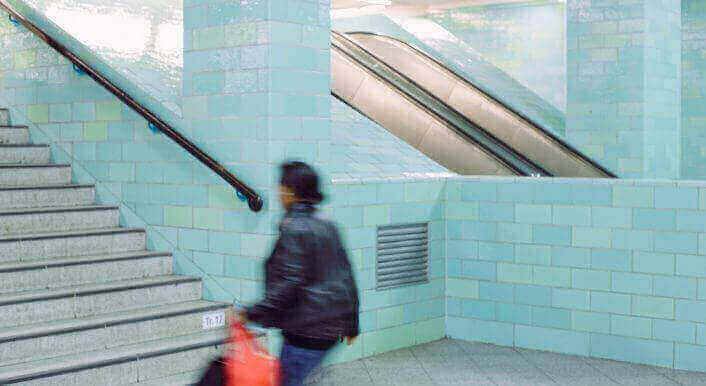Gefühlte Kriminalität
Die Polizei bestimmt durch ihre Mitteilungen, welche Kriminalfälle in der Zeitung stehen werden und welche nicht. Über 200.000 Anzeigen im Jahr in Wien stehen weniger als 2.000 Pressemitteilungen gegenüber. Das führt unweigerlich zu Verzerrungen der Wirklichkeit. Wir haben alle Polizeimitteilungen der Jahre 2013 und 2014 ausgewertet. Das Ergebnis: Über Handtaschenraub und Drogenkriminalität berichtet die Wiener Polizei auffallend häufig, über Vergewaltigung und rassistisch motivierte Gewalt fast nie.

© Ivo Mayr
Es hätte ein unbeschwerter Abend mit Freunden werden sollen, doch es kommt ganz anders: Auf der Party eines Freundes wird eine Wiener Schülerin im Februar 2013 vergewaltigt. Den Täter kennt sie flüchtig, er ist mit dem Gastgeber befreundet. Sie erstattet Anzeige, die Öffentlichkeit wird von der Vergewaltigung jedoch – wie so oft – nichts erfahren.
Ebenfalls im Februar 2013 wird in Wien eine 77-jährige Frau überfallen. Sie ist gerade vor ihrem Haus angekommen, als ein junger Mann versucht, ihr die Handtasche zu entreißen. Dabei stürzt die Frau und bricht sich ein Bein. Der mutmaßliche Räuber flüchtet – ohne Beute, wie man am nächsten Tag in den meisten Zeitungen lesen kann,
Schätze mit dem Schieberegler, wie viele Vergewaltigungen von der Polizei berichtet wurden.
Quelle: Presseaussendungen der Wiener Polizei, Polizeiliche Kriminalstatistik (2013 und 2014, zusammengefasst).
Visualisierung:
CORRECTIV
Die im Dunkeln sieht man nicht
Die Polizei meldete 2013 und 2014 nur jede 43. Vergewaltigung an die Medien, aber jeden 5. Handtaschenraub. Beide Straftaten passierten etwa gleich häufig. Noch seltener als Vergewaltigungen – nämlich nie – standen unterlassene Hilfeleistungen im Scheinwerferlicht der Polizeipressearbeit. Auch rassistisch motivierte Körperverletzungen, Drohungen und Beleidigungen kamen nicht vor, dafür liest man über nahezu jeden Juwelier- und Banküberfall und über jeden zweiten Taxiraubüberfall. Von Angriffen auf Polizisten beziehungsweise Widerstand gegen die Staatsgewalt verschickt die Polizei ebenfalls sehr häufig Pressemitteilungen.

Die Top-Themen in den Aussendungen – basierend auf einer Analyse der Überschriften – waren Raubüberfälle, Diebstähle, Delikte gegen Leib und Leben und Einbrüche. Immerhin auf Platz sechs: Drogenkriminalität. Jeden zweiten Tag informierte die Polizei über Dealer oder Suchtkranke, die sie erwischte.

Dazu ein Hinweis: Im Vergleich zu Handtaschenrauben waren Diebstähle, Einbrüche und Drogenkriminalität jedoch unterrepräsentiert, was an der enormen Zahl der Anzeigen liegt: So gab es 2014 beispielsweise knapp 39.500 Einbrüche. Würde die Polizei dazu genauso emsig Aussendungen verfassen wie zu Handtaschenrauben, hätte es allein zu Einbrüchen fast 8.000 Aussendungen geben müssen. De facto waren es 232, wobei hier häufig über ganze Serien berichtet wurde.
„Herrschaft über die Wirklichkeit“
„Tatort- und Soko-Kitzbühel-Kriminalität“, nennt das der Kriminalsoziologe Reinhard Kreissl. Es sei die Art von Kriminalität, bei der sich die Polizei gut als Retter inszenieren könne. Tatsächlich sei Polizeiarbeit vor allem trockene Routine und Schreibtischarbeit, aber gerade mit ihrer Pressearbeit könne die Polizei bestimmen, was sich die Bevölkerung unter Kriminalität vorstelle: „Die Polizei hat hier die Herrschaft über die Wirklichkeit“, sagt Kreissl. Dabei gehe es auch um politische Interessen: „Die Polizei hat es gern, wenn die Gesellschaft ordentlich und sauber ist. Nach dem Muster: Wir sind die Normtreuen, und dann gibt es am Rand der Gesellschaft die Bösen, die Handtaschen rauben oder mit Drogen dealen.“ Gewalt aus der Mitte der Gesellschaft, Rassismus oder Vergewaltigungen zum Beispiel, passe nicht in dieses Bild.
Diese Verzerrungen prägen die Gesellschaft. 80 bis 90 Prozent der Medienberichte über Kriminalität beruhen laut Kreissl auf Polizeiaussendungen. Praktisch alles, was Normalbürger über Kriminalität wissen, stamme wiederum aus den Medien. Und das hat Folgen, so Kreissl: 80 bis 90 Prozent aller Straftaten werden der Polizei von der Bevölkerung gemeldet: „Was die Bürger für kriminell halten, ist wesentlich vom Kriminalitätsbegriff der Polizei geprägt.“ Straftaten, die in der Öffentlichkeit weniger präsent sind, werden also möglicherweise auch seltener angezeigt.
Vergewaltigungen: Tabu und viele Mythen
Manchmal erkennen sogar die Betroffenen nicht, dass sie Opfer eines Verbrechens geworden sind – wie im Fall von Vergewaltigungen. „Sie glauben, irgendetwas muss ich getan haben, um das provoziert zu haben, irgendwie muss ich selber schuld sein“, erzählt die Sozialarbeiterin Ursula Kussyk, die in Wien eine Beratungsstelle für vergewaltigte Mädchen und Frauen leitet. In den Köpfen vieler müsse eine Vergewaltigung mit massiver Körper- und Waffengewalt einhergehen, sagt Kussyk, wenn der Täter das Überraschungsmoment nütze, sei es in der Vorstellung vieler keine Vergewaltigung.
Wenig Berichterstattung über Vergewaltigungen stütze den Mythos, „dass nur ganz wenige Männer Täter sind, die psychisch gestört oder in einem sexuellen Notstand sind, und dass Vergewaltigungen nur einzelne Frauen betreffen, die sich womöglich unvorsichtig verhalten haben“, erklärt die Sozialarbeiterin. Mehr Berichterstattung wünscht sie sich trotzdem nicht uneingeschränkt: „Besser es wird wenig berichtet als so, dass den Opfern die Schuld zugewiesen wird und sie dadurch retraumatisiert werden.“ In einer Pressemitteilung schrieb die Polizei zum Beispiel, das Opfer sei mit den mutmaßlichen Vergewaltigern vorher auf Lokaltour gewesen. „Da hat man dann die Assoziation: Sie hat ausgelassen gefeiert und war womöglich zu ,bereit’ für sexuelle Aktivitäten“, kritisiert Kussyk. Im Großen und Ganzen sei sie mit den Formulierungen der Polizei allerdings zufrieden, jedoch lasse sich nicht kontrollieren, was Medien im Endeffekt daraus machen.
Drogenkriminalität liefert „wichtige Erfolge“

Die Wiener Polizei berichtet über jeden 5. Handtaschenraub.
Ivo Mayr
Johann Golob, der oberste Polizeipressesprecher Wiens, sitzt in seinem Büro am Besprechungstisch. Er ist ein großer Mann mit neongrüner Ray-Ban-Brille, die man eher bei dem Chef einer Werbeagentur vermutet hätte. Mehrfach hat er betont, wie sehr er sich über die „Gratisanalyse“ seiner Arbeit freue. Jetzt zückt er einen Stapel Zettel: den Medienerlass des Innenministeriums. Golob hat sich vorbereitet. Der Erlass ist die Grundlage für alle Entscheidungen der Pressestelle, allerdings ist er trotz seiner 25 Seiten sehr allgemein gehalten. Die Gesellschaft ist „rasch, aktiv und professionell“ zu informieren, heißt es da zum Beispiel, außerdem dürfen die Ermittlungen nicht gefährdet werden – und es muss geprüft werden, „ob das Leid von Opfern, die Gefühle von Angehörigen und der Schutz ihrer Privatsphäre […] angemessen berücksichtigt werden“. Deswegen sei die Polizei bei Vergewaltigungen zurückhaltend, argumentiert Golob. Anders als bei Handtaschenrauben müsse man außerdem meistens nicht mehr nach den Verdächtigen fahnden, weil man sie bereits kenne. Auch aus diesem Grund würde über Handtaschenraube häufiger berichtet. Fahndungen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft müssten zudem immer veröffentlicht werden, erklärt Golob.
Die vielen Aussendungen über Drogenkriminalität seien der Imagepflege geschuldet, gibt Golob unumwunden zu – und die sei auch im Medienerlass vorgesehen. Drogenkriminalität biete „wichtige Erfolge“ für die Polizei. Da Drogenbesitz meist im Zuge von Personenkontrollen angezeigt wird, liegt die Aufklärungsquote bei fast 100 Prozent. Außerdem könne man so zeigen, dass man „im öffentlichen Raum sehr präsent ist“, sagt Golob, das sei wichtig für das Vertrauen der Bevölkerung in die Polizei.
Dass rassistisch motivierte Gewalttaten in den Presseaussendungen fehlen, dementiert Golob: „Wir veröffentlichen natürlich auch derartige strafrechtlich relevante Delikte.“ Konkret nennt er einen Vorfall, bei dem ein Mann in einer U-Bahn-Station krankenhausreif geschlagen wurde. Von einem möglichen rassistischen Motiv erfuhr man aus der Pressemitteilung nichts, hier war nur die Rede von einer „verbalen Auseinandersetzung“. Abgesehen davon wurde der Vorfall durch einen Bericht der Zeitung „Österreich“ bekannt – die Polizei veröffentlichte erst über ein Monat später eine Fahndung. Auch in mindestens zwei weiteren Fällen von Körperverletzung blieben rassistische Motive in den Aussendungen der Polizei unerwähnt und wurden erst auf Nachfragen von Medien zum Thema.
Ab wann ist Rassismus rassistisch?
Rund 45 Fälle von rassistisch motivierter Gewalt wurden dem Verein ZARA, der Opfer und Zeugen von Rassismus berät, 2013 und 2014 in Wien gemeldet. Die Dunkelziffer dürfte weit höher sein. Der Fall von Herrn E. war der Polizei jedenfalls keine Presseaussendung wert: Im August 2014 wird der Arzt von einem Mann rassistisch beschimpft, geschlagen, gewürgt und verletzt. Als die Polizei eintrifft, nimmt sie Herrn E.s Anzeige aber nicht auf, weil er unter Schock steht und zunächst keine Angaben zu Verletzungen machen kann. Erst als im Krankenhaus eine Verletzung im Bereich der Halswirbelsäule festgestellt wird und Herr E. auf der Anzeige besteht, wird der Vorfall aufgenommen.
Immer wieder komme es vor, dass die Polizei mögliche rassistische Motive bei der Befragung nicht erfasse, berichtet die Juristin Dina Malandi, Leiterin der ZARA-Beratungsstelle. Auch dass Anzeigen wegen rassistischer Beleidigung aus Mangel an Zeugen häufig nicht aufgenommen werden, kritisiert sie: Hier würde die entsprechende Bestimmung von der Polizei unnötig eng ausgelegt. Zu eng sei auch der Rassismusbegriff der Wiener Polizei. „Wenn die Verdächtigen keiner rechtsextremen Gruppe angehören, ist der Rassismus in den Ermittlungen meist kein Thema mehr“, sagt Malandi.
Rassismus in Form von NS-Wiederbetätigung ist auch tatsächlich der einzige, über den die Polizei 2013 und 2014 in ihren Presseaussendungen berichtete. Drei Meldungen gab es: zu Hakenkreuz-Schmierereien auf einem Friedhof, einem Hitlergruß und einem Folder mit nationalsozialistischem Inhalt bei einer Demonstration. Um körperliche Gewalt gegen Personen ging es in keinem der Fälle.
Böse Absicht will Malandi der Polizei aber nicht unterstellen. Das Thema Hate Crimes, also Hasskriminalität, sei in Österreich noch sehr neu, es brauche mehr gezielte und verpflichtende Schulungen. Als positives Beispiel nennt sie Großbritannien, wo mögliche Hassmotive bei jeder Anzeige automatisch abgefragt werden. „In London findet man an Polizeistationen zum Beispiel Aushänge mit der Aufforderung, sich zu melden, wenn man Opfer eines Hate Crimes geworden ist“, erzählt die Juristin. Und sie fordert dringend mehr Berichterstattung über die Verbindung von Rassismus und Straftaten wie gefährliche Drohung oder Körperverletzung. Auch als Ausgleich zur Tendenz vieler Medien, „Straftaten als viel schrecklicher darzustellen, wenn sie von Menschen anderer Herkunft begangen werden“.
Wie gefährlich ist Favoriten?
Eine Beobachtung noch zu den Verzerrungen bei den verschiedenen Wiener Bezirken: In Favoriten, dem Bezirk, der in der Polizeipressearbeit mit Abstand den meisten Platz bekam, ist auch das Sicherheitsgefühl der Bewohner am schlechtesten. In einer Befragung des IFES-Instituts aus dem Jahr 2013 gaben sie diesem die Schulnote 2,33. Die besten Noten bekamen hingegen zwei Bezirke mit besonders wenigen Presseaussendungen: die gutbürgerliche Josefstadt (Note 1,65) und die bei Akademikern beliebte Wieden (Note 1,78). Dabei liegt der Arbeiterbezirk Favoriten bei der Sicherheit – gemessen in Anzeigen pro Kopf – absolut im Mittelfeld: In Favoriten kommen auf 1.000 Einwohner 98 Anzeigen, im Wien-Schnitt sind es 103.
Durch solche Verzerrungen in der Berichterstattung würden mitunter „No-go-Areas“ geschaffen, kritisiert der Kriminalsoziologe Reinhard Kreissl. Eine Analyse des Wiener Instituts für Rechts- und Kriminalsoziologie, das Kreissl bis vor kurzem leitete, zeigt jedoch auch, dass sich eine prekäre Lebenssituation, finanzielle Unsicherheit und die Unzufriedenheit mit dem Wohngebiet stark negativ auf das Sicherheitsgefühl auswirken. Favoriten hat beispielsweise eines der niedrigsten Pro-Kopf-Einkommen Wiens. „Sicherheit heißt für die Leute vor allem: Die Wohnung muss sicher sein, der Job, die Beziehung und das soziale Netzwerk“, sagt Kreissl.
„Tagesaktuelle Berichte braucht es nicht“
Kreissl fordert die Medien auf, die tagesaktuelle Kriminalitätsberichterstattung zu hinterfragen: „Wenn es heißt, dieses Viertel ist besonders gefährlich, müssten Medien fragen: Was bedeutet das konkret? Machen wir doch einmal einen Bericht über die Nightlife-Economy in Favoriten, reden wir mal mit den Leuten.“ Und wie würde eine sinnvolle Pressearbeit der Polizei seiner Meinung nach aussehen? Die sollte neben den üblichen Tipps, wie man sich vor Taschendieben und Einbrechern schützt, auch Quartalsberichte zur Kriminalität auf Stadtteilebene liefern, sagt Kreissl. Darin dürften dann auch die „langweiligen“ Teile des Polizeialltags – betrunkene Radfahrer, Informationsveranstaltungen, gestohlene Geldbörsen – nicht ausgeklammert werden: „Wenn Sie von großen Verbrechen erzählen, die irgendwo passieren, dann verängstigen Sie die Leute nur.“ Generell findet er tagesaktuelle Berichterstattung nur bedingt sinnvoll: „Das befördert einfach nur den Voyeurismus, den Schauder aus zweiter Hand. Das braucht es nicht.“
Grafiken: Simon Jockers und Stefan Wehrmeyer
Die Recherche für diesen Artikel wurde durch ein Fellowship des Recherchezentrums CORRECTIV und der Rudolf-Augstein-Stiftung ermöglicht. Die Autorinnen sind ORF-Redakteurinnen in Wien, die Ergebnisse wurden auch auf ORF.at und in der Wiener Wochenzeitung „Falter“ veröffentlicht.