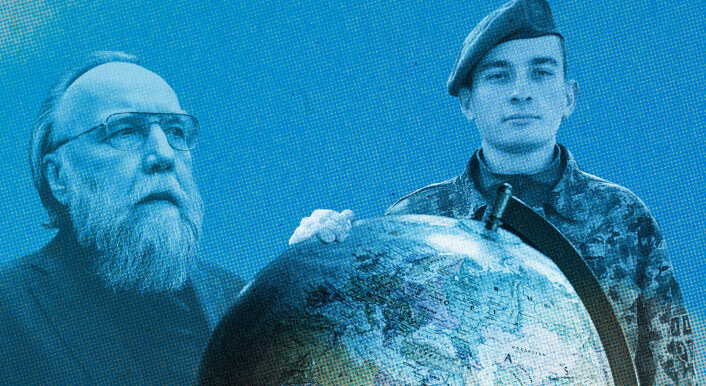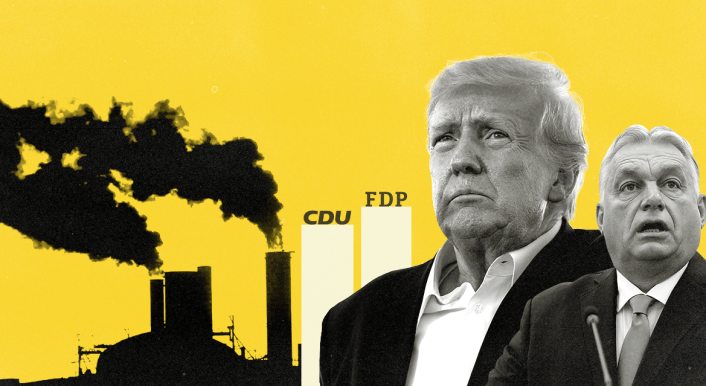„Integrationsskala“: CDU-Politiker de Vries und seine muslimfeindlichen Äußerungen
Der Hamburger CDU-Abgeordnete Christoph de Vries äußert sich muslimfeindlich im Bundestag. Das ergab ein Expertenbericht im Auftrag des Bundesinnenministeriums im vergangenen Jahr. Mittlerweile ist sein Name daraus verschwunden. Seine Aussagen bleiben problematisch.

Christoph de Vries ist ein Politiker, der regelmäßig öffentlich polarisiert. Der CDU-Abgeordnete aus Hamburg schreibt im Januar 2023 von Personen des „Phänotypus westasiatisch, dunklerer Hauttyp“, die den deutschen Staat missachten würden. Im August diesen Jahres forderte er den „Stopp der Asylmigration aus arabischen und nordafrikanischen Ländern“. Und im Oktober kursierte auf mehreren Kanälen ein Video in den sozialen Netzwerken, in dem de Vries auf einer Podiumsdiskussion Menschen mit Migrationsgeschichte entlang einer „Integrationsskala“ hierarchisiert. Ganz oben seien die „Deutschen aus Russland“, sie kämen den „Bio-Deutschen“ am nächsten. Folgen würden „asiatische Gruppen“, diese seien fleißig und bildungsaffin, ganz unten auf der „Integrationsskala“ seien türkische und arabische Migranten. Das sind Zitate, die an die rechts-völkische Ideologie von Rechtsextremisten wie Martin Sellner oder dem Ideologen Götz Kubitscheck erinnern.
Seiner Karriere haben solche Äußerungen bisher nicht geschadet – und das, obwohl die Kritik an de Vries’ Äußerungen vor eineinhalb Jahren sogar durch ein Gutachten gestützt worden ist. Ein vom Bundesinnenministerium in Auftrag gegebener Expertenbericht hatte ihn kurzzeitig namentlich genannt und ihm muslimfeindliche Äußerungen attestiert.
Doch de Vries spricht weiter zu islampolitischen Debatten im Bundestag. Sein Hamburger Landesverband sicherte ihm den komfortablen dritten Listenplatz für die nächste Bundestagswahl. Und wer nachlesen will, was de Vries von den Expertinnen und Experten vorgeworfen wird, sucht den Namen im Bericht vergeblich. Was ist da passiert? Und was sagt der Umgang des Politikers und der Partei mit dem Vorgang aus?
Muslimfeindlichkeit sollte nach Anschlägen in Hanau untersucht werden
In Auftrag gegeben wurde der Bericht zur Muslimfeindlichkeit vom Bundesinnenministerium, damals noch unter der Leitung von de Vries’ Unions-Kollegen Horst Seehofer (CSU). Der Grund: Die Anschläge in Hanau, bei denen im Februar 2020 neun Menschen aus rassistischen Motiven erschossen wurden.
Fertig wurde der Bericht im Juni 2023. Auf 400 Seiten beschreibt ein unabhängiger Expertenkreis (UEM), wie Musliminnen und Muslime in Deutschland diskriminiert werden und welche Verantwortung dabei unter anderem Medien und Politik tragen. Die Experten zitieren dabei auch Abgeordnete, die sich muslimfeindlich äußern. Einer von ihnen war Christoph de Vries.
In seinen Äußerungen zeige sich eine „unklare Abgrenzung von der AfD“, heißt es dort. Denn auch wenn de Vries sich in Gegenreden von der AfD abgrenze, gehe er auf Brückendiskurse mit dieser ein. Während er zwar in Teilen zu Recht gewisse Gefahren des islamistischen Extremismus betone, beziehe er gleichzeitig „reguläre Strukturen des Islams und streng religiöse Verhaltensweisen eines orthodox-konservativen Teils“ der Musliminnen und Muslime in die Argumentation ein.
Bemerkenswert ist: Wer heute nach dem Bericht sucht, findet de Vries’ Namen darin nicht mehr. Er wurde gestrichen. Nicht aber, weil seine Äußerungen als nicht muslimfeindlich interpretiert wurden. Vielmehr wusste de Vries ein Momentum für sich zu nutzen. Denn was auf die Veröffentlichung folgte, waren mehrere – in Teilen erfolgreiche – Klagen gegen das Bundesinnenministerium (BMI), woraufhin der Bericht für einige Monate zurückgezogen wurde.
Wie de Vries ein Momentum nutzen konnte
Gegen den Bericht geklagt hatte unter anderem der Publizist und Welt–Kolumnist Henryk M. Broder. Das Oberverwaltungsgericht Berlin hat daraufhin eine einstweilige Verfügung gegen das Bundesinnenministerium (BMI) erlassen. Es sah Broders Persönlichkeitsrecht durch den Bericht verletzt, der seine Inhalte damals als pauschale Dämonisierung von Muslimen als „unwissende, ehrversessene, blutrünstige Horden“ beschreibt.
Die vom ursprünglichen Gutachten aufgeführten Zitate sind zwar richtig wiedergegeben worden. Dem Ministerium wurde jedoch untersagt, diese zu werten. Das Innenministerium sei zur Zurückhaltung, Sachlichkeit, Ausgewogenheit und rechtsstaatlicher Distanz verpflichtet, so das Urteil des Gerichts.
Nach der erfolgreichen Klage von Broder ging im März 2024 auch de Vries in die Offensive. In einem Brief an Innenministerin Nancy Faeser (SPD) forderte er, den Bericht nicht mehr zu veröffentlichen. Oder zumindest seinen Namen zu streichen. Ansonsten behalte er sich „rechtliche Schritte vor“.
Mit Letzterem war er erfolgreich. Nur kurz nach seinem Appell an die Ministerin versicherte Faeser in einer Befragung der Bundesregierung, dass de Vries in der neuen Fassung nicht mehr genannt werde. Aber nicht etwa, weil de Vries’ Äußerungen als nicht muslimfeindlich befunden wurden. Sein Name sei „auf dessen ausdrücklichen Wunsch aus dem Bericht entfernt“ worden, auch „um mögliche Verzögerungen einer Wiederveröffentlichung zu vermeiden“, heißt es vom Bundesinnenministerium.
De Vries stellt hunderttausende Muslime unter Generalverdacht
Politikwissenschaftler Imad Mustafa verfasste im Auftrag des Expertenkreises UEM eine Studie zum Islam und antimuslimischen Rassismus im Parteiensystem und Bundestag. Er sagt: „De Vries beschreibt konservative Praktiken des Islams als eine Art Vorstufe für eine gewalttätige Radikalisierung“.
Zu beobachten sei diese Einstellung in einem Positionspapier der CDU/CSU-Fraktion, an dem de Vries nach eigenen Angaben maßgeblich mitgewirkt hat. In diesem werden Musliminnen und Muslime, die sich an den Kategorien halal (erlaubt) und haram (verboten) orientieren, als Teil eines „fundamentalen Gegenentwurfes zu Demokratie, Pluralismus und individuellen Freiheitsrechten“ beschrieben. Das Ziel dieser religiösen Praktik sei „die Unterwerfung von Gesellschaft, Politik, Kultur und Recht“, heißt es von den Autoren des Papiers.
Zwar werde innerhalb der CDU schon immer zwischen gut integrierten Muslimen und denen, die es nicht seien, unterschieden. Positionen wie die von de Vries haben laut Mustafa aber eine „ganz neue Qualität“. „Sehr konservative religiöse Einstellungen reichen nach de Vries’ Definition aus, um in den Verdacht der Verfassungsfeindlichkeit zu geraten“, sagt Mustafa. Er sieht mit dieser Haltung hunderttausende Musliminnen und Muslime in Deutschland unter Generalverdacht gestellt. „Diese radikal antimuslimischen Positionen versucht de Vries wiederum als legitime Extremismusbekämpfung zu verpacken“, sagt Mustafa.
Unionsfraktion lässt Hardliner regelmäßig zu Wort kommen
Dass ein Hardliner wie de Vries so häufig bei islampolitischen Debatten für die CDU/CSU-Fraktion sprechen darf, erstaunt Mustafa. Gerade weil seine Äußerungen anschlussfähig seien an die „antimuslimischen, rechtspopulistischen und rechtsextremistischen Positionen“ der AfD. Stellt sich die Frage, weshalb er die CDU bei wichtigen islampolitischen Debatten immer wieder vertreten darf?
Das hat CORRECTIV auch den Fraktionsvorsitzenden Friedrich Merz (CDU) und den Parlamentarischen Geschäftsführer Thorsten Frei (CDU) gefragt. Beide äußerten sich nicht.
Es sind nicht immer die zentralen Entscheidungsträger, die die Leitlinien einer Partei bestimmen. Gerade bei religionsbezogenen Themen. Denn hier sei das Interesse innerhalb der Fraktionen eher klein, erklärt Mathias Rohe, der den unabhängigen Expertenkreis damals vertrat und koordinierte.
Eine Anhörung der Religionsbeauftragten der Bundestagsparteien habe ergeben, dass religionsbezogene Fragen „in der Politik auf der Agenda ganz weit hinten stehen“, so Rohe. Das sei die Chance für „besonders interessierte Personen“, den Raum einzunehmen und „ihre spezifischen Positionen ziemlich stark durchzusetzen“.
De Vries fällt auch an anderen Stellen mit seiner Haltung auf
De Vries weiß den Raum für sich zu nutzen. Das zeigt sich auch in seinem Umgang mit anderen Organisationen, denen er in der Vergangenheit islamistische Verbindungen unterstellt hat. In kleinen Anfragen im Bundestag, aber auch öffentlich in einem Zeitungsinterview.
Öfter ins Visier nimmt er die Organisation „Claim“. Der Verein vernetzt bundesweit über 50 zivilgesellschaftliche Akteure, die sich gegen antimuslimischen Rassismus engagieren, dokumentiert antimuslimische Übergriffe und Diskriminierungen und koordiniert die bundesweiten Aktionswochen gegen antimuslimischen Rassismus.
In einem Interview mit der Jüdischen Allgemeinen sagte de Vries 2022, dass „Personen mit engen Bezügen zu islamistischen Gruppierungen“ Teil des Claim-Netzwerks seien. Stichhaltige Belege präsentiert de Vries nicht. Stattdessen spricht er lose von Personen-Netzen und zitiert in seinen Anfragen aus Wikipedia-Artikeln.
Mit seiner Einschätzung stellt er sich gegen die des Innenministeriums. Von diesem wird Claim seit Juli 2024 gefördert. Damit einher geht eine Prüfung der beteiligten Akteure seitens der Behörden.
Für Organisationen wie Claim bedeutet das einen immensen Vertrauensverlust. Denn steht eine solche Behauptung erstmal im Raum, sei sie laut Rima Hanano, Leiterin von Claim, nicht mehr so leicht loszuwerden: „Wenn ich nicht schon ein Vertrauensverhältnis habe und dann in mehreren Anfragen zu lesen ist, dass wir der Muslimbruderschaft nahe stünden, werde ich bestimmt nicht mit offenen Armen empfangen.“
CORRECTIV hat de Vries mit den Vorwürfen gegen seine Äußerungen im Bericht zur Muslimfeindlichkeit konfrontiert. Die Redaktion hat ihn ebenfalls gefragt, auf welcher Beleglage seine damalige Einschätzung zu Claim basierte und wie er sich zur Förderung des BMI und der damit einhergehenden Prüfung verhält. Alle Fragen ließ er unbeantwortet.
Geschadet haben de Vries seine öffentlichen Auftritte und seine Nennung in der ersten Version des Berichts zur Muslimfeindlichkeit bisher offenbar nicht. Für die Unionsfraktion spricht er weiterhin regelmäßig. Seine Rolle in einer möglichen CDU-geführten Regierung bleibt offen.
Redaktion: Alexej Hock, Justus von Daniels
Mitarbeit: Niclas Fiegert
Faktencheck: Marcus Bensmann
Kommunikation: Valentin Zick, Luise Lange-Letellier
Diese Veröffentlichung ist Teil eines neuen Recherche-Projekts zu Kandidierenden des Bundestages. Für mehr Transparenz blickt CORRECTIV gezielt auf Interessenkonflikte, Unklarheiten in der Biografie, auf Personennetze und politische Positionen der Kandidierenden. Kurz: Auf alles, was Wählerinnen und Wähler interessiert, um ihre Wahlentscheidung zu treffen.
Sie haben einen Hinweis? Dann schreiben Sie uns unter sunlight@correctiv.org oder nutzen Sie unseren anonymen Briefkasten.