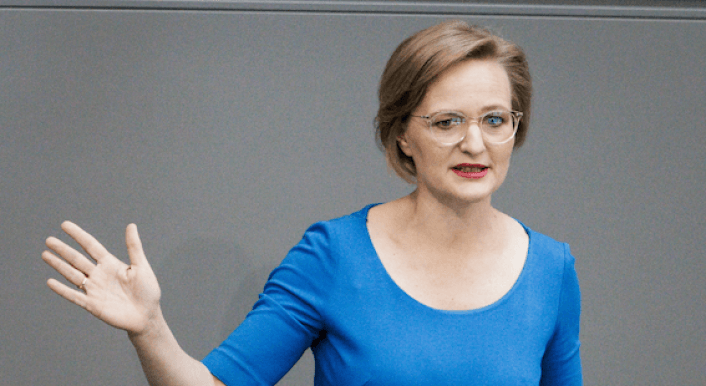So wenig aus dem Infrastruktur-Topf soll in den Kommunen ankommen
Von den 500 Milliarden Euro „Sondervermögen Infrastruktur“ bekommen die Bundesländer im Herbst 100 Milliarden – und müssen sie zum Teil an die Kommunen weitergeben. Nach CORRECTIV-Informationen wird aber deutlich weniger Geld in die Städte und Gemeinden fließen als zunächst erwartet.

500 Milliarden Euro, eine halbe Billion: Mit diesem Geld, das die schwarz-rote Bundesregierung in den kommenden Jahren an Schulden aufnehmen will, soll Deutschlands Infrastruktur modernisiert werden – so das Versprechen. CORRECTIV verfolgt seit dem Beschluss im Frühjahr kontinuierlich, was genau mit diesem Geld passiert, an welchen Stellen womöglich ein Teil davon versickert, wer Einfluss auf die Verteilung nimmt – und wie viel am Ende tatsächlich in den Kommunen ankommt.
Die Recherchen zeigen nun: An die Städte und Gemeinden im Land wird voraussichtlich ein deutlich kleinerer Teil fließen, als diese zunächst erwartet hatten:
- Der Bundesrat wird voraussichtlich Mitte Oktober dem „Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz“ zustimmen. Dieses Gesetz regelt, wie die Bundesländer konkret jene 100 Milliarden Euro, die sie aus dem 500 Milliarden-Topf erhalten, verteilen müssen. Es geht also darum, welchen Anteil sie selbst behalten dürfen und welchen sie an die Kommunen weitergeben müssen.
- Ursprünglich sollte der Anteil der Kommunen mit 60 Prozent im Gesetz verankert werden Inzwischen wurde diese Passage jedoch wieder aus dem Gesetzestext gestrichen. Das bedeutet, dass die Bundesländer nun aller Wahrscheinlichkeit nach selbst entscheiden dürfen, wie viel sie den Kommunen geben und wie viel sie selbst behalten. Hier ist der ursprüngliche Gesetzentwurf (Referentenentwurf) nachzulesen, hier der aktuelle Regierungsentwurf.
- Besonders groß ist das Zittern im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen: Dort soll Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) CORRECTIV-Recherchen zufolge intern angekündigt haben, lediglich 50 Prozent der NRW-Milliarden an die Kommunen weitergeben zu wollen. Die meisten anderen Bundesländer wollen sich auf Anfrage der Redaktion noch nicht festlegen.
So viel Geld erhalten die Bundesländer:
Wie die 100 Milliarden aus dem Geldtopf auf die Bundesländer verteilt werden sollen, steht bereits fest: nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel. Dieser setzt sich zusammen aus dem Steueraufkommen und der Bevölkerungszahl der Bundesländer.
So viel wollen die Bundesländer den Kommunen weitergeben:
Welchen Anteil davon sie an die Kommunen weitergeben, dürfen die Landesregierungen nun selbst entscheiden. CORRECTIV hat die zuständigen Ministerien in den Ländern gefragt, ob dieser Anteil bereits feststeht.
Das Ergebnis: Lediglich drei Bundesländer haben bislang festgelegt, wie viel Geld sie an die Kommunen weiterleiten wollen: Niedersachsen hat in einer Haushaltsklausur Ende Juni festgelegt, „mindestens 60 Prozent“ an die Kommunen weiterzugeben, Schleswig-Holstein will 62,5 Prozent an die Städte und Gemeinden weiterleiten und Rheinland-Pfalz 60 Prozent.
Die anderen Landesregierungen teilten auf Anfrage der Redaktion mit, über die Aufteilung werde noch beraten oder es sei keine Aussage möglich. Hessen deutete an, „mehr als die Hälfte“ weitergeben zu wollen.
DStGB: 80 Prozent der Investitionen müssen Kommunen schultern
Was sich jedoch bereits abzeichnet: Es wird wohl deutlich weniger Geld an die Kommunen fließen, als diese erwartet hatten – und für dringend notwendig halten, um kaputte Schulen, Straßen, Brücken oder Krankenhäuser auf Vordermann zu bringen. Der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes (DStGB), Uwe Zimmermann, sagte CORRECTIV dazu:
„In den Flächenländern – also den Bundesländern außer Berlin, Hamburg und Bremen – müssen 80 Prozent der öffentlichen Investitionen in die Infrastruktur von den Kommunen gestemmt werden. Schon die 60 Prozent, die ursprünglich im Gesetz vorgesehen waren, wären also deutlich zu wenig gewesen. Wir kritisieren daher entschieden, dass auch diese Vorgabe aus dem Gesetzentwurf gestrichen wurde.“
An diesem Montag gab es eine Anhörung im Haushaltsausschuss des Bundestags zu dem Thema. Auch dort war der DStGB-Vertreter als Experte geladen und formulierte seine Bedenken über die Verteilung der Gelder.
NRW: Wüst und die 50 Prozent
Besonders strittig ist die Lage derzeit in Nordrhein-Westfalen: Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) soll in einer Beratungsrunde mit den kommunalen Spitzenvertretern angedeutet haben, lediglich 50 Prozent der 21 Milliarden Euro weitergeben zu wollen, die das Land über zwölf Jahre verteilt aus dem Topf erhalten soll – also 875 Millionen pro Jahr.
Geht man davon aus, dass dieses Geld nach der Einwohnerzahl unter den rund 18 Millionen Bewohnern NRWs verteilt wird, würde dies für eine Stadt wie Essen mit knapp 600.000 Einwohnern bedeuten: Sie bekäme rund 29 Millionen Euro pro Jahr aus dem Topf. Das klingt zunächst nach viel Geld – praktisch jedoch ist es, wie DStGB-Vertreter Zimmermann es ausdrückt, gerade mal „ein Pflaster, um Wunden notdürftig zu verschließen“. Das Geld reiche nicht einmal aus, um eine neue Schule zu bauen.
CORRECTIV hat die nordrhein-westfälische Staatskanzlei gefragt, wie viel Geld die Landesregierung an die Städte und Gemeinden weiterzugeben plant. Die Antwort: „Da die Gesetzgebungsverfahren auf Bundesebene noch nicht abgeschlossen sind, können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine abschließenden Aussagen zur genauen Umsetzung in Nordrhein-Westfalen getroffen werden.“ Die Landesregierung werde nach der Klärung der bundesgesetzlichen Rahmenbedingungen im Dialog mit den Vertretern der Kommunen einen „fairen und tragfähigen Verteilungsschlüssel finden“.
UPDATE: Nach dem Erscheinen dieses Textes antwortete die NRW-Staatskanzlei auf die Frage, ob Wüst diesen Plan so geäußert habe: Die Darstellung sei nicht korrekt. Details dazu, wie die Darstellung denn richtig lauten müsste, machte der Sprecher nicht. Er schrieb lediglich, es bleibe dabei, die Kommunen würden umfassend am Länderanteil des Sondervermögens beteiligt.
Die politische Auseinandersetzung über die Verteilung des Geldes schwelt bereits seit ein paar Wochen. Mitte August antwortete die Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der SPD-Fraktion – hier nachzulesen. Die Fraktion hatte gefragt: „In welchem Umfang plant die Landesregierung, die dem Land Nordrhein-Westfalen zustehenden Mittel aus dem Bundes-Sondervermögen, für die kommunale Infrastruktur an Kommunen, Städte und Gemeinden weiterzugeben?“
Die Antwort: „Da das Gesetzgebungsverfahren auf Bundesebene noch nicht abgeschlossen ist, können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine abschließenden Aussagen getroffen werden, wie das Gesetz in Nordrhein-Westfalen umgesetzt werden soll.“
Aus der Antwort der Landesregierung geht zudem hervor, dass sich NRW offenbar auf Bundesebene dafür stark gemacht hatte, die 60 Prozent-Vorgabe aus dem Gesetz zu streichen. Auf eine entsprechende Frage der SPD-Fraktion antwortete sie: „Die Landesregierung hat von der Möglichkeit, zum Referentenentwurf der Bundesregierung Stellung zu nehmen, Gebrauch gemacht. (…) Eine starre Vorgabe des Bundes zur Mittelverteilung hätte eine unzulässige Einmischung in die Zuständigkeit der Länder bedeutet.“
Der Vorsitzende der SPD-Fraktion im NRW-Landtag, Jochen Ott, kritisiert das Vorgehen der Landesregierung auf Anfrage von CORRECTIV: „Bisher hatten wir es nur für ein Gerücht gehalten, dass sich NRW für die Streichung der kommunalen Mindestquote eingesetzt haben soll. Aber mit der Antwort der Landesregierung haben wir es nun schwarz auf weiß. Sie brüstet sich ja geradezu damit.“
Ott, sagte, er halte dies „für einen großen Fehler“. „Bei diesem geplanten Landeshaushalt können sich die Kommunen nämlich alles andere als sicher sein, dass das dringend benötigte Geld auch wirklich in ausreichendem Maße bei ihnen ankommen wird.“ Auch er fordert wie der DStGB, dass das Land 80 Prozent des Geldes weitergibt.
Stadt-Land-CDU
In NRW zittern die Vertreterinnen und Vertreter der größeren Städte noch aus einem anderen Grund: Die Landesregierung hält sich auch dazu bedeckt, nach welchem Verteilungsschlüssel sie das Geld an die Kommunen auszahlen will.
Da das Land CDU-regiert ist und ein traditionell Wählerklientel in ländlichen Regionen hat, hatte die SPD-Fraktion die Regierung auch gefragt, ob sie das Infrastrukturgeld tatsächlich nach der Einwohnerzahl verteilen will – oder ob sie finanzschwache ländliche Regionen besonders bedenken wolle. Hierauf antwortete die Landesregierung nicht konkret.
In Nordrhein-Westfalen ist die Frage, wie viel Infrastrukturgeld in den Kommunen ankommt, mit Blick auf die Kommunalwahlen Mitte September besonders relevant.
CORRECTIV hat die Stadtverwaltungen mehrerer NRW-Städte gefragt, was sie davon halten, dass die Landesregierung nun in Eigenregie über die Verteilung des Geldes entscheiden kann.
Die Stadt Dortmund teilte mit, sie unterstütze die Kritik des Deutschen Städte- und Gemeindebundes vollständig; Bottrop verwies darauf, dass die Stadt Mitglied in einem Aktionsbündnis ist – das sich für mehr Infrastrukturgeld für strukturschwache Regionen einsetzt.
***
Mitarbeit: Elena Schipfer, Tobias Hauswurz, Jacob Jargon, Miriam Jagdmann
Redaktion und Faktencheck: Gesa Steeger