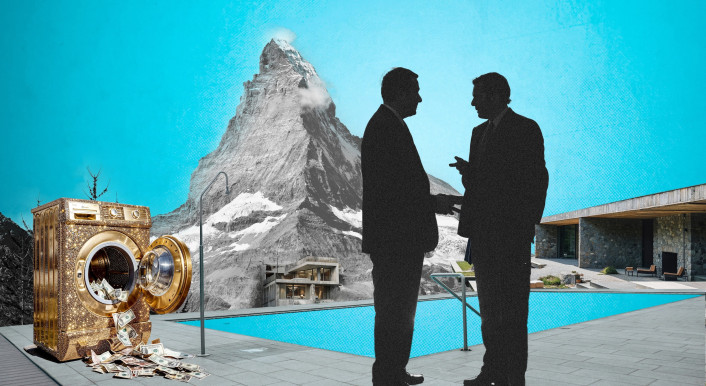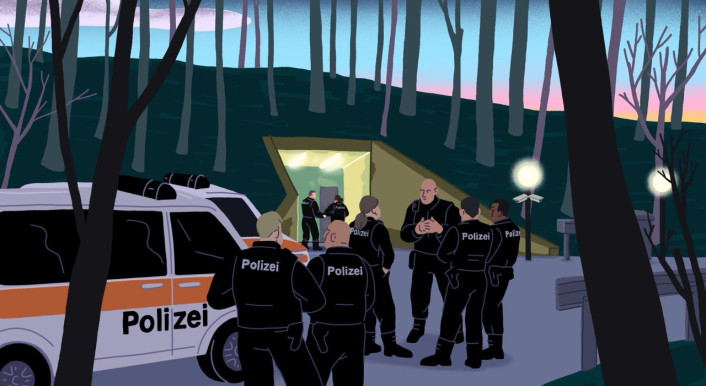Der Staat als Dienstleister für Superreiche
Eine verdeckte Recherche von CORRECTIV.Schweiz und der WOZ zeigt, wie ausländische Superreiche von Schweizer Banken, Kanzleien und Steuerämtern umworben werden. Dabei verraten selbst Behörden die besten Tricks, um wenig Steuern zu zahlen.

Der Steuerexperte einer Zürcher Privatbank schwärmt von der „alten guten Zeit“, als er als junger Banker in die Branche einstieg und es noch „sehr viele undeklarierte Vermögenswerte“ gab. Im Sitzungszimmer auf dem dunklen Massivholz-Tisch vor ihm liegt das Buch „Steuerparadiese“ des Tessiner Anwalts Lucio Velo. Auf dem Titelbild eine Insel mit Sandstrand und Palmen, zwei Yachten und eine junge, lächelnde Frau mit rosa Blumenkranz.
Mitgebracht haben es die Gäste, die das Treffen eingefädelt haben: der vermeintliche Milliardärs-Erbe Elia Weiss. Der in Wirklichkeit anders heisst und vorgibt, aus Deutschland in die Schweiz zu ziehen, um von tiefen Steuern zu profitieren. Sein Vermögensberater Stefan Hoffmann, der weder Weiss’ Vermögensberater ist noch so heisst. Und ein Assistent von Weiss, der Journalist ist und bei einzelnen Treffen dabei war.
In einer verdeckten Recherche untersuchten CORRECTIV.Schweiz und WOZ – Die Wochenzeitung, wie Banken, Kanzleien und kantonale Steuerämter ausländischen Superreichen helfen, Steuern zu sparen. Denn mit einem Wohnsitz in der Schweiz und ohne hier zu arbeiten, profitieren sie von einer Sonderbehandlung: der Pauschalbesteuerung. Die Steuern werden anhand einer Aufstellung der von ihnen jährlich weltweit getätigten Ausgaben bemessen, auch für ihre Angehörigen. Ihr Vermögen oder Einkommen spielt dabei keine Rolle.
Steuertricks für Superreiche
Trotz des malerischen Blicks aus dem Sitzungszimmer auf die Dächer des Bankenviertels wirkt der vermeintliche Milliardärserbe Weiss gelangweilt. Seine Nase ist leicht gerümpft, als liege ein unangenehmer Geruch im Raum. „Gibst du mir bitte eine Banane?“, fragt er seinen „Assistenten“. Dieser greift nach einer Designertasche aus Leder und beginnt darin zu kramen. Er fischt eine kleine Holzschatulle heraus. Darin ordentlich auf einer Stoffserviette angerichtet: eine Banane. „Kannst du sie bitte aufmachen?“, fragt Weiss. Der „Assistent“ nickt und schält sie mit ernster Miene.
Von der bizarren Szene lässt sich der Steuerexperte der Zürcher Privatbank nicht im Geringsten irritieren. Er schwärmt von „aggressiver Steueroptimierung“ und dem kleinen Obwalden als idealem Wohnkanton für Weiss. Dort seien die Behörden am „kundenfreundlichsten“, sagt der Banker. Sie würden „den besten Steuerdeal machen“.

Wirklich in Obwalden wohnen müsse Weiss selbstverständlich nicht, sagt der Banker. Er könne sich in Verbier ein Haus kaufen und dort so viel Zeit verbringen, wie er wolle. Nur zu viel Aufmerksamkeit sei zu vermeiden. Es wäre ungünstig, wenn die dortigen Behörden bemerkten, dass er sich zu häufig im Wallis aufhalte und seine Steuern eigentlich dort zahlen müsste.
Ein weiterer Trick des Steuerexperten: Wenn als Beispiel 10 Millionen Franken Bargeld auf einem Schweizer Bankkonto lägen, müsste das für eine Kontrollrechnung angegeben werden. Aber nur, wenn es am Stichtag, dem 31. Dezember, auf dem Konto ersichtlich sei. „Da behilft man sich vielfach, dass Mitte Dezember bis Mitte Januar eine Treuhandanlage gekauft wird.“ Das bedeutet: Die Bank legt das Geld in ihrem Namen bei einer ausländischen Bank an. So müsse es bei der Überprüfung nicht angegeben werden.
Die Dienstleistungs-Behörde, die keine sein dürfte
Dass ein Banker einem schwerreichen potenziellen Kunden hilft, so wenig Steuern wie möglich zu zahlen, überrascht kaum. Unsere Recherche zeigt jedoch: Bei diesem Spiel machen Steuerämter mit. Jene Behörden, die dafür sorgen sollten, dass die Bevölkerung ihre Steuern korrekt zahlt und die Einnahmen der Gesellschaft zugutekommen.
Auf dem Altdorfer Rathausplatz steht Wilhelm Tell auf seinem Sockel, den grimmigen Blick auf das Steueramt des Kantons Uri gegenüber gerichtet. „Hier ist es wild, Leute“, schreibt Weiss in den Gruppenchat auf Signal. Etwa 45 Minuten zuvor betrat er zusammen mit Hoffmann das Steueramt. Die Journalisten von CORRECTIV.Schweiz und der WOZ warten eine Strasse weiter in einem Café.
Warum verdeckt recherchieren?
Der Steuerbeamte empfängt die beiden mit breitem Lächeln und einem Lobgesang auf den Urner Ski- und Luxusort Andermatt. Und den Aufschwung dank des ägyptischen Investors Samih Sawiris. Danach wird es konkret. Beim angegebenen Vermögen von 500 Millionen Franken sei die Pauschalbesteuerung „die sinnvollste Lösung“, sagt der Beamte. Sie biete „Sicherheit und Spielraum für beide Seiten“. Dafür müsse Weiss einen Fragebogen zu seinen Ausgaben ausfüllen: Etwa Unterhalt, Reisen und Hobbys.
„Da kann man aber eintragen, was man will?“, fragt Hoffmann. Gewisse Beträge müssten schon realistisch sein, sagt der Beamte. „Und Sachen, die wir ganz einfach nachweisen können, müssen gut dokumentiert sein, da müssen wir fein raus sein.“ Andere Dinge hingegen seien fast unmöglich zu kontrollieren. „Wenn Sie sagen, Ihre Hobbys kosten 10’000 Franken im Monat – können wir das nicht richtig überprüfen.“
Weiss’ Vermögensberater will es genauer wissen. „Wenn man also 120’000 bis 200’000 Franken Steuern pro Jahr anpeilt, könnten Sie uns sagen, welche Ausgaben wir da angeben müssten?“, fragt Hoffmann den Beamten. „Bei solchen Rechenbeispielen kann ich Ihnen sicher helfen.“ Dies mache die Behörde auch bei anderen Pauschalbesteuerten, sagt der Beamte.
„Ehrlich gesagt, steuern wir zum Teil die Steuerpflichtigen, indem wir sagen, du musst bei diesem Betrag ein bisschen mehr reinschreiben. Nimm dafür unten irgendwo ein bisschen weg, weil das realistisch ist.“ Sie passten die Beiträge so an, wie sie das auch aus anderen Steuerakten kennen würden. „Wir sind hier, ich sage mal, eine Dienstleistungsbehörde, auch wenn wir das eigentlich nicht sein dürften.“
Kennen Sie auch Fälle, in denen vermögenden Personen geholfen wurde, Steuern zu sparen? Dann erzählen Sie uns hier davon. So helfen Sie, weitere Missstände aufzudecken. Ihre Daten sind durch den Quellenschutz geschützt, bleiben völlig anonym und werden keinesfalls an Dritte weitergegeben.
Schweizer Bankkonten bleiben verborgen
Es folgt ein kurzer Exkurs über die Vorzüge des inländischen Bankgeheimnisses. Während die Behörden über Auslandskonten ihrer Bevölkerung informiert würden, blieben Vermögen im Inland weitgehend verborgen, sagt der Beamte. Habe man beispielsweise bei der UBS oder Julius Bär etwas deponiert, flössen diesbezüglich keine Informationen zum Amt. „Konten im Ausland erfahren wir. Konten in der Schweiz nicht. Das ist der grosse Witz an der Sache.“
Das Blöde sei, das Geld liege ziemlich gleichmässig auf drei Banken verteilt, entgegnet Hoffmann. „Wenn wir umschichten und eine Bank vergessen anzugeben, fällt der Betrag auf einem der Konten von 120 Millionen auf 10 Millionen Franken runter – sehen Sie das dann?“
„Wir sehen nur den Stichtag“, sagt der Beamte. Es gelte, was am 31. Dezember deklariert sei. Alles, was davor oder danach passiere, bleibe unsichtbar. „Wenn wir vergessen, eine Bank anzugeben, schützt ihn das Bankgeheimnis?“, fragt Hoffmann nach. „Ja“, antwortet der Beamte. Doch es sei zu bedenken: Wenn ein vergessenes Konto später deklariert werde, gelte das als Steuerhinterziehung.

Mit den Aussagen seines Mitarbeiters konfrontiert, sagt der Urner Steueramts-Vorsteher Pius Imholz gegenüber CORRECTIV.Schweiz und WOZ, „das Steueramt versteht sich im Sinne des modernen Verwaltungsverständnisses durchaus als Dienstleister – jedoch im Rahmen des Gesetzes“. Beim Treffen habe es sich um ein informelles Erstgespräch gehandelt. Die Pauschalbesteuerung erfolge nach klaren gesetzlichen Grundlagen. Die jährlichen Ausgaben würden nach objektiven Kriterien geprüft. „Wer absichtlich unvollständige oder unwahre Angaben macht, wird dafür bestraft.“
Mitarbeitende dürften den Mechanismus der Pauschalbesteuerung zwar anhand von Rechenbeispielen erläutern, seien aber „ausdrücklich nicht befugt, auf eine tiefere Steuerbemessung hinzuwirken“. Das Steueramt lege grossen Wert auf korrekte und gesetzeskonforme Veranlagungen. „Unzulässige Praktiken werden nicht toleriert oder gar empfohlen.“
Dienstleistung für Superreiche „völlig absurd“
Dass auch Steuerbehörden beim Spiel mitmachen, ist für Dominik Gross problematisch, aber nicht überraschend. Er ist Steuer- und Finanzpolitik-Experte beim Kompetenzzentrum für internationale Zusammenarbeit und Entwicklungspolitik, Alliance Sud. „Besonders in kleineren Kantonen gibt es oft keine Abgrenzung zwischen Steuerbeamtinnen und Standortförderern“, sagt er. Das sei wie ein Medienhaus, in dem sich Journalistinnen nicht von Inseratenverkäufern abgrenzen. „Wenn solche zwingenden Abgrenzungen fehlen, fördert das auch die Vetternwirtschaft.“
Die Bezeichnung Dienstleistungs-Behörde als Steueramt sei „völlig absurd“, sagt Gross. „Das Steueramt sollte im Sinne des Gemeinwohls in erster Linie ein Interesse daran haben, alle Steuerzahlenden fair zu besteuern.“ Für den Experten ist es ein Rätsel, was die Behörden davon hätten, wenn Reiche im Kanton wohnen und beinahe keine Steuern zahlen würden.
Doch davon gibt es einige. Eine kürzlich erschienene Auswertung von CORRECTIV.Schweiz und der WOZ zeigt: Rund 3’900 vermögende Pauschalbesteuerte leben in der Schweiz. Im Durchschnitt zahlt jede und jeder von ihnen zwischen 30’000 und 280’000 Franken Steuern im Jahr.
Die Pauschalbesteuerung ist ein wichtiger Grund, warum die Schweiz für Superreiche aus aller Welt so attraktiv ist, heisst es in einer ETH-Studie vom vergangenen Jahr. Für diese Sonderbehandlung wird die Schweiz kritisiert. So etwa in einer Studie der gemeinnützigen Organisation Oxfam zur Steuerflucht in Deutschland 2024.
Als Beispiel nennt sie ein Faktenblatt zur Pauschalbesteuerung aus dem Kanton Uri. Darin steht unter dem Zwischentitel Vorteile: „Die Pauschalbesteuerung wirkt sich positiv für wohlhabende und finanzstarke Personen aus dem Ausland aus“, weil etwa das Ausfüllen von Steuererklärungen wegfalle. Zudem könne die Pauschale einen zusätzlichen Steuervorteil ergeben.
„So preisen einschlägige Broschüren die Schweiz an – nicht zuletzt für potenzielle Steuerflüchtlinge aus Deutschland“, beschreibt das die Oxfam-Studie. Dass die Schweiz attraktiv für deutsche Superreiche ist, zeigt die Liste der 300 Reichsten im Land des Wirtschaftsmagazins Bilanz. Alleine 2023 hatte jede fünfte Person einen deutschen Pass.
Kein Bock mehr auf Deutschland?
Aus einer vermögenden deutschen Unternehmerfamilie stammt auch der vermeintliche Milliardärserbe Elia Weiss. Der Anfang 20-Jährige hat zwar geerbt, jedoch deutlich weniger, als bei den jeweiligen Treffen angegeben. Trotzdem weiss er, mit welcher Hingabe Reiche umworben werden und wie solche Gespräche bei Banken oder Behörden ablaufen.
Statt mit seinem Vermögen in die Schweiz zu ziehen, um von tiefen Steuern zu profitieren, engagiert er sich in Deutschland bei Tax me now. Das ist eine Initiative vermögender Menschen, die höhere Steuern für Reiche fordert. Weiss kennt selbst mehrere, die alles daran setzen, ihre Steuern so niedrig wie möglich zu halten.

„Es gibt ein Steuersystem für die 99 Prozent – und ein anderes für das eine Prozent“, sagt er. Die meisten würden das so hinnehmen. „Aber dass die Reichen ein eigenes Steuersystem haben, ist nicht normal und wir sollten etwas daran ändern.“ Deshalb solle aufgezeigt werden, wie dieses System für die Reichsten funktioniere.
Auf seiner einwöchigen Recherche-Reise durch Banken, Kanzleien und Steuerämter behält Weiss seine wirkliche Meinung für sich. In der Rolle als Milliardärs-Erbe klagt er über Neidkultur und die „feindselige Stimmung“ gegen Reiche in seiner Heimat. Kurz: Deutschland geht den Bach runter. In der Schweiz hingegen, habe er gehört, sei die Welt noch in Ordnung. Hier werde den Wohlhabenden ihr Reichtum gegönnt.
Gstaad als Hotspot der Superreichen
Kaum ein Ort in der Schweiz bemüht sich so eifrig um das Klientel der Superreichen wie Gstaad im Berner Oberland. Laut Recherchen von Bund und Berner Zeitung konzentriert sich nirgends im Land so viel Vermögen auf so engem Raum: Mindestens 50 Milliardärsfamilien besitzen Chalets, Anwesen oder Luxuswohnungen in Gstaad und Umgebung. Darunter DM-Erbe Kevin David Lehmann sowie sein Vater Günther Lehmann, Formel 1-Chef Bernie Ecclestone oder die Pharma-Erben der Familie Sackler, die wegen ihres Medikaments Oxycontin für die Opioid-Krise in den USA mitverantwortlich gemacht werden.
Selbst an einem grauen Septembermorgen verrät die ausgestorbene Promenade von Gstaad, welche Kundschaft sie erwartet. Boutiquen von Louis Vuitton, Hermès oder Prada reihen sich aneinander, darüber hängen ordentlich aufgestellte Geranien vor den penibel gepflegten Holzfassaden. Zwei Touristinnen knipsen Fotos vor dem noch geschlossenen Valentino-Store. Im Schaufenster ist eine bestickte Handtasche ausgestellt. Preis: 9’350 Franken.

Im irisblauen Porsche 911 fahren Elia Weiss und Stefan Hoffmann zu den drei Treffen vor Ort. Im weit offenen weissen Hemd, den schwarzen Blazer lässig über die Schultern geworfen und das lange, lockige Haar, gibt Weiss mühelos den Milliardärserben. Falls die grosse Filmstar-Sonnenbrille als zusätzlicher Beweis nicht reicht, blitzt am Handgelenk eine Rolex im Wert von rund 130’000 Franken.
Die Luxus-Uhr und den Porsche organisierte Hoffmann. Er ist bei der Recherche Türöffner, Schauspieler und Rolex-Lieferant in einer Person. Der frühere Privatbanker verliess nach einer steilen Karriere den „seelenlosen“ Job, wie er selbst sagt. Seither berät er Vermögende, die ihr Geld ethisch anlegen wollen. Zu den Treffen trägt Hoffmann mit Edelsteinen besetzte Dollarzeichen als Manschettenknöpfe und eine rosa Krawatte, auf der der ehemalige US-Notenbankchef Ben Bernanke Geldscheine aus einem Helikopter wirft. Sein Motto: „Ein bisschen Schabernack muss sein.“
Durch die Gespräche mit den Vermögensberatern in Gstaad zieht sich ein spürbarer Eifer, Superreiche zu umwerben. Ein Steuerberater einer privaten Firma schwärmt etwa vom Flughafen in der Nähe, diskreten Clubs für Vermögende sowie „sehr zugänglichen und lösungsorientierten“ Steuerbehörden.

Die verdeckte Recherche von CORRECTIV.Schweiz und der WOZ zeigt ein deutliches Bild: Superreichen aus dem Ausland wird in der Schweiz der rote Teppich ausgerollt. Egal ob Banken, Anwältinnen oder Steuerämter – sie alle verfolgen dasselbe Ziel: den Vermögenden möglichst tiefe Steuern anzubieten.
Dass Reichtum verdient sei, ist für Elia Weiss ein Märchen. In Wahrheit würden fast alle hart arbeiten und ihren Beitrag leisten. Dafür bekämen die meisten viel weniger zurück, sagt er. „Diese Vorstellung, dass Reiche ihre Privilegien verdient hätten, ist absurd. Man muss sich nur anschauen, wie viel das oberste Prozent erbt, um zu sehen, wie ungleich diese Gesellschaft ist.“
Der erste Schritt müsse darin bestehen, die Macht des Vermögens zu brechen. „Heute bestimmen jene, die Vermögen besitzen, letztlich auch über den Kurs unserer Gesellschaft: indem sie Politikerinnen und Politiker finanzieren, ihr Geld investieren oder Lobbyorganisationen unterstützen.“ Vermögen forme so nicht nur das eigene Leben, sondern die soziale Wirklichkeit. „Dieses Ungleichgewicht muss fallen, damit künftig alle gemeinsam über die Zukunft entscheiden können“, sagt Weiss.
In den Kantonen Appenzell Ausserrhoden, beider Basel, Schaffhausen und Zürich haben sich die Stimmberechtigten bereits gegen eine Pauschalbesteuerung durchgesetzt. Laut dem Steuer- und Finanzpolitik-Experten Dominik Gross habe dies nicht geschadet. „Selbst wenn einige Pauschalbesteuerte wegziehen, reisst das kein wirkliches Loch in das Budget, weil sie so tiefe Steuern zahlen.“
Text & Recherche: Sven Niederhäuser, Enrico Kampmann (WOZ), Jan Jirát (WOZ)
Redaktion: Marc Engelhardt
Faktencheck: Janina Bauer
Bilder: Florian Bachmann (WOZ)
Grafik: Sven Niederhäuser, Philipp Waack
Kommunikation: Charlotte Liedtke, Katharina Roche, Luise Lange-Lettellier