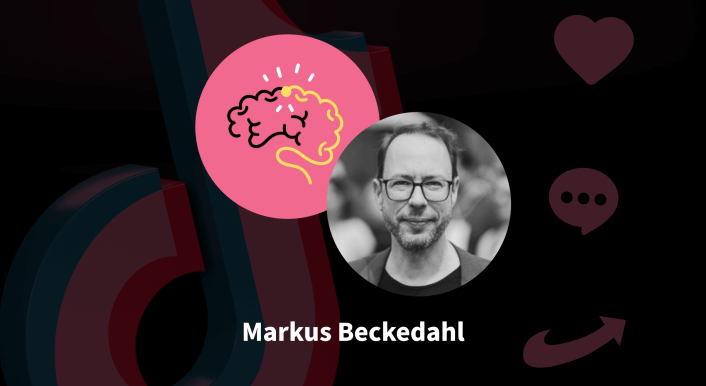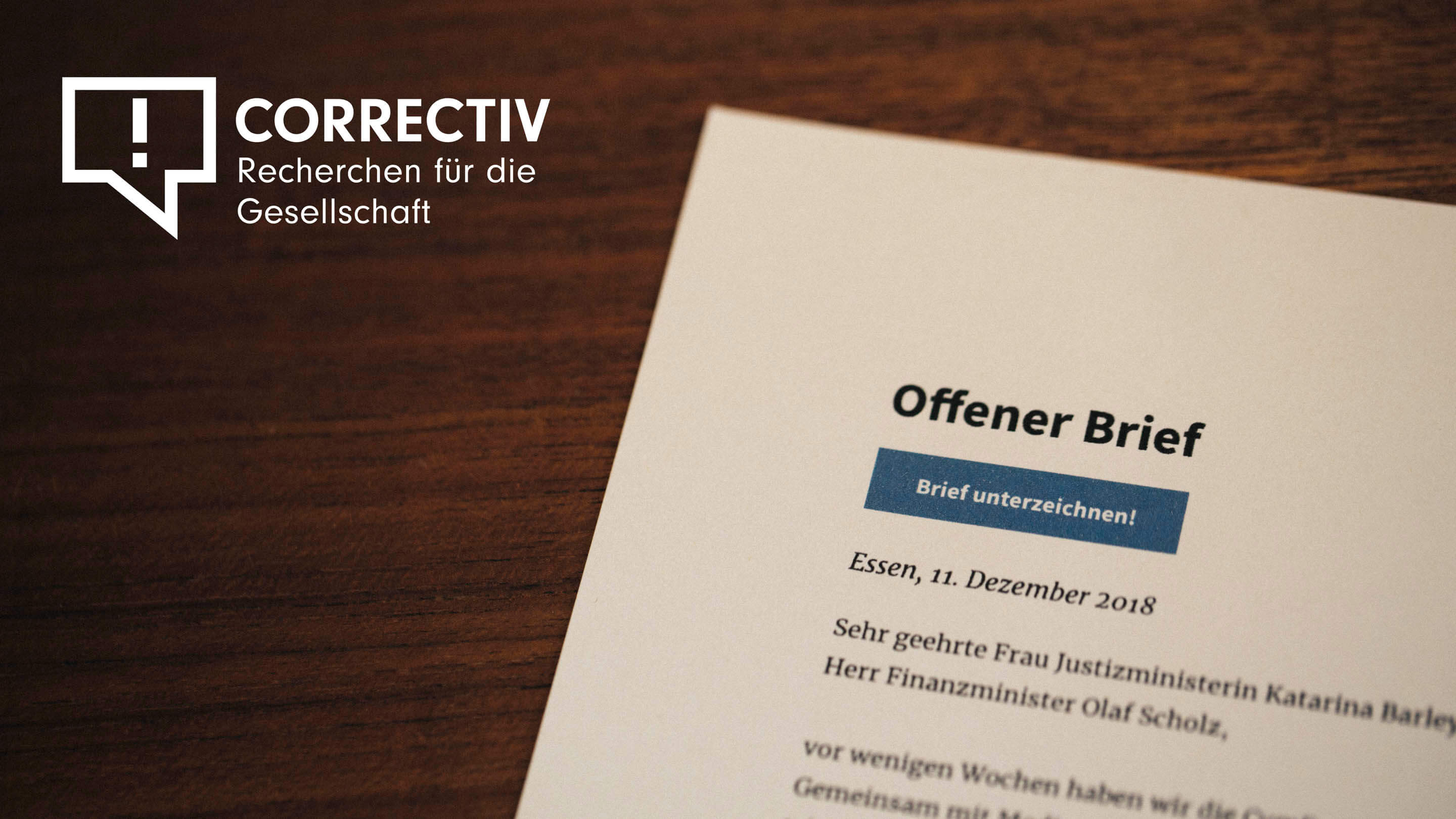Mehr digitale Souveränität wagen
Wir haben es uns in der Digitalisierung sehr gemütlich gemacht. Die meisten Computer in Verwaltungen und Unternehmen laufen auf Windows und nutzen Microsoft-Programme und US-basierte Cloud-Services. Doch das ist gefährlich. Europa muss sich digital unabhängiger machen.

Wir haben es uns in der Digitalisierung sehr gemütlich gemacht. Die meisten Computer in Verwaltungen und Unternehmen laufen auf Windows und nutzen Microsoft-Programme. Immer mehr Daten landen in der Cloud, das sind Netzwerke von Computern, die zusammengeschaltet werden.
Dieser Markt wird von den drei Unternehmen Amazon, Google und Microsoft kontrolliert, die zwei Drittel aller unserer Cloud-Infrastrukturen betreiben.
Europa ist digital zu abhängig
Das bedeutet weniger Wettbewerb, weil diese Unternehmen durch ihre Marktmacht die Regeln und Standards setzen und gleichzeitig soviel Geld verdienen und in den Ausbau stecken können, dass es anderen Unternehmen schwer fällt, Konkurrenzfähig zu sein. Für Kunden bedeutet das wiederum langfristig Abhängigkeit und höhere Preise.
Dazu kommen weitere Regeln, denn diese Unternehmen sitzen alle in den USA. Dort gibt es seit einigen Jahren den US Cloud Act. Dieser erlaubt es Sicherheitsbehörden, auf Cloud-Infrastrukturen von US-Unternehmen und die dort abgelegten Daten zuzugreifen. Auch wenn die Daten und Rechenzentren bei uns liegen. Wir können diesen Infrastrukturen nicht vertrauen.
Bisher redeten sich Unternehmen gerne damit heraus, dass sie zwar die Microsoft-Cloud-Lösung einsetzen. Aber selbstverständlich nur auf deutschen Servern und hier gelte ja die Datenschutzgrundverordnung.
Die US-Regierung sieht das aber anders und beharrt auf ihrem Recht, auch auf Microsoft-Lösungen in Deutschland zugreifen zu dürfen, wenn diese von Unternehmen wie SAP in deren Rechenzentren betrieben werden.
Dazu kommen weitere Herausforderungen. Stellen Sie sich vor, Ihr Computer bekommt keine Updates mehr. Sofort wird er unsicher, denn Updates schließen in der Regel Sicherheitslücken.
Die USA und Donald Trump könnten Sanktionen und Exportbeschränkungen wegen einer diffusen Gefährdung der nationalen Sicherheit erlassen und bestimmen, dass bestimmte Unternehmen, Organisationen oder auch Staaten keine Software mehr geliefert bekommen dürfen. Also auch keine Updates.
Das klang früher immer wie Science-Fiction, weil das ja unsere Freunde waren. In diesem Jahr gab es den Präzedenzfall: Donald Trump erließ Sanktionen gegen den Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofes in Den Haag. Dieser hatte zuvor Ermittlungen gegen Trump-Freund Benjamin Netanyahu eingeleitet, den israelischen Ministerpräsidenten. Die Folge war, dass Microsoft den Zugang zu dem Mailsystem des Chefanklägers kappen musste.
Wen trifft es als nächstes?
Der Fall sorgte für großes Aufsehen und eine große Debatte in den Niederlanden (damit ist gemeint am Gericht in Den Haag, richtig? JA). Vor kurzem wurde bekannt, dass der Internationale Strafgerichtshof infolge dieser Erfahrung auf den Open-Desk wechselt. Das ist eine Lösung, die vom staatlichen Zentrum für Digitale Souveränität (ZenDIS) in Deutschland entwickelt wird.
Open-Desk ist eine Software-Suite, die aus Open-Source-Komponenten aus verschiedenen Unternehmen und Projekten besteht. Der Code ist offen und nachvollziehbar. Wenn man mit einem der beteiligten europäischen Anbieter unzufrieden ist, kann man auch zur Konkurrenz gehen. Das sorgt für Wahlfreiheit, eine größere Unabhängigkeit und man braucht keine Angst vor Donald Trump zu haben.
Lizenzkosten werden nicht in die USA transferiert, sondern damit werden Arbeitsplätze bei uns geschaffen. ZenDIS wurde bisher etwas stiefmütterlich behandelt. Das sieht man immer an den dafür vorgesehenen Ausgaben im Bundeshaushalt. Trotzdem gibt es jetzt eine Software-Lösung, die von Vorreitern wie dem Land Schleswig-Holstein eingesetzt wird. Weitere Akteure folgen dem hoffentlich demnächst.
Denn solche Softwarelösungen sind eine große Chance, um mehr digitale Souveränität zu schaffen und uns unabhängiger von bisherigen marktbeherrschenden Unternehmen zu machen, die wiederum abhängig von Donald Trump sind.
Was jetzt getan werden muss:
Kommende Woche findet der Europäische Gipfel zur digitalen Souveränität in Berlin statt, zu dem Friedrich Merz mit Emmanuel Macron einlädt. Dort sollen diese Herausforderungen und mögliche Lösungsansätze diskutiert werden.
Einen konkreten habe ich hier: Der Staat muss vorausgehen und über eine aktive Beschaffungspolitik Alternativen stärken. Programme und digitale Infrastrukturen von Unternehmen, denen wir vertrauen können. Die unsere Abhängigkeit von Monopolisten verringern, uns mehr Wahlfreiheit verschaffen und unsere Wirtschaft stärken.
Diese Forderung ist nicht neu. Für „Public Money, Public Code“, also dass öffentlich finanzierte Software und Infrastrukturen selbstverständlich auch offen und nachvollziehbar sein müssen, setze ich mich seit Jahrzehnten ein. Neu ist das Bewusstsein bei führenden Politiker:innen, dass wir jetzt ein Problem haben.
Das ist spät, aber besser spät als nie. Jetzt kommt es darauf an, was wir daraus machen. Ein Weiter so geht nicht mehr. Wir bleiben erpressbar. Kommende Woche wird sich zeigen, ob das auch die Bundesregierung verstanden hat.
Wir müssen jetzt handeln, damit wir morgen mehr Wahlfreiheit haben und uns aus der Abhängigkeit befreien können.
Markus Beckedahl ist Pionier für digitale Öffentlichkeit. Er hat das Magazin netzpolitik.org gegründet und ist kuratorischer Leiter der re:publica, der größten Konferenz für digitale Gesellschaft.