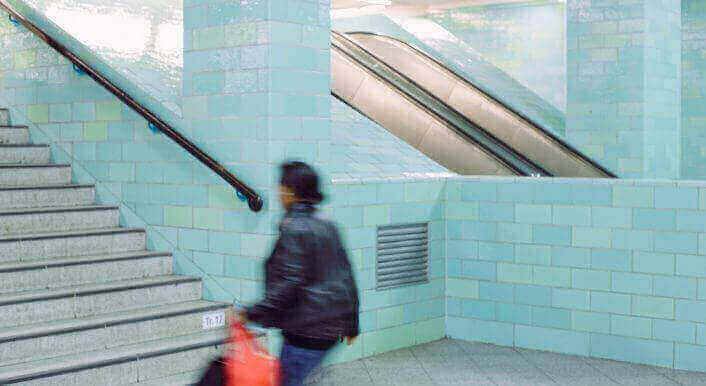Racial Profiling: In neun Monaten hat mich die Berliner Polizei 23 Mal kontrolliert
Seit Silvester in Köln diskutiert ganz Deutschland über Racial Profiling. Doch das Problem ist viel größer als Köln. Nicht nur unsere Reporterin hat es erlebt. Auch internationale Organisationen kritisieren die deutsche Polizei.
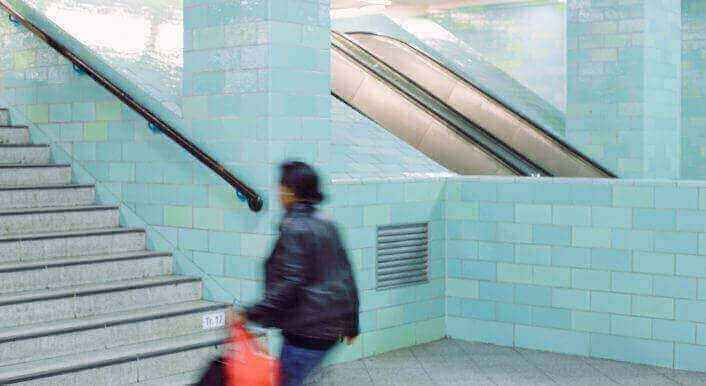
© Ivo Mayr
Es war ein nebliger Morgen im März 2016. Ich war erst einige Tage in Berlin und lag wach bis in die frühen Morgenstunden, weil mich der Jetlag plagte. Irgendwann stand ich genervt auf, zog meine Joggingklamotten an und rannte los, in den benachbarten Mauerpark in Prenzlauer Berg.
Plötzlich hörte ich, wie jemand hinter mir her brüllte. Erschreckt zog ich meine Kopfhörer aus den Ohren, die sich prompt in meinem Stirnband verhedderten. Was war los? Ein Mann kam näher. Erleichtert sah ich, dass es ein Polizist war.
Gut eine Minute lang redete er auf mich ein. Dann merkte er, dass ich kein Deutsch spreche, also fragte er mich auf Englisch: „Was machen Sie hier? Wo kommen Sie her? Kann ich Ihren Ausweis sehen?“
Hatte ich etwas falsch gemacht? Warum wurde ich, kaum in Deutschland angekommen, von der Polizei kontrolliert? Ich sagte ihm, dass ich meinen Ausweis leider nicht dabei habe. Er: „Wo wohnen Sie? Warum sind Sie so früh unterwegs?“
Zufall, dass ausgerechnet ich kontrolliert werde?
Ich erklärte es ihm. Der Polizist ließ es auf sich bewenden, sagte mir, ich solle von jetzt an immer meine Papiere dabei haben, das sei Vorschrift in Deutschland, und zog von dannen. Ich rannte weiter, mein iPod laut. Und wunderte mich über den Zwischenfall. War es Zufall, dass ausgerechnet ich kontrolliert worden war? Gab es eine Vorschrift, das frühmorgendliche Laufen im Park betreffend, die ich nicht kannte? Niemals wäre ich auf die Idee gekommen, dass ich in den Fokus der deutschen Polizei geraten würde – wegen meiner dunklen Hautfarbe.
23 Ausweiskontrollen später bin ich es leid, nach meinen Papieren gefragt zu werden. Nach meiner Herkunft und was ich denn hier mache. Ich ärgere mich über den Polizeibeamten, der mich herauspickt und mich nach meinem Pass fragt, während ich mit einer Gruppe weißer Freunde herumstehe. Ich ärgere mich darüber, dass ich aus der Ruhe eines Spaziergangs am Sonntagmorgen gerissen werde, weil ein Polizist glaubt, meine Identität überprüfen zu müssen.
Diese Kontrollen machen mich wütend, sie verunsichern mich, ich fühle mich von ihnen gedemütigt. Längst frage ich mich: Wen sehen die Leute, wenn sie mich sehen? Eine „dunkle“ Person, die aus irgendeinem Grund verdächtig wirkt? Aus welchem Grund? Was traut man mir zu? Und warum? Jedes Mal, wenn ich kontrolliert werde, frage ich mich, warum ich herausgepickt wurde. Was trage ich, dass ich nicht tragen soll? Was habe ich getan, dass mich verdächtig gemacht hat? Warum ich?
Natürlich weiß ich, dass diese Fragen überflüssig sind. Ich werde kontrolliert wegen meiner dunklen Hautfarbe.
Wenn ich den Polizeibeamten dann meinen Pass zeige, scheinen sie stets überrascht, dass ich aus den USA stamme. Und nicht aus Indien, dem Land meiner Eltern. Ich finde das beleidigend. Wie kommt es, dass die Polizisten in einer europäischen Metropole solche provinziellen Stereotype mit sich herumtragen?
Ein Gefühl der Unsicherheit
Ich frage mich: Ist den Beamten klar, was sie da tun, wenn sie regelmäßig mich – und ganz gewiss auch andere Menschen dunkler Herkunft – herauspicken, um sie zu kontrollieren? Ist ihnen klar, dass sie jedes Mal, wenn sie mich oder oder andere „People of Color“ anhalten, uns mit jenen rassistischen Stereotypen konfrontieren, denen wir ohnehin Tag für Tag ausgesetzt sind?
Wenn diese Kontrollen schon mich so verzweifelt und hoffnungslos machen – wie mögen sich dann erst die Flüchtlinge fühlen, die sich in Deutschland aufhalten? Viele wurden mit offenen Armen empfangen, sie dachten, sie seien nun an einem sicheren Ort, in einem Land, in dem sie respektiert werden. Und nun werden sie aufgrund ihrer Hautfarbe für Kontrollen selektiert. Mich beunruhigt das. Ein Vater zweier Kinder erzählte mir, Polizisten hätten ihn gefragt, ob das seine Kinder seien – weil die beiden Kleinen, so die Beamten, „mehr weiß als schwarz aussehen“.
Ich spreche kein Deutsch, ich weiß nicht, was meine Rechte in Deutschland sind. Ich weiß nur, dass mir die Kontrollen ein Gefühl der Unsicherheit vermitteln. Wie sicher bin ich hier – wenn ich so oft gezielt ausgewählt werde, um mich zu identifizieren? Es will mir nicht in den Kopf, wie „People of Color“ der Polizei in Deutschland vertrauen sollen, wenn die in ihnen in einem fort mögliche Missetäter sieht.
Wie soll ich der Polizei vertrauen?
Auch in den USA gibt es rassistische Tendenzen innerhalb der Polizei. Ich kenne dort viele „People of Color“, die jegliches Vertrauen in die Polizei verloren haben. Die nicht wissen, an wen sie sich wenden sollen, wenn sie Opfer eines Verbrechens geworden sind. So ähnlich fühle ich mich in Deutschland. Könnte ich der Polizei vertrauen, wenn ich Opfer eines Verbrechens würde? Wie soll ich Beamten vertrauen, die mir wiederholt das Gefühl gegeben haben, mit mir stimme etwas nicht? Sie misstrauen mir. Also vertraue ich ihnen nicht länger.
Ich habe meinen Kollegen bei CORRECTIV – in der Mehrzahl weiß und männlich – von den Ausweiskontrollen erzählt. Sie waren geschockt. Sie konnten sich nicht vorstellen, dass es so etwas in Deutschland gibt. Ich sprach mit den Organisatoren meines Stipendiums, der Knight-Mozilla-OpenNews-Stiftung. Auch sie waren schockiert: Meine beiden Vorgänger in Berlin waren hellhäutig und hatten diese Erfahrung nicht gemacht. Und auch meine neuen Bekannten in Berlin – solche mit dunkler Hautfarbe –waren überrascht. Allerdings aus einem anderen Grund: Normalerweise, sagten sie, würde afroamerikanische Männer die ständigen ID-Checks über sich ergehen lassen müssen. Dass jetzt auch „Women of Color“ in den Blick der Polizei geraten, war ihnen neu.
Meine Eltern sind in den 1970er Jahren aus Indien in die USA eingewandert. Ich wuchs in einer ethnisch bunt gemischten Gegend in New Jersey auf, südlich von New York. Ich bin es gewohnt, dass man sich über mich lustig macht, weil ich wohl das bin, was man einen „geek“ nennt, einen Computerfreak. Man lachte über mich, weil ich eine Brille trug, weil ich mein Haar zu kleinen Zöpfen flocht oder mittags Idlis aß, gedämpfte Teigfladen. Ich bezog diese Kommentare aber stets auf mich, meine Person – nicht auf meine Herkunft. Im Rückblick war das natürlich naiv. Aber ich scherte mich einfach nicht viel darum, was die Leute über mich sagten. Sah ich „amerikanisch“ aus? Oder „indisch“? Als Schülerin habe ich nie darüber nachgedacht.
Alltäglicher Rassismus in den USA
Das änderte sich, als ich aufs College ging, in Athens, Ohio. Eine winzige Universitätsstadt im Herzen der Appalachen, dem Mittelgebirge im Osten der USA. Ich war dort eine der wenigen Studentinnen indischer Herkunft. Eine meiner ersten Erinnerungen: Wie eine Frau von der Uni-Verwaltung langsam und sehr betont zu mir sprach – bis ich sie etwas fragte und sie hörte, dass ich Amerikanerin bin. Ab da redete sie in normalem Tempo mit mir.
Als ich für das Campus-Fernsehen arbeitete, riet mir einer der Ausbilder, vor künftigen Auftritten mehr und helleres Puder zu verwenden. Weil das Studiolicht ansonsten nicht hell genug sei. Wegen meiner dunklen Haut. Er sagte es vor allen anderen. Ich hörte das, was er tatsächlich sagen wollte: Dass „People of Color“ wie ich nicht ins Fernsehen gehören. Bis dahin war einer meiner größten Träume gewesen, eines Tages bei einem großen TV-Sender als Reporter zu arbeiten. Ab da hatte ich Zweifel.
Aber das war noch nicht alles. Der Mann regte wenig später an, ich solle erwägen, mir einen Namen zuzulegen, der „leichter auszusprechen“ sei. Das war der zweite Schlag in die Magengrube. Sollte ich wirklich Journalistin werden?
Einmal näherte ich mich als Reporterin einem Grundstück, als dessen Besitzer seine Waffe zog und schrie: „Du gehörst nicht hierher!“ Wenn ich einfache Leute auf der Straße oder in Trailer Parks interviewte, hörte ich: „Ich spreche deine Sprache nicht, Schätzchen, probier’s erst gar nicht.“ Oder: „Ich spreche kein Hindu, sorry.“
Es war nicht wichtig, dass ich US-Bürgerin bin. Wichtig war, dass ich einen seltsamen Namen hatte, den sie nicht aussprechen konnten. Dass ich nicht aussah wie „eine Amerikanerin“. Zuerst war ich wütend auf diese Leute. Doch dann taten sie mir leid, weil sie nichts anderes kannten als ihre kleine, weiße Welt. Taten mir leid, weil sie zu ungebildet sind, um den Unterschied zwischen „Hindi“ und „Hindu“ zu kennen.
Staatliche Autoritäten klagen mich an
Als ich nach Deutschland kam, wusste ich also, was Rassismus ist. Und doch war es anders. Hier geht es nicht um rassistische Aussagen. Hier werde ich befragt – von der Polizei. Ich finde mich plötzlich in einer Situation wieder, wo mir ausgerechnet jene ein Gefühl von Unsicherheit vermitteln, denen ich vertrauen soll – die staatlichen Autoritäten. Jede Befragung durch die Polizei, aus dem Nichts heraus, so kurz sie auch ist, erzeugt bei mir das Gefühl, ich sei angeklagt, ich habe etwas falsch gemacht.
Nun bin ich Journalistin – und beschloss, dem Thema nachzugehen. Als erstes fragte ich mich: Welche Informationen hat der Staat über mich gesammelt? Was notieren die Polizisten in ihren Notizbüchern, wenn sie mich befragen?
Den Deutschen, das hatte ich inzwischen gelernt, ist ihr Datenschutz heilig. Jeder kann fragen, was der Staat über ihn oder sie gespeichert hat. Ich schickte den entsprechenden Antrag ab – und erhielt wenig später ein Schreiben. Nein, man habe nichts über mich gespeichert.
Als nächstes fragte ich bei der Berliner Polizei nach, ob es Personenkontrollen aufgrund von Aussehen oder Herkunft gebe. Die Antwort: Nein, solches „Racial Profiling“ gebe es nicht, das sei verboten, und man mache nichts Verbotenes. Man sammle nur Informationen, die bei Razzien an „Kriminalitätsbelasteten Orten“ anfallen – in Gegenden, in den besonders viele oder besonders schwere Straftaten begangen werden. Ich bat um eine Liste dieser gefährlichen Orte. Und erfuhr, dass die Liste geheim ist. Weil man die polizeiliche Arbeit nicht gefährden wolle.
Ich habe mit verschiedenen Organisationen über meine Erlebnisse gesprochen: Mit den Vereinten Nationen, mit Amnesty International, mit der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Alle drängten darauf, dass Deutschland sich endlich mit dieser Art von Rassismus beschäftigen und die Arbeit der Polizei stärker untersuchen sollte. Alle Gesprächspartner warfen der Polizei rassistische Tendenzen vor – und dass sie Menschen mit Migrationshintergrund vermehrt prüfe. Auch in Brüssel bei der EU wird das Problem längst diskutiert. Die Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz empfiehlt Deutschland, Racial Profiling gesetzlich zu verbieten.
Racial Profiling ist illegal
Deutsche Gerichte haben in den vergangenen Jahren mehrfach zum Thema Racial Profiling entschieden. So urteilte zum Beispiel das Oberverwaltungsgericht Koblenz im April 2016, dass Racial Profiling in Deutschland illegal ist. Beamte der Bundespolizei hatten Ausweise einer dunkelhäutigen Familie mit zwei Kindern, fünf und eineinhalb Jahre alt, in einem Regionalzug zwischen Mainz und Koblenz kontrolliert. Kein anderer Fahrgast musste seine Ausweise zeigen.
Die Richter machte in seinem Urteil deutlich: Menschen dürfen nicht wegen ihrer Hautfarbe kontrolliert werden. Die Polizei muss bei ihren Kontrollen belegen, dass sie einen konkreten Verdacht hat. Die Bundespolizei hatte sich darauf berufen, die Familie kontrolliert zu haben, um zu prüfen, ob sie illegal nach Deutschland eingereist ist. Solch einen vagen Verdacht ließ das Gericht nicht gelten. Der Schutz vor Diskriminierung wiege schwerer.
Sven Adam war einer der Anwälte hinter diesem Verfahren. Derzeit, sagt Adam mir am Telefon, lägen etwa zehn verschiedene Klagen wegen Racial Profiling bei verschiedenen Verwaltungsgerichten in Deutschland. Adam sagt, die Polizei rechtfertige sich häufig damit, dass die kontrollierten Personen auffällig aus dem Fenster geschaut oder den Bahnhof zu schnell verlassen hätten. Vor Gericht könnten diese Behauptungen aber oft nicht belegt werden.
In meiner Recherche habe ich immer wieder den Ratschlag bekommen, dass die Polizei jede Kontrolle erfassen sollte, um am Ende des Jahres nachvollziehen zu können, wie viele Menschen sie gestoppt hat. Das würde es möglich machen, über diese Kontrollen zu sprechen – und darüber zu diskutieren, ob sie nötig sind.
16 E-Mails an die Landespolizeien
Was sagt die Polizei selbst zum Thema Racial Profiling? Ich wollte es genau wissen und habe Emails an die Polizei in allen 16 Bundesländern geschrieben. Ich habe allen die gleichen Fragen gestellt: Gibt es bei Ihnen Racial Profiling? Sammeln Sie Daten zu den von Ihnen kontrollierten Personen? Welche Art von Fortbildungen bekommen Polizisten auf diesem Gebiet?
Außer Mecklenburg-Vorpommern haben mir alle geantwortet. Die Antworten ähneln sich: Es gibt kein Racial Profiling, weil es illegal ist. Und in der Ausbildung sprechen die Länder mit ihren Polizisten genau über die rechtlichen Grenzen. Viele Polizei-Pressesprecher betonten außerdem, dass sie auch Polizisten mit Migrationshintergrund einstellen. Das helfe ihnen dabei, diese Probleme sensibel anzugehen. Einige Polizeidienststellen haben gesonderte Beamte, die sich um interkulturelle Kompetenz und Diversität kümmern sollen. Und die Polizei Bremen hat sogar extra eine Konferenz organisiert, die sich mit „Ethnic Profiling“ beschäftigt hat.
Alle Bundesländer schrieben mir, sie hätten spezielle Abläufe, um Beschwerden über Racial Profiling zu bearbeiten. Als ich die Pressesprecher jedoch nach der Anzahl der Beschwerden fragte, weigerten sich alle, mir nähere Details oder Zahlen zu nennen.
Keine blonden, deutsch Aussehenden
Ich traf Thomas Neuendorf, einen der Sprecher der Berliner Polizei, und erzählte ihm, wie oft ich schon kontrolliert worden sei. Auch er war schockiert – und entschuldigte sich im Namen seiner Behörde. Gewöhnlich, sagte er, würden vor allem Männer – gleichweder Herkunft – kontrolliert, und nicht Frauen. Die Ausweiskontrollen, denen ich unterzogen wurde, sagte er, seien wohl illegal; sie seien nur in Gegenden erlaubt, in denen es einen konkreten Tatverdacht gebe. Er versicherte mir, die Polizei mache Personenkontrollen nur bei „Leuten, die verdächtig aussehen“, etwa, weil jemand so aussehe wie eine Person, nach der gerade gefahndet werde.
Und fügte hinzu: Suche man nach einem südländisch aussehenden Verdächtigen, würde man natürlich nur solche Leute kontrollieren. Und nicht einen „blonden, deutsch Aussehenden“.
Ich schreckte auf. Ein „deutsch Aussehender“ – wer mag das sein? Wer definiert, ob jemand deutsch oder australisch oder amerikanisch oder indisch aussieht? Wenn sogar der Berliner Polizeisprecher so redet – was kann man dann von gewöhnlichen Beamten erwarten?
Ich hakte telefonisch bei Thomas Neuendorf nach – was denn ein „deutsch Aussehender“ sei. Er ruderte zurück und sagte, er habe die falschen Worte gebraucht. Dieser Satz sei nicht das, was er eigentlich meint.
Ich habe meine Zweifel
Ich bin nicht die Einzige, die Fragen hat. Im August stellte Hakan Taş von der Fraktion der LINKEN im Berliner Abgeordnetenhaus eine schriftliche Anfrage, in der er die Vorwürfe von UN, von Amnesty International und der Europäischen Kommission gegen Rassismus und Intoleranz von deutschen und Berliner Polizisten referierte. Er bezog sich dabei auch auf einen Filmbeitrag über Rassismus in der Polizei, den das WDR-Politmagazin Monitor in diesem Sommer gezeigt hatte. Gibt es „Racial Profiling“ bei der Berliner Polizei? Gibt es „rassistisch diskriminierende Handlungen von Beamten der Strafverfolgungsbehörden“?
Nein. Gebe es nicht. Die Antwort der Berliner Landesregierung entsprach genau dem, was auch ich gehört hatte. Verstärkte Kontrollen von Menschen anderer Herkunft oder anderen Aussehens gebe es nicht. Und wenn doch, dann seien es bedauerliche Einzelfälle, die geahndet werden. Racial Profiling bei der Berliner Polizei? Niemals.
Ich habe meine Zweifel. Ich habe es anders erlebt. Und ich bin nicht die einzige.
Wenn Du wegen Deines Aussehens überdurchschnittlich oft von der Polizei kontrolliert wirst, dann interessiert mich Deine Geschichte. Hier ist meine Umfrage. Du kannst sie auch unter bit.ly/polizeikontrollen verbreiten. Dieses Stück ist eine Übersetzung aus dem Englischen. Wir veröffentlichen den Beitrag in Kooperation mit dem amerikanischen Medium vox.com in einer ähnlichen Version auch auf Englisch. Unsere englische Umfrage findest Du hier.