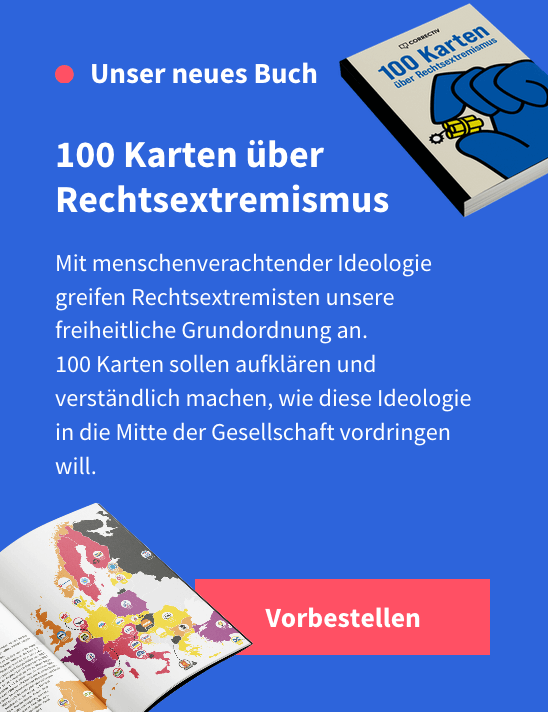Anette Dowideit
stellvertretende Chefredakteurin
Liebe Leserinnen und Leser,
der Friedensnobelpreis geht in diesem Jahr an die japanische Organisation Nihon Hidankyo, die sich für die Abschaffung von Atomwaffen einsetzt. Auch, wenn dieser Preisträger wahrscheinlich für alle nachvollziehbar ist: Selten zuvor war die Vergabe im Vorfeld so umstritten – im Thema des Tages geht es um den heiklen Preis und was hinter der Debatte steckt.
Ich möchte mich bei Ihnen für die vielen klugen Gedanken und Anregungen diese Woche bedanken. Seit gestern haben mir etwa 50 von Ihnen zur gestrigen Frage geschrieben, wie man den Klimawandel wieder mehr ins öffentliche Bewusstsein heben kann. Die Auswertungen lesen Sie kommende Woche in der „Werkbank“. Danke auch für die Informationen, die Sie unserem Reporter Finn Schöneck zu Medikamentenknappheiten geschickt haben. Er geht diesen Hinweisen jetzt nach, wir halten Sie auf dem Laufenden.
Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende – und schreiben Sie mir wie immer mit allem, was Sie bewegt: anette.dowideit@correctiv.org.
Thema des Tages: Die schwierige Nobelpreisfrage
Der Tag auf einen Blick: Das Wichtigste
Leserfrage der Woche: Ungleichbehandlung von Personen, die Sitztoiletten benutzen müssen
Faktencheck: Seltene Wolkenformation statt Hurrikan „Milton“
Gute Sache(n): Erklärt: Warum Menschen mit Behinderung nur 1,35 Euro pro Stunde bekommen • Soziale Klimakipppunkte • Komet am Nachthimmel
CORRECTIV-Werkbank: Klimafreundliches Generationenkapital?
Grafik des Tages: Was ist wahrscheinlicher: Lottogewinn oder Blitzeinschlag?
Hidon Nidankyo aus Japan ist eine Organisation, die Überlebende der Atombombenangriffe auf Hiroshima und Nagasaki im Zweiten Weltkrieg gegründet haben – und sich für die Abschaffung von Atomwaffen einsetzt. Das Nobelpreiskomitee verkündete heute Vormittag unter anderem auf dem Kurznachrichtendienst X), dass die Organisation den diesjährigen Friedensnobelpreis erhält.
Für das Komitee ist das insofern ein kluger Schachzug, als dass sich auf diesen Gewinner wohl alle irgendwie einigen können. Denn die Vergabe des Friedensnobelpreises ist in jedem Jahr eine heikle Sache – das Komitee trifft mit der Vergabe unweigerlich immer eine politische Aussage. Und in diesem Jahr wurde im Vorfeld noch heftiger diskutiert als sonst. Was dazu wichtig zu wissen ist:
Warum die Preisvergabe diesmal so umstritten war:
Viele in Politik und Medien stellten die Frage, ob man in Zeiten besonders vieler kriegerischer Auseinandersetzungen weltweit – Ukrainekrieg, immer weiter eskalierende Spannungen im Nahen Osten etc. – überhaupt einen Preisträger finden werde, der nicht extrem polarisieren würde. Ein Beispiel: der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. Er hatte laut Wettbüros (ja, man kann Geld auf die Vergabe setzen) als ein wahrscheinlicher Kandidat gegolten. Übelmeinende Kritiker hätten im Falle seiner Auszeichnung argumentieren können, Selenskyi sei aber doch niemand, der für Frieden stehe (was ich persönlich ganz anders sehe).
Was dahinter steht:
Das Beispiel soll zeigen: Als Vergabekomitee setzt man sich fast immer in die Nesseln. Was „Frieden“ ist und wie man ihn herbeiführt, darauf gibt es nun mal keine einfachen Antworten.
Übrigens kann der Preis nicht im Nachhinein aberkannt werden. Das wurde zum Beispiel zum Problem, als 1991 Aung San Su Kyi den Preis bekam, die bekannte Oppositionspolitikerin aus Myanmar. Später ermittelte der Internationale Gerichtshof für Menschenrechte gegen sie – wegen des Vorwurfs des Völkermordes an den Rohingya.Wegen all dieser Fallstricke werden am Ende meistens harmlose Kandidaten ausgezeichnet, an denen sich niemand so richtig reibt.
Wer noch nominiert war:
Die Liste wird nicht veröffentlicht. Das Nobelpreis-Komittee teilt lediglich mit, wie viele Nominierte es gab: 286 Kandidatinnen und Kandidaten. In den Medien war darüber spekuliert worden, ob dieses Jahr etwa das UN-Palästinenser-Hilfswerk UNRWA oder UN-Generalsekretär António Guterres ausgezeichnet werden könnten. Auch alles heikle Kandidaten.
Wer viel zu selten ausgezeichnet wird:
Menschen oder Organisationen, die versuchen, die Klimakatastrophe zu stoppen (um unser Thema von gestern noch mal aufzugreifen). Dabei ist diese eine der wichtigsten Ursachen für kriegerische Auseinandersetzungen weltweit. Nur ein einziges Mal wurde eine Person beziehungsweise Organisation für ihren Kampf ums Klima bedacht: 2007 war das, der Preis ging an Al Gore und den Weltklimarat.
Selenskyj für Treffen mit Scholz in Berlin
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj traf sich am Nachmittag mit Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in der Hauptstadt. Bei Gesprächen mit anderen europäischen Regierungschefs ging es um weitere Unterstützung für die Ukraine im Krieg gegen Russland noch vor dem Winter.
zdf.de
Öltanker brennt vor deutscher Ostseeküste
Am Morgen ist ein mit 640 Tonnen Öl beladener Tanker zwischen Kühlungsborn und Warnemünde auf der Ostsee in Brand geraten. Einsatzkräfte aus mehreren Städten sind an den Löscharbeiten beteiligt – inzwischen wurde der Tanker in den Rostocker Hafen geschleppt.
tagesschau.de
Saarbrücken: Fünf Männer wegen Überfall und Entführung nach EM-Spiel festgenommen
Nach einem EM-Eröffnungsspiel Mitte Juni wurde ein 21-Jähriger in Saarbrücken verfolgt, geschlagen, entführt und bedroht. Fünf Männer wurden am Mittwoch festgenommen. Sie lauerten dem Saarbrücker auf, um Geld aus seinen Krypto-Konten zu erpressen.
sr.de
Reeder wegen illegaler Schiff-Entsorgung vor Gericht
Zwei Reeder müssen sich wegen der illegalen Entsorgung eines Schrott-Schiffes in Indien vor Gericht verantworten. Nach Recherchen von NDR und Süddeutscher Zeitung ist die Verschiffung nach Südasien bei Reedereien eine beliebte Methode, den Sondermüll loszuwerden. Zum ersten Mal wird in Deutschland ein solcher Fall vor Gericht verhandelt.
ndr.de

Leserin Petra N. hat uns gefragt:
Stimmt es, dass Deutschland Geld dafür bezahlt, damit andere Länder den überschüssigen Strom aus den nachhaltigen Energiequellen Wind und Solar abnehmen?
Die Antwort ist: nein. Der Handel mit Strom funktioniert grundsätzlich nur über den Preis.
Alle europäischen Länder sind über den europäischen Stromhandel miteinander verbunden: Stromversorger kaufen an der Europäischen Strombörse (EEX) ihre Energie bei den Produzenten ein. Wichtig ist: Das günstigste Angebot wird als erstes eingekauft. Das kann, je nach Wetter und Angebotslage, mal Windkraft aus Dänemark, mal Atomkraft aus Frankreich und mal Solarstrom aus Deutschland sein.
Zunehmend sind Erneuerbare Energien die günstigste Quelle. Das Fraunhofer Institut belegt diesen wilden Handel auf seinen Energy-Charts. Ein Kreisdiagramm zum schwindelig werden. Aber es zeigt, wie sehr der Strom hin -und hergedealt wird, zu jeder Zeit, und zwischen allen EU-Ländern und Energieformen.
Deswegen fällt die Bilanz auch jedes Jahr anders aus: 2023 hat Deutschland fast keinen Strom zugekauft, im ersten Halbjahr 2024 waren es wenige Prozent. Der eingekaufte Strom kam interessanterweise vor allem von Wind- und Solarkraft aus Skandinavien. Deutscher Braun-und Steinkohlestrom hingegen ist auf der EEX meist sehr viel teurer als die nachhaltigen Quellen.
Dass sich in vielen politischen und Online-Diskussionen hartnäckig das Vorurteil hält, Deutschland müsse ständig französischen Atomstrom nutzen, hat einen Grund: Das statistische Bundesamt und auch statista.de legen in ihren Graphen eine falsche Lesart nahe. Diese zeigen häufig Stromflüsse, also den Transport, der von Frankreich über Deutschland in andere Länder führen kann – nicht aber den tatsächlichen Stromeinkauf. Beispielsweise fließt der französische Strom durch deutsche Leitungen, wird aber über die Schweiz nach Italien geführt.
Der Irrtum ist so grundlegend, als würde französischer Champagner über deutsche Straßen nach Italien transportiert und in dortigen Ristoranti getrunken – und dann dem deutschen Alkoholkonsum zugerechnet.

Ein Tiktok-Video, das angeblich Hurrikan „Milton“ vor der Küste Floridas zeigt, sammelt hunderttausende Aufrufe. Der Hurrikan richtet verheerende Schäden an, doch diese Aufnahme zeigt etwas anderes. Sie entstand schon im Jahr 2021.
CORRECTIV.Faktencheck
Endlich verständlich
Während der Mindestlohn in Deutschland bei 12,41 Euro liegt, verdienen Menschen mit Behinderung mit durchschnittlich 1,35 Euro nur einen Bruchteil davon – Initiativen setzen sich für gerechtere Bezahlung ein. Der Artikel von Deutschlandfunk Nova erklärt, warum die Bezahlung so gering ist und es in Deutschland an barrierefreien Arbeitsplätzen mangelt.
deutschlandfunknova.de
So geht’s auch
Kipppunkte sind kleine Veränderungen, die das Klima in großem Maße verändern, zum Beispiel der schrumpfende Regenwald. Aber es gibt auch (soziale) Kipppunkte, die positive Veränderungen nach sich ziehen. Wie viele Menschen es in der Gesellschaft braucht, um diese Veränderungen anzustoßen, erfahren Sie im Beitrag unserer Jugendredaktion Salon5.
Salon 5 (Instagram)
FundstückNachdem in der letzten Nacht Polarlichter in Deutschland beobachtet werden konnten, kommt es ab diesem Wochenende zu einem weiteren Phänomen am Nachthimmel. Der Komet C/2023 A3 bewegt sich gen Sonne und ist mit bloßem Auge sichtbar.
stern.de
Elena Kolb
Reporterin
Mit Leserinnen und Lesern ins Gespräch kommen – darüber freue ich mich immer ganz besonders. Viel zu oft drücken Journalistinnen allein im Büro auf „Veröffentlichen“ und widmen sich dann der nächsten Geschichte.
Das wird vor allem meinem aktuellen Thema nicht gerecht – dem Generationenkapital. Denn es betrifft uns alle und wir müssen wirklich darüber reden. Die Regierung möchte die Renten der zukünftigen Generationen stützen und dafür 200 Milliarden im Namen von uns allen am Kapitalmarkt anlegen.
Doch wie klima(un)freundlich wird das Geld angelegt? Über diese Frage diskutierten wir gestern Abend mit Vertretern und Vertreterinnen aus der Politik im Kino Zoopalast in Berlin. Die Nichtregierungsorganisation Fossil Free Berlin hatte die Veranstaltung organisiert – ich durfte moderieren.
Besonders freute mich, dass die Fragen aus dem Publikum nicht abrissen. Der Tenor war ziemlich eindeutig: Wieso ist es nicht sowieso klar, dass der deutsche Staat Investitionen in Kohle, Öl und Gas ausschließt?
So klar sieht das aber die Politik überhaupt nicht. Bislang wurden im Gesetzesentwurf noch keine Ausschlüsse festgelegt. Die Gespräche dazu laufen gerade noch auf Hochtouren. Eins ist sicher: Ich schaue weiterhin ganz genau für Sie hin.
An der heutigen Ausgabe haben mitgewirkt: Till Eckert, Bianca Poersch, Elena Schipfer, Finn Schöneck
CORRECTIV ist spendenfinanziert
CORRECTIV ist das erste spendenfinanzierte Medium in Deutschland. Als vielfach ausgezeichnete Redaktion stehen wir für investigativen Journalismus. Wir lösen öffentliche Debatten aus, arbeiten mit Bürgerinnen und Bürgern an unseren Recherchen und fördern die Gesellschaft mit unseren Bildungsprogrammen.