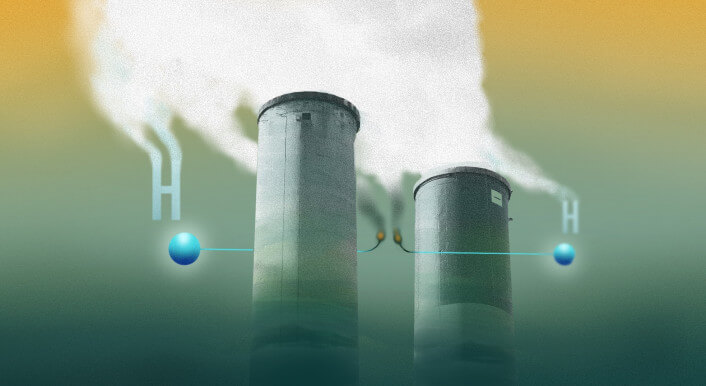Falsche Wasserstoff-Versprechen
Die Gaslobby preist Heizungen an, die irgendwann mit Wasserstoff laufen sollen. Doch immer mehr Fachleute zweifeln am Erfolg: Der grüne Wasserstoff fehlt und würde für Privathaushalte viel zu teuer sein.

Lennart Feldmann benötigt weniger als eine Stunde, um die Heizung der Zukunft zu erklären. „Ich zeige ihnen nüchtern die Zahlen und dann verstehen alle: Eine Wärmepumpe oder Fernwärme ist auch in der Zukunft sicher – dass wir in den kommenden 20 Jahren privat mit Wasserstoff heizen, ist ein Märchen“, sagt der Energieberater. Feldmann prophezeit, dass es weder Leitungen für Wasserstoff in Wohnvierteln geben, noch dass das grüne Gas ausreichend verfügbar sein wird. Feldmann ist im Vorstand der GIH, dem Bundesverband der Energieberater. Er weiß: Nach rund 680.000 Energieberatungen im Jahr 2024 setzt kaum jemand in Deutschland auf Wasserstoffheizungen.
So wie er sehen auch andere Fachleute keine Zukunft für Wasserstoff in Heizungen für Privathaushalte. Selbst CDU-Wirtschaftsministerin Katherina Reiche äußerte in einer aktuellen Pressekonferenz grundsätzliche Zweifel an dieser Energieform. „Grüner Wasserstoff ist bislang nicht wettbewerbsfähig”, sagte Reiche da. Wasserstoff in großen Mengen zu produzieren, sei heute „leider kompliziert“. Dabei setzte sich Reiche – wie viele CDUler – lange Zeit für Wasserstoffheizungen ein.
„Viel zu teuer und ineffizient“, sagt ein ehemaliger leitender Mitarbeiter aus dem Wirtschaftsministerium.
„Der grüne Wasserstoff wird für die Industrie benötigt und sollte nicht in Gasheizungen verschwendet werden“, sagt eine Energieökonomin.
„Für Privatkundinnen wird Wasserstoff als Energieträger in absehbarer Zeit in München keine Rolle spielen“, heißt es von den Stadtwerken München.
Lobby: Gasindustrie will Wasserstoff – Kosten tragen Mieter
Grüner Wasserstoff wird gern als Lösung für die Energiewende angepriesen – vor allem von der Erdgasindustrie, die darauf hofft, ihre Netze künftig für Wasserstoff umstellen und weiternutzen zu können. Für sie bietet das Wasserstoff-Versprechen die Möglichkeit, auch künftig fossiles Erdgas zu verkaufen – und auf eine vermeintlich klimafreundliche und günstige Lösung in einer fernen Zukunft zu verweisen. Für die Kundinnen und Kunden bedeutet es hingegen eine höhere Heizungsrechnung.
Die bislang größten Profiteure sind die Stadtwerke: Mehr als 50 Prozent ihrer Kundinnen und Kunden haben zuhause eine Erdgasheizung. Die kommunalen Werke hoffen, diese Kundschaft mit Wasserstoff ködern zu können, damit sie so lange wie möglich mit ihrer bestehenden Gasinfrastruktur bleibt. In einer aktuellen Anfrage von CORRECTIV prophezeit der Verband kommunaler Unternehmen (VKU), dass Deutschland in Zukunft mit bis zu „20 Prozent mit Wasserstoff, grünen Gasen oder aber Pellets“ heizt.
Ein Grund für das Lobbying des Stadtwerke-Verbandes – auch wenn einige seiner Mitglieder Wasserstoff schon längst nicht mehr propagieren: Alternative Wärmepumpen nutzen neben grünem Strom auch die Umgebungswärme aus dem Boden oder Luft – Stadtwerke können damit deutlich weniger verdienen.
Was ist Wasserstoff?
Wasserstoff (H2) ist ein farbloses Gas und ein Energieträger, der langfristig Erdgas ersetzen soll. Bislang kommen allerdings 99 Prozent des weltweit produzierten H2 aus fossilen Quellen. Wirklich klimafreundlich ist nur grüner Wasserstoff. Er wird durch Elektrolyse von Wasser gewonnen – mit Strom aus erneuerbaren Energien wie Wind oder Solar. Seine Produktion ist zwei bis drei Mal teurer als die von grauem Wasserstoff, der aus Erdgas, Kohle oder Öl gewonnen wird. Grüner Wasserstoff ist sehr selten, er macht weltweit nur 0,1 Prozent des verfügbaren H2 aus.
Die Pläne für Wasserstoff-Heizungen erweisen sich allerdings zunehmend als Luftnummern. Nicht nur, dass es bisher in Deutschland fast keinen grünen Wasserstoff gibt – er wird laut Fachleuten auch künftig deutlich ineffizienter und damit teurer sein als alternative Anlagen. Dennoch werden seit Jahren „wasserstofffähige“ Heizungen angepriesen.
Die Bundesregierung hält sich bei dem Thema noch relativ bedeckt: Aktuell will sich das Wirtschaftsministerium auf CORRECTIV-Anfrage nicht konkret zu Wasserstoff äußern. Die CDU- Wirtschaftsministerin Katherina Reiche sagte vor ihrem Amtsantritt, das deutsche Gasnetz müsse jetzt schnell „h2-ready“ werden, CDU-Fraktionschef Jens Spahn wartet auf „grünes Öl“ und die Wasserstoffheizung.
Katherina Reiche war von 2015 bis 2019 Geschäftsführerin des bereits erwähnten Verbands kommunaler Unternehmen. Danach wurde sie Chefin vom Versorger Westenergie, der wiederum sein Geld mit Gas-Netzen verdient. Noch im Mai dieses Jahres warb sie beim Energieministerrat in Warschau für Wasserstoff: „Ein technologieoffenes Europa hat energiepolitisch alle Chancen, das gilt für Erneuerbare und Batterien genauso wie für CO2-Speicherung und Wasserstoff.“
Drei Gründe zeigen, warum Fachleute keine Zukunft in wasserstofffähigen Heizungen sehen.
Wasserstoff wird teurer sein als andere Energie
CDU und FDP propagierten „Technologieoffenheit“ und priesen Wasserstoffheizungen lange als Energie der Zukunft an. Die FDP drängte in der Ampelkoalition darauf, die Wasserstoff-Technologie in das Gebäudeenergiegesetz aufzunehmen und staatlich zu fördern. Inzwischen ist sicher: Wer auf diese Energieform setzt, wird kräftig draufzahlen. Denn grüner Wasserstoff ist ineffizienter und teurer als beispielsweise Wärmepumpen. Und für die Übergangszeit müssen Kunden weiterhin mit Erdgas heizen, dessen Preis allein durch die CO2-Bepreisung anziehen wird.
Christian Maaß, früher Abteilungsleiter Wärme im Bundeswirtschaftsministerium und Mitverhandler des Gebäudeenergiegesetzes, sagt gegenüber CORRECTIV: „Für Privathaushalte sind H2-ready Heizungen viel zu teuer und ineffizient. Man sollte sie sich sparen.“ Für normale Wohngebäude kämen Wasserstoff-Heizungen aus Kostengründen nicht ernsthaft infrage. Für Gaskraftwerke käme Wasserstoff infrage, für private Heizungen sei das „unwahrscheinlich“.
Auch eine Auswertung von 32 unabhängigen Studien bestätigt das: Wasserstoff ist verglichen mit Alternativen wie Wärmepumpen, Solarthermie oder Fernwärmenetzen deutlich teurer und ineffizienter.
Warum Erdgas teurer wird
1. Ab 2027 wird der europäische Emissionshandel auch für Verkehr und Gebäude gelten. Dann muss für jede ausgestoßene Tonne CO₂ ein Zertifikat gekauft werden. Das macht Erdgas und -öl für Endkunden teurer.
2. Der Gashandel kann durch internationale Kriege einbrechen, die Welthandelspreise steigen.
3. Die Erdgasnutzer, die in einer Stadt übrig bleiben, müssen für die Infrastruktur höhere Preise zahlen, da die Kosten auf die Kunden verteilt werden. Je weniger Kunden Erdgas beziehen, desto teurer wird es für den Einzelnen.
Doch die Erdgaslobby propagiert, dass Erdgas irgendwann durch Wasserstoff ersetzt werden kann – sogar wenn sie selbst mit höheren Preisen rechnen. Der Verband der kommunalen Unternehmen wirbt für wasserstofffähige Heizungen, offenbar auch, um das Gasgeschäft der Stadtwerke zu sichern. Gleichzeitig gesteht der Verband in einem Papier ein, dass Gaskunden mit dem Emissionshandel ab 2027 (siehe Kasten) mindestens 400 Euro mehr pro Jahr zahlen müssen. Es könnte aber auch deutlich mehr sein.
Im Klartext: Auch wer auf H2-ready-Heizungen setzt, zahlt jahrelang drauf.
Das hat inzwischen auch die Bundesregierung erkannt: Vor wenigen Tagen zeigte CORRECTIV, dass sie Geld aus dem Klimafonds abzweigen will, um künftig höhere Gaspreise zu drücken. Denn Erdgas wird es noch lange geben müssen, selbst die optimistischen Wasserstoff-Fans rechnen nicht mit großen Mengen an grünem Wasserstoff vor 2035 oder gar 2040.
Es gibt nicht genug Wasserstoff für Privatheizungen
Derzeit gibt es eine Wohnsiedlung in Deutschland, die mit Wasserstoff versorgt wird: Im bayerischen Pfaffenhofen an der Ilm werden eine Handvoll Haushalte mit Wasserstoff beliefert. Mehr als ein Pilotprojekt ist es nicht. Auf eine flächendeckende Nutzung von Wasserstoff gibt es keine Aussicht. Allein, weil die Industrie bei der grünen Energie-Ressource Vorrang haben wird.
Der offizielle Wasserstoff-Plan der Bundesregierung zielt bis 2032 auf ein Kernnetz für Industriezentren wie Häfen, Raffinerien und Stahlwerke ab – Wohngebiete bleiben außen vor. Die Leitungen enden meist hunderte Kilometer entfernt von Wohnvierteln. Der Grund: Grüner Wasserstoff ist knapp und wird es bleiben.
Bislang erzeugen Deutschland und Europa weniger als ein halbes Prozent des grünen Wasserstoffs, den es 2030 nutzen will. Große Importe sollen den Mangel künftig ausgleichen, schreibt das Wirtschaftsministerium. „Deutschland wird Energieimportland bleiben, dafür soll die notwendige Infrastruktur für Importe von Wasserstoff in alle Richtungen weiter ausgebaut werden.“
Doch die schlechten Nachrichten für einst groß angekündigte Projekte häufen sich. So sollte in Namibia – unter großer Kritik von Umweltschützern – eines der größten Wasserstoffprojekte für Deutschland entstehen. Vor zwei Jahren reiste der grüne Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck deshalb persönlich in die namibische Hauptstadt Windhoek. Doch eine Studie der Technischen Universität München kam kürzlich zu einem ernüchternden Ergebnis: Nur rund zwei Prozent von rund zehntausend untersuchten Standorten in Afrika sind wettbewerbsfähig. Die Projekte seien zu teuer und seien mit herausfordernden lokalen Sicherheitslagen konfrontiert.
„Wenn ich eine Garage habe, kann ich auch sagen, die ist ‚Ferrari-ready‘. Ich könnte da ein sehr teures Sportauto drin parken. Das macht kaum jemand, weil es zu teuer ist – wie H2-ready-Heizungen.“ Jan Rosenow, Umweltökonom und Verfasser der Cell-Reports-Studie
Hinzu kommt: Der globale Vorrat an grünem Wasserstoff ist weitgehend für Industrien bestimmt, die ohne ihn keine Klimaneutralität erreichen können. Stahlwerke wollen damit Kohle im Hochofen ersetzen, die Chemieindustrie braucht ihn dringend für Dünger und Kunststoffe. Diese Industrien können ohne Wasserstoff nicht energieneutral werden. Aber allein der Bedarf dieser beiden Industrien ist enorm. Energieökonomin Claudia Kemfert bringt es auf diese Formel:
„Der grüne Wasserstoff wird für die Industrie benötigt und sollte nicht in SUVs oder Gasheizungen verschwendet werden. Wer heizt schon mit Champagner, wenn es auch mit Brause geht?”
Eine im Januar 2025 veröffentlichte Studie des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) bestätigt: Die weltweite Produktion von grünem Wasserstoff bleibt weit hinter den Erwartungen zurück. Die knappen Mengen werden künftig dort gebraucht, wo Alternativen fehlen – für private Heizungen bleibt kaum etwas übrig. In Wohnhäusern soll auf effiziente Lösungen wie Wärmepumpen gesetzt werden.
Stadtwerke zweifeln oder planen ohne Wasserstoff
Selbst einige Energieversorger und Stadtwerke zeigen sich skeptisch, was den Wasserstoff als Allheilmittel angeht – auch wenn ihr Verband, der VKU, noch immer für diese Energieform wirbt. Die Stadtwerke München etwa erklären gegenüber CORRECTIV: „Für Privatkundinnen wird (grüner) Wasserstoff als Energieträger in absehbarer Zeit in München keine Rolle spielen.“ Ähnlich äußert sich das Stadtwerk Nürnberg: „Wir gehen aktuell nicht davon aus, dass bis 2030 ein nennenswerter Anteil an Haushaltskunden mit Wasserstoff versorgt wird.“ Die Aussagen gleichen sich quer durchs Land: In Chemnitz, Bremen, Düsseldorf, Frankfurt oder Duisburg fehlen konkrete Pläne – oder man verweist auf langfristige Visionen und große Unsicherheiten.
Ob eine Kommune künftig Wasserstoff ins Gasnetz einspeisen will, ist entscheidend für die Wahl der Heiztechnik. Ist ein solcher Ausbau geplant, darf ab 2024 nur noch eine Gasheizung eingebaut werden, die sich theoretisch vollständig auf Wasserstoff umrüsten lässt. Doch solche Heizungen, die zu 100 Prozent auf Wasserstoff umstellbar sind, gibt es bisher gar nicht auf dem Markt.
Kommunen ohne konkrete Wasserstoffpläne erlauben weiterhin den Einbau von Erdgas-Heizungen – jedoch, nur, wenn sie „H2-ready“ sind, also theoretisch einen kleinen Anteil Wasserstoff zum Erdgas zumischen können. Doch ohne verbindliche Versorgung ist es äußerst unwahrscheinlich, dass jemals Wasserstoff geliefert wird. Wer auf diese Technik setzt, riskiert am Ende hohe Kosten – und ein Heizsystem, das zwar auf Wasserstoff wartet, aber nie welchen bekommt.
Erdgasbranche drückte „H2-ready“-Heizungen ins Gesetz
Warum also gibt es „H₂-ready“-Heizungen überhaupt? Trotz fehlender technischer und wirtschaftlicher Grundlagen fand die „H₂-ready“-Gasheizung ihren Weg ins Gebäudeenergiegesetz – ein Ergebnis intensiven Lobbydrucks.
Ursprünglich wollte die Bundesregierung ab 2024 nur noch Heizungen zulassen, die mindestens 65 Prozent erneuerbare Energien nutzen. Nach starkem Einfluss der Gasbranche, unterstützt von FDP, CDU und Verbänden wie DVGW und Zukunft Gas, wurde das Gesetz gelockert: Nun sind auch Heizungen erlaubt, die nur theoretisch auf 100 Prozent Wasserstoff umrüstbar sind – vorausgesetzt, die Kommune plant irgendwann den Anschluss ans Wasserstoffnetz.
Dass solche Netze für Wohngebäude auf absehbare Zeit kaum entstehen werden, blieb dabei unberücksichtigt, die Heizungen gibt es trotzdem schon. Umweltverbände und Forschende kritisieren diesen Kompromiss scharf: Er verschiebt den Umstieg auf wirklich zukunftsfähige Technologien wie Wärmepumpen und belastet Verbraucher mit einem teuren Versprechen ohne Perspektive.
Redaktion und Faktencheck: Martin Böhmer