Kind im Brunnen: Die Guten
Kinder bedeuten Zukunft. Unterstützung und Chancengleichheit für die nächste Generation entscheiden über den Erfolg eines Landes. Wie ist es um die Jugendhilfe in NRW bestellt – mit der Betreuung durchs Jugendamt? Was hat Krafts Prestigeprojekt „Kein Kind zurücklassen!“ erreicht? Und was muss nach fünf Jahren rot-grüner Regierung kommen? Zusammen mit einem erfahrenen Sozialarbeiter haben wir seit Monaten recherchiert. Die Ergebnisse haben den Umfang eines Buches angenommen. „Kind im Brunnen“ – die exklusive Serie zum Buch. Heute: Die Guten (XI)

© Vincent Burmeister
Regierungen kommen und gehen, Jugendämter bleiben. In den kommunalen Einrichtungen können Ziele wirklich mit langem Atem verfolgt werden. Wenn man welche hat. In Dormagen haben sie vor 20 Jahren aus einem großen Ziel viele kleine abgeleitet. Aus Sorge um den Kinderschutz und dem Kampf gegen Kinderarmut entstand ein neuer Arbeitsansatz fürs Jugendamt. Und Dormagen wurde ein Vorbild, eine Modellkommune – zehn Jahre vor „Kein Kind zurücklassen!“.
Man merkt es nicht auf den ersten Blick. Zwischen Neuss und Köln, im Süden kilometerweit Bayerland, im Norden führt vom Bahnhof eine Bundesstraße ins Zentrum. Durch eine Einkaufsschleuse mit Eiscafé über einen kleinen Platz mit Sonnenschirmen und Raucherheizpilzen gelangt man ins „Neue Rathaus“.
Uwe Sandvoss wartet, wir sind eine halbe Stunde zu spät. Er hat die Zeit überbrückt, liest ein Buch zu „Lifelong Learning“, zu lebenslangem Lernen: „Will ich den Kollegen vorstellen.“ Als Sozialarbeiter im Jugendamt hat er gelernt mit Fehlern umzugehen, da können ihn 30 Minuten Verspätung nicht schocken.
Die Folgen unserer Serie „Kind im Brunnen“
Folgen, die erschienen sind, werden verlinkt. Die ausstehenden Folgen veröffentlichen wir in den kommenden Wochen.
Wir sind im Rheinland, Köln ist nicht weit. Ich bin mit Werner Fiedler unterwegs, dem Bottroper Gladbecker, einem nüchtern bedächtigen Charakter. Es ist auch eine Reise der Temperamente. Wir sitzen im gediegenen Sitzungsraum des Bürgermeistertrakts mit blank polierten Kaffeekannen. Fiedler ist ein Riesenfan des Dormagener Modells, für ihn der Beweis, dass es anders geht: „Ich bin ja 40 Jahre in der Jugendhilfe, die Ergebnisse sind außerordentlich verbesserungsfähig, trotz aller Mittel, die wir reingesteckt haben, hat sich die Situation nicht verbessert.“ Sandvoss nimmt den Faden auf: „Ich sehe es nicht so pessimistisch.“ Jede Intervention habe ihre Wirkung, auch jede abgebrochene. Letztlich gehe es um Hilfe, nicht nur zur Selbsthilfe, sondern „zur Selbstbestimmung“.
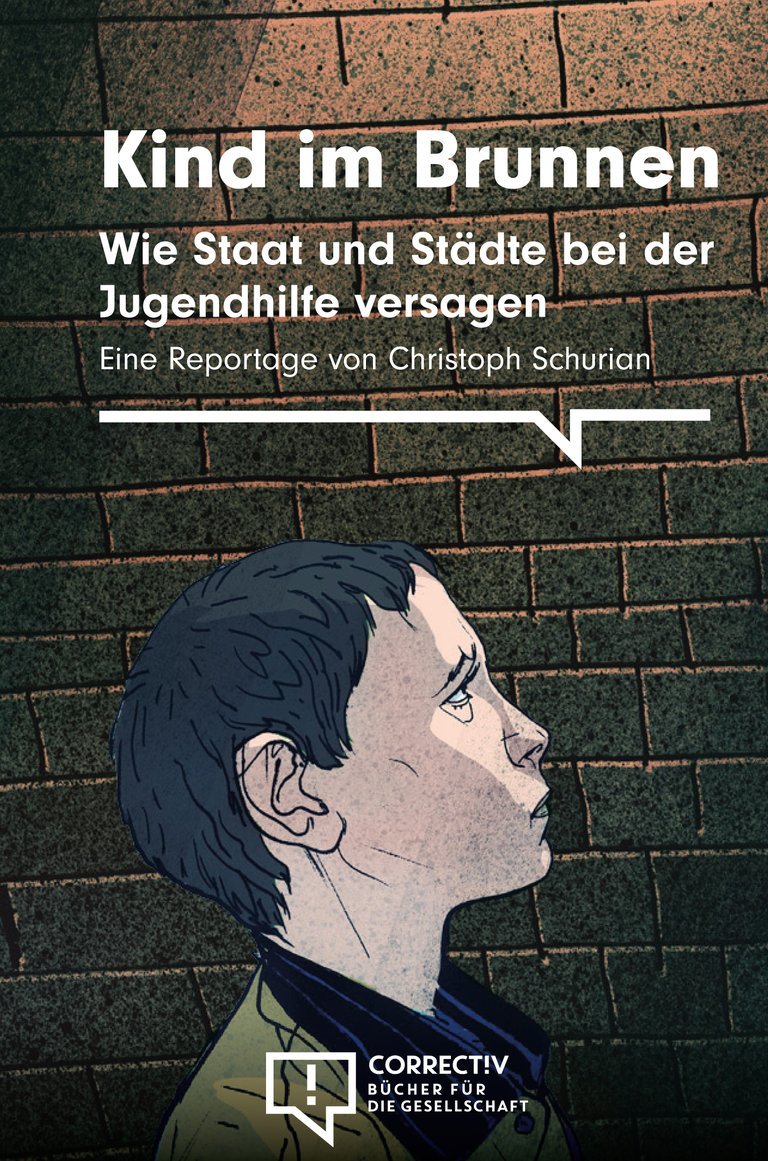
Unser Buch zur Serie „Kind im Brunnen“ kann in unserem Shop bestellt werden.
Und Sandvoss weiß, wovon er redet.
Seit dem Ende der 1990er Jahre haben sie die Jugendhilfe in Dormagen gegen den Strich gebürstet. Man könnte es präventives Denken nennen, vordenken. Die Stadt hat 60.000 Einwohner in Pendeldistanz nach Köln und Düsseldorf, eine niedrige Arbeitslosenquote, Rheinufer, viel Wald, aber auch Siedlungen mit sozialen Schwierigkeiten, abgehängte Familien und dazu einen Altbürgermeister, der sich den Schutz von Kindern zur Lebensaufgabe gemacht hat. Heinz Hilgers ist seit einem Vierteljahrhundert Präsident des Kinderschutzbundes, in Dormagen wirkte er 16 Jahre als Stadtoberhaupt. Der Jugendhelfer in der Kommunalpolitik ist einer der Schlüssel zum Erfolg in der rheinischen Mittelstadt.
Die Idee setzt sich durch
Ein anderer Schlüssel: Sie haben dort angesetzt, wo der Schuh drückt und nicht nur bei den Symptomen. Es ging um Kinderarmut, die Armut zurückzudrängen, Benachteiligungen zu verhindern, ein besseres soziales Umfeld zu schaffen. Und das so früh wie möglich. Bundesweit wurde Dormagen mit den „Babybegrüßungsbesuchen“ bekannt, die sie seit 2006 bei den allerjüngsten Einwohnern und deren Eltern machen. Sie überreichen dazu ein Paket mit einem offiziellen „Eltern-Begleitbuch“ und von Sponsoren gestiftete Geschenke vom Rauchmelder bis zum Babypuder.
Gelsenkirchen hatte gleichzeitig eine ähnliche Idee mit Willkommensbesuchen Kontakte herzustellen zwischen Eltern und Jugendamt. Heute gibt es kaum eine Kommune, die die Idee nicht übernommen hat. Kommunen beugen vor. Auch ganz von allein.
Was Dormagen besonders macht: Hier kommt der Bezirkssozialarbeiter. Hier gibt es ihn noch, die Kraft an der Basis. Er wurde nicht eingespart, ersetzt durch die Fallmanager im Allgemeinen Sozialen Dienst, die die Arbeit an die Freien Träger weiterreichen. „Familien brauchen einen direkten Ansprechpartner für alle Themen, nicht zwanzig verschiedene“, sagt Sandvoss. Deshalb hätten sie sich nie aus den Stadtteilen verabschiedet. Im Gesundheitswesen gebe es ja auch den Allgemeinmediziner, nicht nur Spezialisten. Dormagen hat in den letzten 20 Jahren sehr viel anders gemacht.
Es begann mit einer Nabelschau, einer Qualitätsanalyse. Leitwerte wurden entwickelt und jede Aufgabe des Jugendamtes miteinander durchleuchtet von „außerfamilialen Hilfen zur Erziehung im stationären Bereich“ bis zu den „Aufgaben des Adoptionsvermittlungsdienstes“. Am ersten „Dormagener Qualitätskatalog“ wurde mehr als zwei Jahre gearbeitet. Und die Arbeit steht nicht still.
Auch die Politik zieht mit
Von Beginn an waren die Freien Träger und deren Mitarbeiter dabei. Gemeinsam wurden stationäre Hilfen abgebaut, die ambulanten Hilfen zur Erziehung umgebaut. „Der Deckel muss zum Topf passen“, sagt Sandvoss. Auch eine Putzhilfe kann eine Hilfe zur Erziehung darstellen, sogar eine große. Und trotz Flexibilisierung und hohen Qualitäten gelang etwas Erstaunliches: Im städtischen Haushalt fiel die „Preissteigerungsrate“ nur gering aus, wie es Sandvoss nennt. Die Ausgaben für Hilfen zur Erziehung sind im Rahmen geblieben, anders als in den meisten anderen Städten.
„Wir haben im Jugendamt nie auf Case-Manager gesetzt, die Hilfen verteilen, wir setzen auf Unterstützungsmanager.“ Umformulieren, neu denken, Sandvoss macht das gerne, er sieht das Jugendamt als „Beziehungsamt“, warnt davor nur noch arme Kinder in den Blick zu nehmen. „Auch Reiche haben Bedarf.“ Und in Dormagen hatten sie offenbar viel Glück miteinander. Dass Kollegen zusammenfanden, die für intensive Qualitätsdiskussionen bereit waren: „Zufall“, sagt Sandvoss dazu. Auch dass die verschiedenen Bürgermeister, ob von SPD oder CDU, am Kurs festgehalten haben. Irgendwann wären sie aber einfach zu gut gewesen, sagt Sandvoss und lächelt gewinnend.
„Ich habe 50 Jahre Erfahrung in der Jugendhilfe“, sagt er. Schwarzes volles Haar, ein Mitfünfziger, ist in Heimen aufgewachsen. Noch unter Erziehern, die eigentlich Schreiner waren, in Schwesternheimen, die nichts als „Aufbewahrungsanstalten“ darstellten. Er hat die Veränderungen Anfang der 1970er Jahre erlebt, die Pioniere. Die hätten ihm erlaubt, als Jugendlicher die Einrichtung zu verlassen, für ein Jahr aus der Schule herauszugehen. „Heute würdest du für so etwas aus der Jugendhilfe fliegen!“
Demokratische Jugendhilfe
Was Sandvoss als Jugendlicher erlebt hat, prägt ihn bis heute: „Der Druck muss raus“ – aus Gesellschaft, aus Schulen, aus Jugendämtern. Und die Angst, auch vor Fehlern im Jugendamt. Bei Verwahrlosung reiche es meistens, die Kinder tagsüber, acht Stunden lang in einer Einrichtung zu verpflegen, „wo sie sich die Zähne putzen“.
In Dormagen zählen sie nicht mehr die Anzahl der Inobhutnahmen von Kindern, weil es sie kaum noch gibt. Sie zählen die Stunden, in denen sie die Kinder aus den Familien nehmen. Man müsse Angebote machen, die auch die Eltern annehmen können, ohne sich bevormundet zu fühlen.
„Wir sind eine Demokratie“, sagt Sandvoss. Das gelte auch für die Jugendhilfe. Der Schutz des Kindeswohls sei ein Recht der jungen Menschen und kein Mittel des Staates, um familiäre Tragödien, oder sogar tote Kinder zu verhindern. Im Übrigen verzehnfache sich die häusliche Gewalt gegen Kinder nach dem Eintritt ins staatliche Schulwesen. Auch das eine Folge von Leistungsdruck und enttäuschten Erwartungen in den Familien, durch die Schule hole sie gesellschaftliche Wirklichkeit, die Ausgrenzung ein.
Der Dormagener Vordenker möchte versuchen auch hier umzuschwenken: Warum können Schulen nicht Lebensraum für alle werden, warum werden Hausaufgaben nicht mit den Eltern in der Schule gemacht?
Die kluge Kommune Dormagen macht auch mit beim Landesprogramm „Kein Kind zurücklassen!“, als eine, manche sagen, als die Modellkommune. Sandvoss findet „KeKiz“ gut. Er ist da entspannt, lobt die neu entstandene „Metaebene“ zwischen Land und beteiligten Städten und hat dennoch noch eine lange Wunschliste. Die „Familienzentren“ – sie wurden unter der schwarz-gelben Landesregierung von Jürgen Rüttgers und Familienminister Armin Laschet aufgebaut – müssten stärker werden.
Sandvoss findet die Trennung von Jugendhilfe und Schulwesen sowieso obsolet. Grundschulen sollten zu Familienzentren werden, hier finde die „soziale Inklusion“ statt, auch über Migrationsgrenzen hinweg. Und das Land sollte die Ideen aus den Kommunen auch in die „eigene Struktur aufnehmen“, vor allem im Schulministerium. Bisher wollen sie dort „lieber keine Veränderungen“.
Sandvoss muss zum nächsten Termin, in Dormagen sind Sozialarbeiter gefragte Leute. Wir finden allein hinaus, vorbei an einer Ahnengalerie der ehemaligen Bürgermeister und einer Hochvitrine mit Urkunden, Kupferstichen und Holzwappen. Zwischen der Heimatgeschichte und den Bildern der Stadtoberen steht mitten im Bürgermeistertrakt ein Kicker. Im Zug kratzt sich Fiedler am Bart, „die sind schon etwas optimistischer im Rheinland“.



