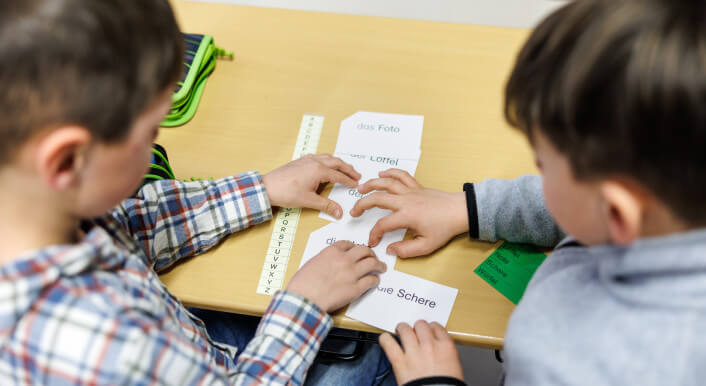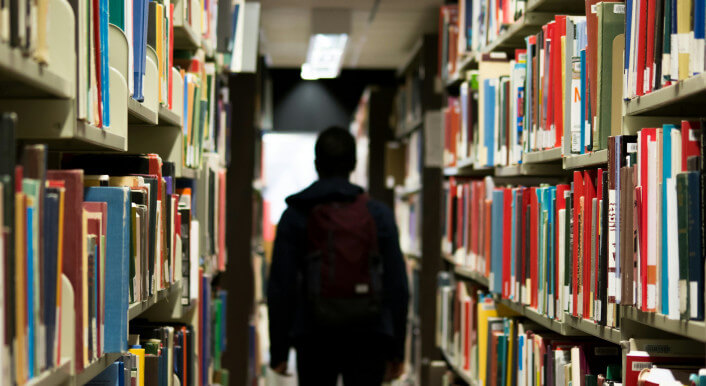Fast jeder zweite Schulsozialarbeiter denkt an Jobwechsel
Viele Schulsozialarbeiter in Deutschland sind überlastet und fühlen sich alleine gelassen. Es fehlen unterstützende Strukturen und fachliche Begleitung. Das zeigt eine neue Studie, die CORRECTIV vorab vorliegt.

Deutschlands Schulsozialarbeiter sind überlastet – 43 Prozent haben in den vergangenen zwölf Monaten darüber nachgedacht, ihren Job aufzugeben. Die häufigsten Gründe sind großer emotionaler Stress, der Status als Einzelkämpfer und zu wenig Wertschätzung. Das zeigt eine Studie der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes (HTW Saar), die CORRECTIV vorab vorliegt.
An der Befragung nahmen bundesweit 5.070 Schulsozialarbeiter teil. Die Autoren der Studie Sebastian Rahn und Lars Bieringer von der HTW Saar schätzen, dass das knapp 28 Prozent aller Schulsozialarbeiter in Deutschland sind. Genaue Zahlen, wie viele Menschen bundesweit in der Schulsozialarbeit tätig sind, gibt es nicht.
Schulsozialarbeiter haben viele verschiedene Aufgaben: Sie führen an der Schule beispielsweise Workshops gegen Gewalt durch oder kümmern sich um Kinder, die im Unterricht auffällig werden. Vor allem aber sind sie für alle Kinder ansprechbar mit allem, was sie bewegt – ob das nun der Streit in der Pause, Schwierigkeiten beim Lernen oder zuhause sind. „Es ist wichtig, dass junge Menschen an der Schule einen Ansprechpartner haben, an den sie sich niedrigschwellig und anlasslos wenden können“, sagt Sebastian Rahn, Nachwuchsprofessor für Sozialisation, Erziehung und Bildung über die Lebensalter.
Schlechte Rahmenbedingungen
Die Studie, die von der Max-Traeger-Stiftung und der Robert Bosch Stiftung gefördert wurde, zeigt, dass es vor allem bei den Rahmenbedingungen für Schulsozialarbeit hapert: Zwar haben bundesweit rund 85 Prozent der Schulsozialarbeiter einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Aber nur knapp 60 Prozent fühlen sich von ihrem Träger gut unterstützt. Jeder vierte Schulsozialarbeiter kann keine Supervision in Anspruch nehmen, bei der zum Beispiel belastende Situationen nachbesprochen werden könnten. Ein Problem in einem Arbeitsfeld, in dem die Fachkräfte immer wieder mit Kindeswohlgefährdungen konfrontiert sind, wie die Autoren der Studie berichten.
Umfrage zu Schulsozialarbeit
Wir recherchieren weiter zu den Arbeitsbedingungen von Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeitern. Dafür wollen wir Ihre Erfahrungen sammeln:
Sie arbeiten als Fachkraft in der Sozialarbeit an einer Schule? Dann erzählen Sie uns von Ihren Erfahrungen: Was erleben Sie bei Ihrer Arbeit? Was erschwert Ihren Arbeitsalltag? Was müsste sich ändern?
Die Studie offenbart zudem, dass häufig klare Strukturen für die Schulsozialarbeit fehlen: Nur an rund jeder zweiten Schule gibt es feste Abläufe für die Zusammenarbeit mit Lehrkräften und anderen Berufsgruppen, die an der Schule tätig sind. Und nur 44 Prozent der Schulsozialarbeiter können auf ein eigenes sozialpädagogisches Konzept für ihre Schule zurückgreifen, das die Besonderheiten des Standorts berücksichtigt. Solch ein Konzept helfe den Sozialarbeitern, ihre genauen Ziele und Aufgaben an der Schule festzulegen und gebe Sicherheit im Alltag, sagt der Sozialwissenschaftler Rahn.
Die Studie der HTW Saar zeigt auch Lücken in der Ausbildung: Nur jeder fünfte Sozialarbeiter sagte in der Befragung, sich über Queerness und sexuelle Vielfalt „sehr gut“ informiert zu fühlen. Dabei kommt es an Schulen immer wieder zu queerfeindlichem Mobbing: CORRECTIV machte kürzlich einen Fall an der Berliner Rütli-Schule öffentlich. Eine Gruppe offenbar derzeitiger und ehemaliger Schüler hatte den Ehemann eines Lehrers über Monate hinweg belästigt und homophob beleidigt.
Gewerkschaft fordert mehr Stellen und Supervision
Schulsozialarbeit sei „ein unverzichtbarer Bestandteil einer zeitgemäßen Bildungs- und Jugendpolitik“, sagt Alessandro Novellino, Referent für Schulsozialarbeit im Bundesvorstand der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Sie stärke insbesondere benachteiligte Kinder und Jugendliche und trage damit zur Chancengerechtigkeit bei. Um Fachkräfte langfristig in der Sozialarbeit an Schulen zu halten, brauche es bundesweit verbindliche Qualitätsstandards, Supervision, Fortbildung und fachliche Begleitung. Novellino fordert zudem „eine angemessene personelle Ausstattung im Team statt isolierter Einzelstellen“.
Bereits im Jahr 2015 forderten die GEW und die Fachverbände von Schulsozialarbeitern einen Ausbau der Sozialarbeit: An jeder Schule solle es Sozialarbeit geben und pro 150 Schülern mindestens eine volle unbefristete Stelle. Davon ist Deutschland noch weit entfernt: Noch immer haben nicht alle Schulen in Deutschland eine Sozialarbeiterin. Und manche Sozialarbeiter sind gleich für mehrere Schulen zuständig, wie die aktuelle Studie zeigt: Bundesweit sind knapp 13 Prozent an mehreren Schulen tätig. Im Saarland sind es sogar knapp 42 Prozent.
„Schmerzhafte Erfahrungen für Kinder und Jugendliche“
Wenn die Überlastung der Schulsozialarbeiter wirklich dazu führen sollte, dass viele ihren Job aufgeben, dann kann das schwerwiegende Folgen für die betroffenen Kinder haben: „Schulsozialarbeit ist Beziehungsarbeit“, sagt Lars Bieringer, Mitautor der Studie. Es gehe darum, eine Verbindung und Vertrauen zu den Schülerinnen und Schülern und ihren Eltern aufzubauen. Wenn Schulsozialarbeiter ihren Job aufgeben und es häufige Wechsel gibt, „dann sind das richtig schmerzhafte Erfahrungen für Kinder und Jugendliche“, die eine Bezugsperson an der Schule verlieren, sagt Bieringer.
„Es ist eine doppelte Krise, wenn diejenigen, die helfen sollen, selbst ausgebrannt sind und nicht mehr können“, sagt Quentin Gärtner, Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz. Deutschland befinde sich in einer Krise der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Schulsozialarbeiter seien umso wichtiger, um Schüler mental zu entlasten. Wie schon die GEW und die Fachbände der Schulsozialarbeit vor zehn Jahren, fordert Gärtner, dass es für jeweils 150 Schüler und Schülerinnen mindestens eine
Vollzeitstelle in der Schulsozialarbeit gibt. Um das umzusetzen, sei auch die Bundesregierung in der Pflicht.
Bildungsministerium sieht Startchancen-Programm als Lösung
Die Finanzierung der Schulsozialarbeit liegt hauptsächlich bei den Ländern und Kommunen. Der Bund kann aber mit Förderprogrammen unterstützen. CORRECTIV fragte das Bundesbildungsministerium, welche Maßnahmen es plane, um die Schulsozialarbeit in Deutschland weiter auszubauen und die Arbeitsbedingungen zu verbessern. In seiner Antwort verweist das Ministerium darauf, dass die Länder grundsätzlich zuständig seien. Und auf das bereits bestehende Startchancen-Programm „als zentrales Instrument“, um eine „bedarfsgerechte Schulsozialarbeit“ zu ermöglichen.
Das Startchancen-Programm läuft seit Sommer 2024 und wird vom Bund und den Ländern bezahlt: Über zehn Jahre sollen insgesamt 20 Milliarden Euro zusätzlich in Schulen mit besonders vielen Kindern, die von Armut betroffen sind und eine Migrationsgeschichte haben, fließen. Über das Förderprogramm können an Schulen auch Stellen in sogenannten multiprofessionellen Teams finanziert werden – also zum Beispiel Stellen für Logopädinnen, Psychologen oder auch Schulsozialarbeiter. Die Länder entscheiden selbst, welche Stellen sie finanzieren. Wie Anfragen von CORRECTIV im vergangenen Jahr ergaben, werden Stellen in der Schulsozialarbeit nicht in allen Bundesländern gefördert.
Rechentrick hinter dem Startchancen-Programm
Recherchen von CORRECTIV ergaben damals zudem, dass der Umfang des Startchancen-Programms tatsächlich deutlich geringer sein könnte als angekündigt: Mehrere Länder verschieben hunderte Millionen Euro nur aus bestehenden Förderungen und investieren kaum zusätzlich in Schulen.
Wie Sozialarbeit an Schulen gefördert werden soll, die nicht über das Startchancen-Programm unterstützt werden, lässt das Bundesministerium in seiner Antwort an CORRECTIV offen. Geld aus dem Förderprogramm erhalten nur 4.000 der knapp 31.000 allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen in Deutschland.
Dieser Artikel ist Teil der Arbeit der Bildungsredaktion von CORRECTIV. Die Arbeit der Bildungsredaktion wird finanziell unter anderem von der Alfred-Toepfer-Stiftung und der Robert Bosch Stiftung gefördert sowie durch die Spenden unserer Leserinnen finanziert.