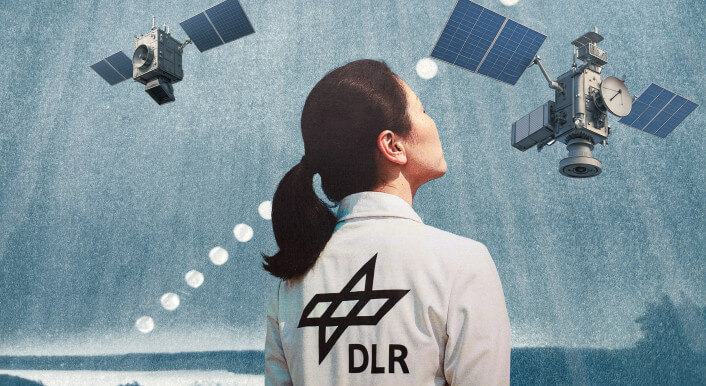Nach Spionage-Vorwürfen: Härtere Ausschlusskriterien bei China-Kooperationen gefordert
Führende Innenpolitiker und Experten bemängeln einen sorglosen Umgang mit chinesischen Forschungs- und Wissenschaftseinrichtungen. Nach einer CORRECTIV-Recherche zu Auffälligkeiten an der TU München fordern sie härtere Ausschlusskriterien und Zugangsbeschränkungen für chinesische Studenten und Gastprofessoren.

Im Fall einer Spitzenforscherin der TU München, die das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) einer CORRECTIV-Recherche zufolge der Spionage verdächtigt hat, fordern Innen- und Sicherheitspolitiker Konsequenzen.
Die Wissenschaftlerin chinesischer Abstammung forscht im Bereich der Satellitenbildanalyse in Kombination mit KI- und Social-Media-Daten. In einem internen Schreiben hatte das DLR zahlreiche Auffälligkeiten bei der Nebentätigkeit der Forscherin für das Zentrum aufgelistet und die Ausspähung sensibler Daten und Zusammenarbeit mit ausländischen Geheimdiensten nicht ausgeschlossen. Die Forscherin wollte sich gegenüber CORRECTIV nicht äußern, hatte die Anschuldigungen im Rahmen eines Kündigungsschutzverfahrens vor dem Arbeitsgericht jedoch zurückgewiesen.
Der CDU-Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter nennt es gegenüber CORRECTIV „sicherheitsgefährdend und fahrlässig, dass deutsche Universitäten, Hochschulen und Forschungseinrichtungen weiterhin teilweise blauäugig mit chinesischen Kooperationen umgehen“. Er weist darauf hin, dass Spionage Teil der geopolitischen Strategie Chinas sei, das bis zum Jahr 2049 Welttechnologieführer werden will. Die nun bekannt gewordenen Vorwürfe gegen die Münchner Professorin dürften nur „die Spitze des tatsächlichen Eisberges“ sein, so der Sicherheitspolitiker.
„Wir haben kaum Resilienz gegenüber China, denn wir begreifen die strategische Vorgehensweise von China als oberstes Handlungsprinzip nicht“, sagt Kiesewetter. Die bisherige China-Politik der Bundesregierung halte er für „sicherheitsgefährdend“ und die Vorgaben in der Nationalen Sicherheitsstrategie sowie im Koalitionsvertrag für „unzureichend“. Der Politiker fordert einen grundsätzlichen Ausschluss von Forschungskooperationen mit chinesischen Einrichtungen in sicherheitsrelevanten Bereichen und eine Zugangsbeschränkung chinesischer Studenten und Gastprofessoren.
Die am Montag veröffentlichte Recherche hatte weitreichende Verbindungen der renommierten Forscherin in den chinesischen Verteidigungsapparat offengelegt. In München beaufsichtigt die Professorin ein Netzwerk aus mehreren Doktoranden und Gastwissenschaftlern, die zuvor in China an militärnahen Einrichtungen tätig waren. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Wissen aus München in Militärtechnologie in China floss.
Für den Grünen-Bundestagsabgeordnete und Innenpolitiker Konstantin von Notz zeige die neue Recherche „eindrücklich, wie groß derzeitige Bedrohungslagen sind“. So werde zurecht viel viel über russische Spionage-, Sabotage und Einflussnahmeoperationen gesprochen, doch es gingen „auch ganz erhebliche Gefahren von China aus“.
„Seit langem besonders im Fokus ist auch und gerade die Wissenschaft“, sagt von Notz. Es brauche „ein gänzlich anderes Bewusstsein“. Dazu gehöre auch, die Spionageabwehr in Richtung China hochzufahren, „wie es die Nachrichtendienste seit langem fordern“.
Grünen-Politiker Siekmann: Maßnahmen zur Spionageabwehr auch ohne Nachweis möglich
Florian Siekmann, Grünen-Abgeordneter und Vizechef des Innenausschusses im Bayerischen Landtag, spricht ebenfalls von einem „viel zu sorglosen Umgang mit Spionagerisiken“. Ähnlich wie Kiesewetter fordert er, Gastwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler aus militärnahen chinesischen Universitäten sollten nicht mehr am Lehrstuhl beschäftigt werden dürfen.
Während das DLR Konsequenzen „aus der unglaublichen Vielzahl skurriler Vorfälle“ rund um die Professorin gezogen habe, passiere an der Universität und im CSU-Wissenschaftsministerium hingegen jahrelang nichts, kritisiert Siekmann. Er sagt: „So schwierig Spionage im Strafrecht nachzuweisen ist, so einfach wäre es gewesen, erste Maßnahmen zur Spionageabwehr zu ergreifen.“
Die vom DLR intern erhobenen Vorwürfe gegen die renommierte Professorin waren bislang nicht Gegenstand von Ermittlungen. Für Alicia Hennig zeigt der Fall die „diversen praktischen Hürden, um Spionage tatsächlich nachzuweisen“. Die Wirtschaftsethikerin von der TU Dresden sagt: „Die Handlungen werden ja oftmals in einer Art und Weise vollzogen, die stets Ambiguität zulässt. Und während wir keinen Nachweis erbringen, laufen wir trotzdem Gefahr, dass Wissen und Technologie beim Parteistaat landen.“
Neben klaren Ausschlusslisten von Universitäten und einem Beantragungsprozess für Forschungskooperation mit Risikoländern fordert Hennig mehr Rechenschaft bei Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen. Sie sagt: „Es ist Aufgabe der Bundesregierung, insbesondere des neuen Ministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt, endlich mit verbindlichen Kriterien und einer zentralen Anlaufstelle für Universitäten und Forschungseinrichtungen zu kommen.“