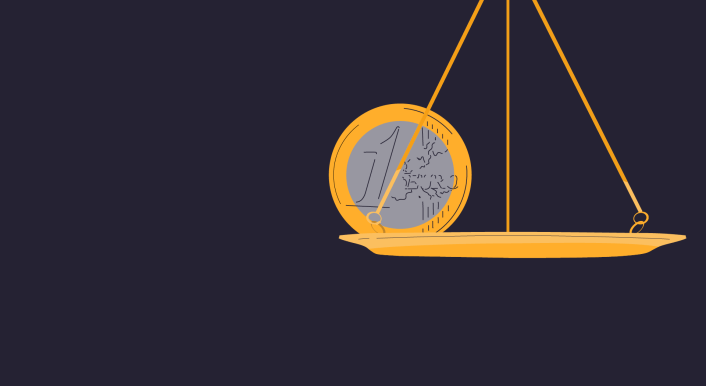Rechtsextreme und Reichsbürger: In mindestens elf Fällen waren verfassungsfeindliche Schöffen im Amt
Vor der letzten Schöffenwahl riefen Rechtsextreme zur Unterwanderung auf. Eine Recherche von CORRECTIV.Lokal zeigt, dass bereits in der vorherigen Amtszeit mindestens elf verfassungsfeindliche Schöffen ins Amt kamen. Und warum das weiter möglich ist.

Schöffen haben viel Macht. Als Laienrichter entscheiden sie in Strafverfahren zusammen mit Berufsrichtern über die Schuld von Angeklagten und über die Strafe. Ihre Stimmen zählen so viel wie die der ausgebildeten Juristen. Rund 60.000 Schöffinnen und Schöffen gibt es in Deutschland. Alle fünf Jahre werden sie gewählt.
In Verfahren an Amtsgerichten können die beiden Schöffen den Berufsrichter überstimmen. In Schwurgerichten am Landgericht, wo besonders schwere Straftaten wie Totschlag und Mord verhandelt werden, besitzen die Schöffinnen und Schöffen zumindest eine sogenannte Sperrminorität gegenüber den drei Berufsrichterinnen. Niemand kann gegen die Stimmen der zwei Schöffen verurteilt werden.
Rechtsextreme Mobilisierung zu Schöffenwahlen
Ein attraktives Amt für Rechtsextreme, die den Rechtsstaat unterwandern wollen. Das wurde bei vergangenen Schöffenwahlen immer wieder sichtbar, zuletzt im Jahr 2023: Die rechtsextreme Partei Freie Sachsen warb auf Telegram, sich als Schöffe zu bewerben, um „den grünen Richter zu überstimmen, der bei Neubürgern wieder einmal kulturellen Strafrabatt geben will“.
Auch die Partei Die Heimat (ehemals NPD), die rechte Szene-Anwältin Nicole Schneiders, Lutz Bachmann von Pegida und der sächsische AfD-Bundestagsabgeordnete Mike Moncsek versuchten, ihre Anhänger für das Ehrenamt zu mobilisieren.
Eigentlich sollen Bewerberinnen und Bewerber, die für das Schöffenamt ungeeignet sind, bereits während des Wahlverfahrens ausgeschlossen werden und gar nicht ins Amt kommen. Etwa wenn es Zweifel an ihrer Verfassungstreue gibt. Extremisten sollten also eigentlich gar nicht Schöffe und Schöffin werden können. Doch das funktioniert nicht immer, wie Recherchen von CORRECTIV.Lokal zeigen.
Mindestens elf verfassungsfeindliche Schöffen
In der vergangenen Amtszeit wurden mindestens 24 Schöffinnen und Schöffen enthoben. Elf davon fielen durch verfassungsfeindliche Äußerungen oder Handlungen auf. Zwei dieser elf Personen sind mit rechtsextremen Aktivitäten aufgefallen, wurden aber formal wegen anderer Gründe des Amtes enthoben.
Die Recherche zeigt auch: Die tatsächliche Zahl von verfassungsfeindlichen Schöffen ist wahrscheinlich höher und vermutlich üben sie derzeit auch Einfluss auf Gerichtsentscheidungen aus.
Das ist das Ergebnis der Anfragen von CORRECTIV.Lokal an die Justizministerien der Länder und alle 24 Oberlandesgerichte in Deutschland. Diese gaben an, wie viele Schöffinnen und Schöffen in der vergangenen Amtszeit (2019 bis 2023) enthoben wurden und was der Grund dafür war. Die Zahl der tatsächlichen Amtsenthebungen dürfte um einiges höher sein als die 24 dokumentierten Fälle. Denn einige Oberlandesgerichte konnten keine Auskunft geben.
Holocaust als „Klacks“ verharmlost
Ein Grund für eine Amtsenthebung ist, wenn Schöffen die Verfassung und damit die freiheitlich-demokratische Grundordnung ablehnen:
Eine Schöffin am Landgericht Amberg leugnete auf Facebook die Existenz der Bundesrepublik. Und behauptete, dass die Wahlen ungültig und verfassungswidrig seien. Deutschland sei von den Alliierten besetzt. Im September 2021 erhielt das Landgericht Amberg Hinweise auf die Facebook-Posts. Im Oktober 2021 wurde die Schöffin ihres Amtes enthoben.
Ein Schöffe am Landgericht Regensburg verharmloste auf Facebook den Holocaust als „Klacks“. Und schrieb dort: „Zyklon B, Tabun, Sarin E605, CO2, Atemluft – GAS works!“ Mitgliedern von Fridays for Future drohte er das Aufbohren der Schädeldecke an. Die Facebook-Posts machte das lokale Onlinemedium Regensburg Digital im Mai 2020 öffentlich. Ende Juni 2020 enthob ihn das Oberlandesgericht Nürnberg seines Amtes.
Ein Schöffe am Landgericht Saarbrücken äußerte in einem Prozess gegen einen Reichsbürger selbst Zweifel an der Legitimität der Bundesrepublik. Er bezweifelte, dass die Strafgesetze wirklich gültig seien. Der Schöffe wurde daraufhin Anfang 2022 seines Amtes enthoben. Bis dahin hatte er an 22 Verfahren mitgewirkt.
Insgesamt konnte CORRECTIV.Lokal elf Fälle nachweisen, bei denen Schöffen mit verfassungsfeindlichen Äußerungen und Handlungen auffielen. In dreizehn anderen Fällen verloren die Laienrichter aus anderen Gründen ihr Amt: Manche kamen schlicht nicht zu den angesetzten Verhandlungen. Einer studierte während eines Verfahrens Werbeprospekte und schlief ein. Ein Jugendschöffe am Amtsgericht Kelheim verbreitete Darstellungen von sexualisierter Gewalt an Kindern.
Erfurter Schöffin meldete rechtsextreme Demo an
Elf verfassungsfeindliche Schöffinnen und Schöffen von 60.000 – das klingt erstmal nicht viel. Andreas Höhne, selbst seit 15 Jahren Schöffe und seit 2017 Präsident des Bundesverbands ehrenamtlicher Richter und Richterinnen, ist trotzdem schockiert. Denn er ist sich sicher, dass es eine viel größere Dunkelziffer gibt: „Das sind ja nur die, die aufgefallen sind.“ Er fordert mehr Transparenz bei der Auswahl der Schöffen. Dazu zählt für ihn, dass Bürgerinnen und Journalisten leichter über ausgewählte Schöffen informiert werden. „Diese Aufklärung und diese Öffentlichkeit, die gibt es nicht“, sagt Höhne.
Dabei waren es auch Recherchen von Medien, die extremistische Einstellungen von mittlerweile enthobenen Schöffen und Schöffinnen aufgedeckten. Wie beim Regensburger Schöffen, der den Holocaust verharmloste. Oder im Fall der Schöffin Gitta Kritzmöller.
Als Journalisten des MDR im Januar 2023 über einen Prozess gegen mutmaßliche Schleuser am Landgericht Erfurt berichteten, fiel ihnen eine der Schöffinnen auf: Sie kannten Kritzmöller als rechtsextreme Aktivistin, die unter anderem eine Demonstration mit dem Thüringer AfD-Chef Björn Höcke, dem rechtsextremen Verleger Jürgen Elsässer und Lutz Bachmann von Pegida angemeldet hatte. Dem Gericht war das offenbar zuvor nicht bekannt.
Das Verfahren um die mutmaßlichen Schleuser musste neu aufgerollt werden. Kritzmöller wurde Mitte März 2023 als Schöffin enthoben. Das Thüringer Oberlandesgericht begründete das im Übrigen damit, dass Kritzmöller gegen das für Richterinnen geltende Mäßigungsgebot verstoßen habe. Und nicht mit einer verfassungsfeindlichen Einstellung.
Schöffen-Listen sind nicht öffentlich zugänglich
Dass Medien von verfassungsfeindlichen Schöffen erfahren, ist dabei eher Zufall. Denn Listen der Schöffen und Schöffinnen eines Gerichtsbezirks sind nicht öffentlich zugänglich. Um das zu ändern, fragte CORRECTIV.Lokal bei den Justizministerien der Länder und den Oberlandesgerichten die Namen aller Schöffen und Schöffinnen an – ohne Erfolg.
Medien können dadurch kaum systematisch überprüfen, wer vor Ort eigentlich als ehrenamtliche Richterin urteilt. Andreas Höhne vom Bundesverband ehrenamtlicher Richter und Richterinnen wünscht sich, dass sich das ändert: „Jeder soll wissen können, wer Schöffe ist.“
Derzeit soll die öffentliche Kontrolle vor allem während der Wahl zum Schöffenamt erfolgen. Kandidatinnen bewerben sich bei ihrer Gemeinde. Diese soll die Bewerberinnen überprüfen, zum Beispiel darauf, ob sie die formalen Kriterien für das Amt erfüllen wie den Besitz der deutschen Staatsangehörigkeit – und ob sie extremistisch und damit ungeeignet als Schöffen sind.
Kaum Öffentlichkeit und Transparenz bei der Schöffenwahl
„Es lastet eine große Verantwortung bei den Kommunen“, sagt Höhne. Dieser Verantwortung seien sich aber nicht alle Gemeinden bewusst. Das legt auch eine Recherche des BR zur Schöffenwahl 2023 nahe: Einige der größten bayerischen Städte überprüften die Bewerberinnen fürs Schöffenamt kaum.
Aus den Bewerbungen stellt die Gemeinde eine Vorschlagsliste der Kandidaten zusammen. Daraufhin beginnt – in der Theorie – die öffentliche Kontrolle. Doch der Prozess ist kaum bekannt: Die Vorschlagsliste mit den Namen der Bewerberinnen und Bewerber wird für eine Woche in der Gemeinde ausgelegt, zum Beispiel im Rathaus. In dieser Zeit können Bürgerinnen und Bürger begründete Einsprüche gegen einzelne Kandidierende erheben – zum Beispiel weil ein Bewerber in den sozialen Netzwerken gegen Juden hetzt.
Doch häufig wissen die Menschen gar nicht, dass sie sich hier einbringen können: Die Recherche des BR aus dem Jahr 2023 zeigte, dass in keiner der elf größten Städte Bayerns ein Hinweis von Bürgerinnen auf eine verfassungsfeindliche Haltung einging.
Im nächsten Schritt übermittelt die Gemeinde die Vorschlagsliste zusammen mit den eingegangenen Einsprüchen an das jeweilige Amtsgericht. Dort kommt ein Wahlausschuss zusammen – bestehend aus einem Richter, einer Verwaltungsbeamtin und kommunalen Vertrauensleuten. Häufig sind das lokale Politiker und Politikerinnen. Der Ausschuss entscheidet über die Einsprüche und wählt aus den Vorschlagslisten die Schöffen und Schöffinnen für den Gerichtsbezirk. Dafür hat er oft kaum mehr Informationen als die Namen, das Geschlecht, das Alter, den Wohnort und den Beruf der Personen. Teilweise muss der Wahlausschuss über hunderte Bewerberinnen und Bewerber abstimmen.
„Ich muss mich darauf verlassen, dass die Gemeinden gute Vorschläge gemacht haben“, sagt Anja Farries, Direktorin des Amtsgerichts Eutin in Schleswig-Holstein. Sie ist selbst seit Jahren Vorsitzende des dortigen Schöffenwahlausschusses. Sie müsse sich darauf verlassen, dass die Gemeinden Demokraten vorschlagen und keine Menschen, die nicht auf dem Boden der Verfassung stehen. Denn sie selbst könne das gar nicht überprüfen.
Nach Schöffenwahl: Keine grundsätzliche Überprüfung der Verfassungstreue
In manchen Bundesländern wie Sachsen, Brandenburg und Bayern sollen die Vorsitzenden Richter des Ausschusses nach der Wahl einen Bundeszentralregisterauszug für die neuen Schöffen anfordern – um zu überprüfen, ob ein Schöffe beispielsweise wegen Volksverhetzung verurteilt wurde. Andere Bundesländer fordern das nicht. Wie unterschiedlich die Länder vorgehen, zeigte zuletzt auch eine Recherche von Legal Tribune Online.
Die Justizministerien der Länder scheinen sehr unterschiedlich zu bewerten, wie groß die Gefahr durch potentiell verfassungsfeindliche Schöffinnen und Schöffen ist und was dagegen getan werden sollte. Auch nach den Aufrufen von Rechtsextremen, das Amt zu unterwandern. Auch nachdem Reichsbürger Schöffen wurden.
Niedersachsen etwa schreibt auf Anfrage von CORRECTIV.Lokal: Es sei festzustellen, „dass keine grundsätzlichen Zweifel an der Verfassungstreue der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter in Niedersachsen bestehen. Eine grundsätzliche Überprüfung der Verfassungstreue der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter findet entsprechend nicht statt“.
Dabei kam es am Landgericht Braunschweig im Februar, kurz nach Beginn der aktuellen Amtszeit der Schöffen, bereits zum Ausschluss einer Schöffin bei einem Prozess – weil sie gegen Grundsätze des Rechtsstaates verstieß: Im Verfahren gegen den mehrfach verurteilten Sexualstraftäter Christian B., der auch verdächtigt wird, die 2007 verschwundene Madeleine McCann getötet zu haben, wurde eine Schöffin ausgeschlossen, weil sie auf Facebook zum Mord an Jair Bolsonaro aufgerufen hatte. Es war der erste Prozess, an dem die Schöffin beteiligt war.
Neuer Gesetzentwurf der Bundesregierung
Ein aktueller Gesetzentwurf der Bundesregierung sieht vor, dass ein Gericht als fehlerhaft besetzt gilt, wenn eine Schöffin die Verfassung ablehnt. Das hätte weitreichende Folgen für Verfahren: Staatsanwälte und Verteidigerinnen könnten beanstanden, dass es Zweifel an der Verfassungstreue einer Schöffin gebe – und dann müsste dies im Rahmen des Verfahrens überprüft werden. Also in der Öffentlichkeit. Und nicht wie jetzt in einem gerichtsinternen Prozess.
Marc Petit, Vorsitzender Richter am Landgericht Lübeck und Bundesvorstand der Neuen Richtervereinigung, begrüßt die Gesetzesinitiative der Bundesregierung. Denn durch die öffentliche Verhandlung könne die Presse kritische Fragen stellen – etwa wie es überhaupt passieren konnte, dass niemand vorher bemerkt hat, dass die betroffene Person nie hätte Schöffe werden dürfen.
„Das kriegt eine ganz andere Brisanz, wenn der Bürgermeister sich dieser Frage einmal öffentlich stellen muss“, sagt Petit. Er sei optimistisch, dass dieser danach die Abläufe in seiner Gemeinde optimiere. „Dann passiert so was potenziell nicht wieder.“
Ob, in welcher Form und wann der Gesetzentwurf der Bundesregierung verabschiedet wird, ist unklar. Das Kabinett beschloss den Entwurf im Juli 2023. Seitdem liegt er im Rechtsausschuss des Bundestages. Wie die Verfassungstreue der Bewerberinnen und Bewerber für das Schöffenamt überprüft werden soll – das legt der Gesetzentwurf nicht fest.
Sie haben Hinweise dazu, dass bei Ihnen in der Region verfassungsfeindliche Schöffinnen und Schöffen aktuell im Amt sind? Dann schreiben Sie uns an lokal@correctiv.org oder für sensible Informationen eine verschlüsselte Nachricht über unseren anonymen Briefkasten. CORRECTIV.Lokal arbeitet bei dieser Recherche mit Lokal- und Regionalmedien in allen Bundesländern zusammen, die in der Lage sind, auch Hinweise auf einzelne Fälle zu verfolgen.
Text und Recherche: Miriam Lenz, Tim Wurster
Redaktion: Jonathan Sachse
Illustration: Ivo Mayr
Kommunikation: Valentin Zick, Esther Ecke
Faktencheck: Pia Siber