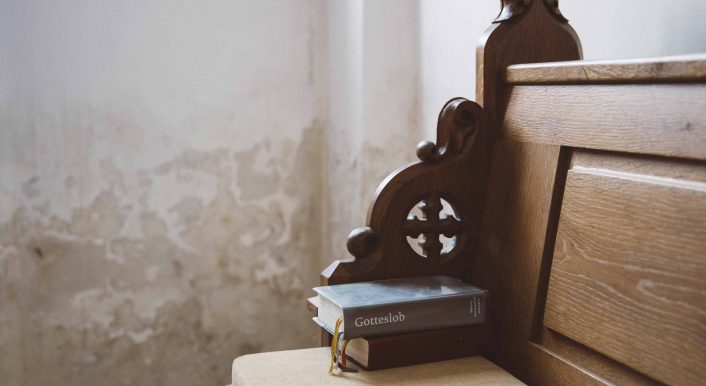Klerikaler Missbrauchsprozess: Die Widersprüche des Essener Bistums
Am Landgericht Essen kämpft ein Betroffener von klerikalem Missbrauch um Gerechtigkeit. Dabei hat er jetzt schon ein Stück weit gewonnen: Ihm gehe es vor allem darum, dass vor Gericht festgehalten wird, was der Serientäter Peter H. ihm und anderen Betroffenen angetan hat. Währenddessen verstrickt sich das Bistum in seiner Verteidigung in Widersprüchen.

Am Freitag fällt am Landgericht Essen eine Entscheidung. Es könnte der Tag sein, auf den Wilfried Fesselmann und sein Rechtsanwalt Andreas Schulz vier Jahre lang hingearbeitet haben. In dem Zivilprozess klagt Fesselmann gegen das Bistum Essen. Er fordert 300.000 Euro Schmerzensgeld, weil er 1979 vom damaligen Kaplan Peter H. im Gemeindehaus missbraucht wurde. CORRECTIV berichtete über den Fall.
Bemerkenswert ist: Der vorsitzende Richter hat bereits erklärt, auch ohne weitere Zeugen dem Betroffenen zu glauben – und so das Verfahren abgekürzt. Nach nur einem Verhandlungstermin könnte am Freitag ein Urteil fallen, wenn das Gericht nicht doch einen Gutachter beauftragt.
Beklagter ist nicht der Täter, sondern das Bistum Essen. Im Zivilprozess musste es bislang zwei Niederlagen hinnehmen. Das Bistum hat zwar darauf verzichtet, sich auf nicht Verjährung des Falls zu berufen, versuchte aber die Ansprüche des Kläger abzuwehren. Dabei zeigen sich Widersprüche in der Strategie der Anwälte und des Bistums.
Die Bagatellisierung: Sexueller Übergriff statt Missbrauch
Die Anwälte des Bistums stützten ihre Verteidigung vor allem auf zwei Punkte: Sie bestreiten, das Bistum müsse für den Schaden aufkommen. Und sie versuchten, die Schwere der Tat herunterzuspielen. Beides hielt vor Gericht nicht stand.
Vor Gericht schilderte der Betroffene Fesselmann den Ablauf des Abends so: Im Sommer 1979 habe der damalige Kaplan ihn vermeintlich zu einem Fernsehabend eingeladen. Nachdem sie sich unterhalten hatten, habe H. die Türen verschlossen, dem damals Elfjährigen etwas Alkoholisches verabreicht und ihn zum Oralverkehr gezwungen. Er habe sich ausziehen müssen, sie hätten sich nackt ins Bett gelegt und H. habe versucht, ihn zu berühren.
Der Ex-Priester war vor Gericht als Zeuge geladen, 46 Jahre nach der Nacht sahen sich Täter und Opfer zum ersten Mal wieder. H. bestätigte die Schilderungen von Fesselmann – bestritt jedoch den Oralverkehr. Er bezeichnete die Tat lediglich als „sexuell übergriffig“.
Der Generalvikar des Bistums, Klaus Pfeffer, sagte CORRECTIV im Anschluss an den Gerichtstermin, ihm sei bei dieser Aussage „wirklich übel geworden.“
„Er hat zwar zugegeben, dass er ein Missbrauchstäter ist, dass er pädophil ist, aber er hat das in einer Art und Weise getan, wo ich gedacht habe, das ist eine Bagatellisierung. Vor allem, als sinngemäß der Satz fiel: Ja, dann ist es eben zu ein paar Übergriffen gekommen. Das fand ich unerträglich, sich das anhören zu müssen.“
Die Empörung des Generalvikars verwundert. Denn die „Bagatellisierung“ war Teil der Verteidigung des Bistums: In ihren Schriftsätzen argumentierten die Anwälte, die Tat sei „selbstverständlich vollkommen inakzeptabel“, aber es habe sich um „übergriffiges (…) Verhalten“ gehandelt. Weil H. den Oralverkehr bestreitet, liege „kein sexueller Missbrauch, sondern eine sexuelle Belästigung“ vor.
CORRECTIV wollte vom Essener Bischof Franz-Josef Overbeck und seinem Generalvikar wissen, wie sie diesen Widerspruch erklären. Sie waren für eine Stellungnahme nicht zu erreichen, der Pressesprecher verwies auf das laufende Verfahren.
Die Anwälte des Bistums ignorieren Informationen aus einer Studie
Wilfried Fesselmann war nicht das erste Opfer von Peter H. – und nicht das letzte. Der Serientäter begann seine Karriere als Kaplan in Bottrop. Bereits dort verging er sich an Kindern. Kurz darauf versetzte ihn das Bistum in die Gemeinde St. Andreas in Essen, wo er neben Fesselmann mindestens drei weitere Jungen missbrauchte.
Die Anwälte des Bistums behaupten in ihren Schriftsätzen, der Wechsel von Bottrop nach Essen sei Routine gewesen. Vor 2010 habe man in Essen nichts von Missbrauchsvorwürfen in der Bottroper Gemeinde gewusst und dementsprechend durch die Versetzung nichts vertuschen können.
Damit versuchen sie, die Amtshaftung abzuwehren. Diese Regelung aus dem Beamtenrecht besagt, dass bei Fehlverhalten eines Beamten der Staat haftet, nicht die Person. Die Anwälte argumentierten, H. habe die Tat als Kaplan, nicht als Pastor begangen, weshalb die Amtshaftung nicht greife. Ein Kaplan steht einem Priester in seiner Gemeinde als Helfer und Vertreter zur Seite, trägt aber weniger Verantwortung.
Was die Anwälte verschwiegen: 2023 erschien eine Studie zu klerikalem Missbrauch in Essen, die das Bistum selbst in Auftrag gegeben hatte. Darin wurde auch der Fall Peter H. untersucht. Die Autorinnen und Autoren fanden in den Akten des Bistums zwar tatsächlich „keinen Hinweis“ darauf, dass die Bistumsleitung vor 2010 von den Fällen in Bottrop wusste. Doch sie zeigte, dass eine Mutter den damaligen Kaplan wegen einer „unguten Beziehung“ zu ihren Söhnen gemeldet hatte: In der Studie heißt es:
„Die Anzeige der Mutter bei dem Gemeindepfarrer geht weit über ein Aufdeckungspotenzial hinaus. Die Mutter hat die pädokriminellen Handlungen des Kaplans gegen ihren Sohn (oder sogar ihre Söhne) offengelegt und damit eine Verdeckungsmaschinerie des Bistums in Gang gesetzt. Die Verantwortlichen griffen zu dem klassischen Mittel der Versetzung innerhalb des Bistums.“
Die eigene Studie geht also über den Aktenbestand hinaus. Doch die Anwälte des Bistums unterschlugen diese Erkenntnisse, die das Bistum selbst einholen ließ.
Der Klägeranwalt Andreas Schulz bedauerte, dass der Richter auf die Einsicht in die Personalakte des Priesters verzichtete, obwohl das Bistum sie zur Verfügung gestellt hätte und der Kläger darum bat. Die Akte hätte die Widersprüche vielleicht aufklären können – und aufgezeigt, welche Folgen das Handeln des Bistum Essen hatte:
Denn die Akte enthält auch die 1986 von Joseph Kardinal Ratzinger – dem späteren Papst Benedikt XVI. – unterschriebene Erlaubnis, dass H. nach einem Gerichtsurteil wegen Missbrauch trotzdem die Messe feiern durfte – nur eben mit Traubensaft. Ratzinger garantierte somit einen Wiedereinsatz des Täters, obwohl er von den Sexualstraftaten wusste, als er den Brief unterschrieb. Eine Einsicht in die Akte vor Gericht hätte Klarheit über das Aufklärungsinteresse des Bistums Essen schaffen können.
Text und Recherche: Anna Kassin, Marcus Bensmann, Cem Bozdoğan
Redaktion und Faktencheck: Annika Joeres, Pia Siber, Anette Dowideit