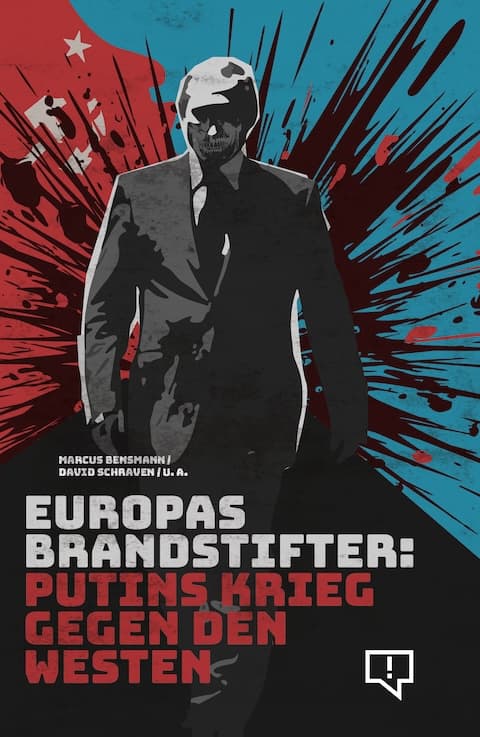Bundeswehr trimmt Städte und Gemeinden auf Kriegstüchtigkeit
Hochrangige Vertreter der Bundeswehr statten seit einigen Wochen Bürgermeistern und Landräten bundesweit Besuche ab – und legen ihnen nahe, ihre Kommunen auf die gestiegene Gefahr eines Krieges auf deutschem Boden vorzubereiten. Die Bundeswehr bestätigt die Maßnahme.

Die Bundeswehr dringt bei deutschen Städten und Gemeinden darauf, sich auf einen drohenden Krieg auf deutschem Boden vorzubereiten. Wie CORRECTIV aus mehreren Landkreisen und Städten übereinstimmend erfuhr, haben viele von ihnen in den vergangenen Wochen Besuch von hochrangigen Offizieren der Bundeswehr erhalten. Mit den als vertraulich eingestuften Treffen bezweckt die Truppe demnach, die Städte auf einen Ausbau ihrer Kriegstüchtigkeit zu trimmen.
Die Bundeswehr bestätigte dieses Vorgehen auf Anfrage von CORRECTIV. Seit längerem würden „zahlreiche Gespräche insbesondere mit Vertretern der Länder geführt“, erklärte eine Sprecherin des Operativen Führungskommandos der Bundeswehr. Die Gespräche seien Teil des sogenannten „Operationsplans Deutschland“.
Ziel dieses Plans, den die Bundeswehr bereits im Februar dem Deutschen Landkreistag vorstellte: Deutschlands Infrastruktur bestmöglich auf den Fall eines Krieges auf deutschem Boden oder in Osteuropa vorzubereiten und so eine ausreichende Abschreckung auf alle Szenarien zu bieten, damit ein Angriff auf Deutschland und ein Krieg vermieden werden könne. Entstanden sei der Plan laut einer Präsentation auf der Webseite der Bundeswehr als Reaktion auf den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine und diene der Sicherung der NATO-Ostflanke. Er wird kontinuierlich unter der Verantwortung des Operativen Führungskommandos der Bundeswehr weiterentwickelt.

Auf CORRECTIV-Anfrage teilte die Bundeswehr mit: Die Gespräche mit den Landräten und Bürgermeistern seien Teil des sogenannten „OPLAN DEU“. Mit diesem wolle die Bundeswehr dafür sorgen, dass „die zentralen militärischen Anteile der Landes- und Bündnisverteidigung mit den dafür erforderlichen zivilen Unterstützungsleistungen“ zusammengeführt würden. Ziel: „Im Krisen- und Konfliktfall“ solle „nach erfolgter politischer Entscheidung zielgerichtet und im verfassungsrechtlichen Rahmen gehandelt werden“ können.
Welche kritischen Infrastrukturen gibt es – und wie schützt man sie?
Mehrere Bürgermeister und Landräte schilderten gegenüber CORRECTIV, worum es in den Treffen mit den Bundeswehr-Vertretern konkret ging: So müssten kritische Infrastrukturen identifiziert werden, wie wichtige Kreuzungen, Brücken oder Notbrunnen. Für diese müssten Heimatschutz-Konzepte vorgelegt werden, um Saboteure abzufangen oder Anschläge zu verhindern. Hier müsse geklärt werden, wer genau die Anlagen schützen solle: lokale Einheiten der Polizei, des Heimatschutzes oder der Bundeswehr? Zudem müssten für die Infrastrukturen Konzepte aufgestellt werden, wie sie nach einem Bombenbeschuss möglichst schnell wieder instand gesetzt werden könnten, um weiter zu funktionieren.
Dazu käme die Wiederherstellung von Zivilschutzanlagen und Bunkern. In vielen Städten seien die wenigen Atomschutzbunker nicht mehr intakt. Für Großstädte müssten Pläne für die Evakuierung und den Aufbau von Sammelplätzen für Vertriebene aufgestellt werden, um Fluchtwege für zehntausende Menschen vorzubereiten – auch für zu erwartende Binnenflüchtlinge.
Zudem müssten zugeschüttete Kellerverbindungen in Innenstädten wieder freigeräumt werden, um überlebende Bombenopfer aus eingestürzten Häusern retten zu können. Ein Landrat sagte: „Wir müssen auf alles vorbereitet sein.“
Die Planungsarbeiten haben den Informationen zufolge im März 2025 begonnen und sollen bis Herbst 2025 abgeschlossen sein. Als dritter Schritt des OPLAN DEU soll dann im Frühjahr 2026 die Umsetzung der Sicherungsmaßnahmen festgelegt werden. Mit anderen Worten: Dieser Plan wurde bereits zweimal überarbeitet und angepasst – jeweils im März 2024 und 2025. Die dritte Version soll nun die endgültigen Schritte für die Umsetzung der Maßnahmen enthalten.
Geheim tagende Ausschüsse in den Kommunen
In den Kommunen stehen bereits jetzt geheim tagende politische Ausschüsse von Räten oder Kreistagen bereit, die Notmaßnahmen der Verwaltung absegnen sollen. Das Problem dieser kommunalen Geheimgremien sei oft, dass die dort tagenden Politiker oft kein Fachwissen zu den Entscheidungen haben, die sie treffen müssen, berichtet ein Mitglied eines dieser Ausschüsse.
Aufgrund des Geheimnisschutzes könnten sie sich nicht ausreichend beraten. „Wir fühlen uns überfordert”, sagt ein Mitglied eines dieser Gremien in NRW. Diese Gremien seien im Kalten Krieg etabliert worden, um die zivile und militärische Zusammenarbeit zu koordinieren. Leider sei im Zuge der Entspannung in den vergangenen 30 Jahren die Arbeit der Gremien nicht mehr vertieft worden. „Hier ist viel Wissen in den Kommunen verloren gegangen.“, sagt das Mitglied aus NRW.
Aus einer Power Point-Präsentation, mit der die Bundeswehr die groben Inhalte des Operationsplans im Februar dem Landkreistag vorstellte, gehen weitere Details hervor. Der „Operationsplan Deutschland” (OPLAN DEU) selbst ist geheim.
In der Präsentation heißt es, die Kommunen müssten ihren Beitrag dazu leisten, dass Deutschland im Kriegsfall zur „Drehscheibe“ für die alliierten Kräfte der NATO werde. Hierzu gehört demnach, dass die Städte und Gemeinden Vorkehrungen für das „verzuglose Marschieren von Marschteileinheiten“ treffen müssten – also Straßen und Brücken beispielsweise für Panzer befahrbar machen müssten. Zudem müssten die Kommunen die medizinische und logistische Versorgung von Truppen sicherstellen.
Weiter sind in dem Plan Routen und Sammelpunkte für Binnenflüchtlinge von Osten nach Westen und für den Abtransport von verletzten und getöteten Soldaten eingetragen. Kriegsgefangene sollen nach Möglichkeit auch über Nordseehäfen wie in Bremerhaven nach Übersee transportiert werden.
Die Kommunen sollen dazu beitragen, die Lagebilder realistisch abzubilden und die Menschen in den Städten für die Gefahren zu sensibilisieren.
Im Januar 2024 hatte die Bundeswehr ihren „OPLAN DEU“ bereits bei einer Pressekonferenz in Berlin vorgestellt – allerdings keine Details zur Rolle der Städte und Gemeinden genannt. Damals kündigte sie vor allem an, sich für eine Sicherstellung von Logistik für die Truppe im Kriegsfall mit Katastrophenschutzeinrichtungen, Nachrichtendiensten und Energiekonzernen vernetzen zu wollen.
Bundesakademie für Sicherheitspolitik beschreibt mögliches Szenario
Ein Bild dessen, womit die Bundeswehr rechnet, hatte eine in diesem Januar vorgestellten Arbeitspapier der Bundesakademie für Sicherheitspolitik gezeichnet. Darin heißt es:
„Man stelle sich dazu einmal vor, dass es im Jahr 2029 über Wochen verteilt in Deutschland zu multiplen, offenbar mutwillig herbeigeführten großflächigen Waldbränden, Cyberangriffen auf das Bahn- und Energienetz, Störungen der Satellitenkommunikation und vermeintlichen „Unfällen“ mit Todesfolge von Funktionsträgern in Verwaltung und Bundeswehr sowie einzelnen Drohnenangriffen auf Chemieanlagen, einschließlich Toten und Verletzten, kommt.
Man stelle sich dann vor, Russland führt im selben Zeitraum eine plötzliche Großübung von Streitkräften in Belarus durch, in direkter Grenznähe zu Litauen, verbunden mit nuklearen Drohungen. Man stelle sich weiter vor, diese Drohungen werden mit dem angeblichen Test einer nuklear bestückbaren Trägerrakete in der Ostsee knapp außerhalb der deutschen Territorialgewässer verknüpft und mit Seeaktivitäten entlang kritischer Unterwasserinfrastruktur untermauert.
Undenkbar? Die Möglichkeiten dazu besitzt Russland schon jetzt; den Willen zur Gewalt, gerade auch gegen zivile Ziele, offenbart der Kreml täglich in der Ukraine. Das Ziel wäre für Russland hierbei schon erreicht, wenn sich in der Allgemeinheit bereits frühzeitig ein Gefühl der Hoffnungs- und Wehrlosigkeit bahnbricht.“
Die Planungen am Operationsplan Deutschland sollen sichtbar die deutsche Verteidigungsbereitschaft herstellen, um eine ausreichende Abschreckung auf alle Szenarien zu bieten. Damit Russland nicht angreift und ein Krieg vermieden wird.
Auch Wirtschaft gefordert
Neben den Kommunen soll auch die deutsche Wirtschaft mobilisiert werden. Unternehmen sollen sich darauf vorbereiten, wehrfähige Mitarbeiter für den Kriegsfall abzustellen, berichtet der Bayerischer Verband für Sicherheit in der Wirtschaft. Er informiert, dass auch der Unterstützungsbedarf durch die private Wirtschaft im OPLAN DEU definiert wird.
Die Vorbereitung betrifft vor allem die Personalpolitik in den Betrieben. Sollte nämlich ein Spannungs- oder Verteidigungsfall ausgerufen werden, könnte jederzeit die derzeit ausgesetzte Wehrpflicht für alle männlichen Deutschen im Alter von 18 bis 60 Jahren reaktiviert werden.
Das bedeutet: Männer könnten unmittelbar zum Wehrdienst einberufen werden. Frauen können nach derzeitiger Gesetzgebung nur im Verteidigungsfall zu bestimmten Diensten herangezogen werden. Die entstehenden Personallücken in der Produktion und Verwaltung müssen die Betriebe selbst ausgleichen. Nur unter wenigen Voraussetzungen kann ein Unternehmen eine sogenannte „Unabkömmlichstellung“ bekommen, wenn das öffentliche Interesse an der Tätigkeit im Unternehmen höher ist als am Einsatz in der Verteidigung.
Gleichzeitig müssen auch die notwendigen Produkte lückenlos her- und bei Bedarf für die Verteidigung bereitgestellt werden. Auch darauf müssen sich die Firmen vorbereiten. Die Bundeswehr kann Lagermaterial, Waren, Maschinen, Fahrzeuge und Produkte einziehen, wenn dies notwendig ist. Selbst Grundstücke können im Spannungs- oder Verteidigungsfall theoretisch beschlagnahmt oder enteignet werden – etwa zum Bau von Festungsanlagen oder Sammelpunkten. Das hat Konsequenzen für die Unternehmen, auf die sich diese vorbereiten müssen – etwa durch eine entsprechende Vertragsgestaltung. Diese Eingriffsrechte der Verteidigung betreffen nahezu alle Wirtschaftssektoren.
Unternehmen könnten im Ernstfall zwangsweise zur Landesverteidigung herangezogen werden – mit massiven Eingriffen in ihre Autonomie, ohne direkte Gegenleistung und mit unkalkulierbaren Risiken für ihre Existenz. Der Klageweg wird ausgeschlossen.