Kind im Brunnen: Helikopter-Staat
Kinder bedeuten Zukunft. Unterstützung und Chancengleichheit für die nächste Generation entscheiden über den Erfolg eines Landes. Wie ist es um die Jugendhilfe in NRW bestellt – mit der Betreuung durchs Jugendamt? Was hat Krafts Prestigeprojekt „Kein Kind zurücklassen!“ erreicht? Und was muss nach fünf Jahren rot-grüner Regierung kommen? Zusammen mit einem erfahrenen Sozialarbeiter haben wir seit Monaten recherchiert. Die Ergebnisse haben den Umfang eines Buches angenommen. „Kind im Brunnen“ – die exklusive Serie zum Buch. Heute: Helikopter-Staat (X)

© Vincent Burmeister
Politik ist wie die Fahrt auf einer Ausfallstraße in Wahlkampfzeiten. Wir sehen Motive auf uns zukommen und lassen sie hinter uns. „Kein Kind zurücklassen“ stand eben noch bunt auf einem Reklameschild. Dann kommt ein neues.
Der Slogan hat einige Jahre auf dem Buckel und eine interessante Geschichte, sowohl in Deutschland als auch in den USA, wo das Copyright liegen dürfte. Mit „No Child Left Behind“ schaffte George W. Bush 2001 den Einzug ins Weiße Haus. Der Satz mit Pathos, das leicht abgewandelte Zitat von der Front wird dem „Ungedienten“ George W. geholfen haben.
Die Folgen unserer Serie „Kind im Brunnen“
Folgen, die erschienen sind, werden verlinkt. Die ausstehenden Folgen veröffentlichen wir in den kommenden Wochen.
„No Man Left Behind“ ist die eiserne Regel der US-Marines: Keiner fällt dem Gegner in die Hände, Verletzte werden rausgeholt. Zur Not mit Hubschrauber, offene Luke, MG-Salven, Männer schweben an Strickleitern über Feindesland. In den USA störte sich offenbar niemand an dem martialischen Kinder-Soldatenspruch. Im Gegenteil. Der „No Child Left Behind Act“, eine Reform des staatlichen Schulwesens in den USA, wurde 2002 in breiter Mehrheit beschlossen. Mit seiner nordrhein-westfälischen Variante, den Präventionsketten in den Kommunen für ein gelingendes Aufwachsen, teilt das US-Gesetz nur den schmissigen Namen.
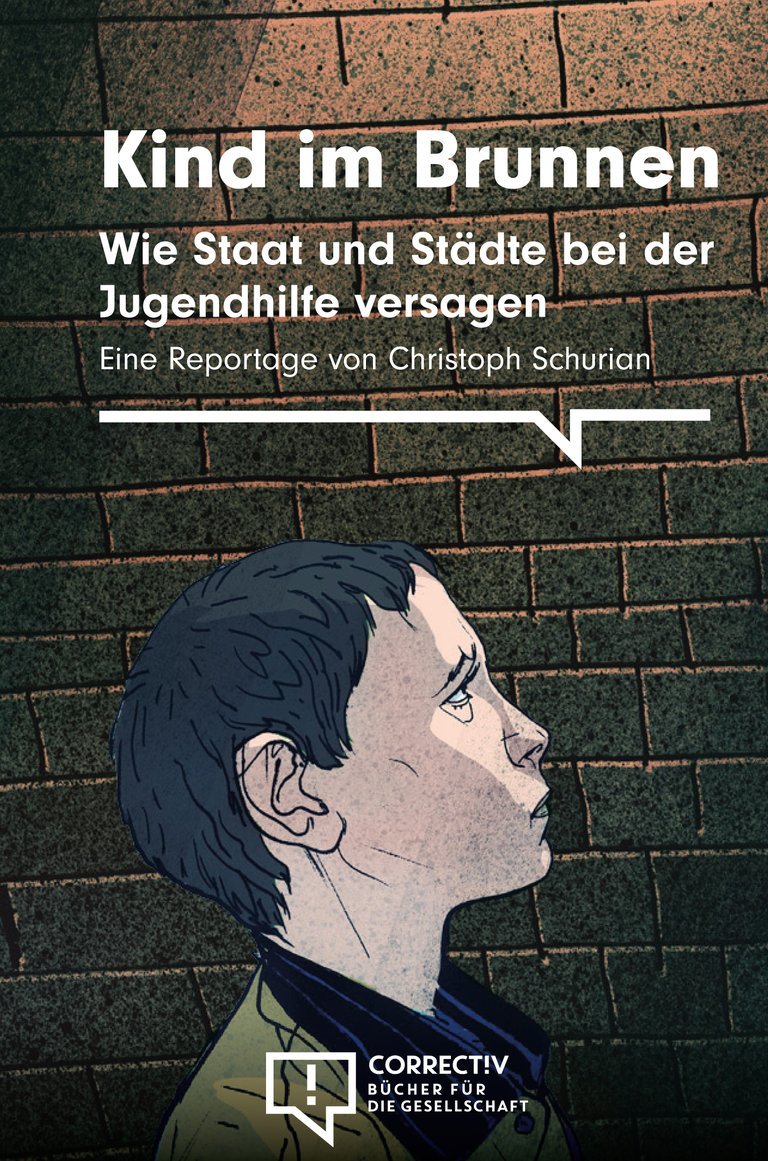
Unser Buch zur Serie „Kind im Brunnen“ kann in unserem Shop bestellt werden.
Auf deutsch klingt „Kein Kind zurücklassen!“ weniger nach Camouflage und Dschungelkrieg, sondern nach Wandertag in Zweierreihen. Vorn und hinten wachen die Kindergärtnerinnen über den kleinen Zug in neongelben Warnwesten. Es ist ein Satz wie gemalt für potenzielle sozialdemokratische Wähler; die SPD nennt die seit zehn Jahren die „solidarische Mehrheit“.
Vor Martin Schulz hatte die SPD schon einmal einen Parteivorsitzenden aus dem Rheinland, aus Rheinland-Pfalz. Auch Kurt Beck versuchte den Sozialdemokraten Hoffnung zurückzugeben, diesmal nach der Abwahl von Kanzler Gerhard Schröder, den Protesten gegen die Agenda 2010 und dem Erstarken der Linken. Er war damit nicht sehr erfolgreich. Aber die Verabschiedung eines neuen Grundsatzprogramms fällt in seine Zeit: das „Hamburger Programm“. Es scheint sich um ein Lieblingsbuch von Hannelore Kraft und der Landes-SPD zu handeln.
Der „vorsorgende Sozialstaat“
Im Hamburger Programm wird nicht gespart mit großen Worten. Es gehe um nicht weniger als die „Entscheidungsfrage, ob das noch junge Jahrhundert Frieden und Wohlfahrt“ für alle Menschen bringe, schreibt Kurt Beck im Vorwort. Und weiter: „Mit der solidarischen Mehrheit werde der vorsorgende Sozialstaat entwickelt, der Armut bekämpft, den Menschen gleiche Chancen auf ein selbstbestimmtes Leben eröffnet (…) wir wollen kein Kind zurücklassen.“ Der damalige SPD-Generalsekretär und „Programmdirektor“ Hubertus Heil brachte die Gedanken zu „kein Kind zurücklassen“ und „vorsorgender Sozialstaat“ noch klarer auf den Punkt:
„Der Sozialstaat, den wir bislang kennen, verfolgt zu sehr nachsorgende Ziele. Er wird oft erst richtig aktiv, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Er kümmert sich wenig darum, Krankheiten, Arbeitslosigkeit, Bildungsmangel von vornherein zu verhindern. Der vorsorgende und in die Menschen investierende Staat fördert Beschäftigung, setzt auf Gesundheitsprävention und verhindert Armut (…) Wenn wir das tun, dann wird es auch immer weniger Menschen geben, um die wir uns im Nachhinein kümmern müssen, die nämlich durch einen Rost gefallen sind.“
Das Kursbuch von Hannelore Kraft und ihrer Landesregierung wurde also vor mehr als zehn Jahren in der SPD-Parteispitze geschrieben, Wort für Wort. Die vorbeugende beziehungsweise „vorsorgende Politik“ wurde bereits 2007 auf die Agenda nach der „Agenda 2010“ gesetzt. Zusammen übrigens mit einem neuen alten sozialdemokratischen Versprechen, dem „demokratischen Sozialismus“. Im Superwahljahr 2017 erinnert sich die NRW-SPD besonders intensiv ihres Hamburger Grundsatzprogramms und seiner Thesen. Als ob die 79 Seiten etwas reifen mussten.
Das NRW-Wahlprogramm nennt sich „NRW-Plan für die solidarische Mehrheit“. Und wenn sich alle angesprochen fühlen, die für die SPD zur „solidarischen Mehrheit“ gehören – also „Arbeitnehmer“, „Ehrenamtliche“, „Frauen und Männer“, „Familien“, dazu „Wissenschaftler und Existenzgründer“, außerdem „Kulturschaffende“, „Menschen, die Zugang zum Arbeitsmarkt suchen“ und natürlich „Rentner“ – dann ist die Partei wirklich bald wieder das, was sie Ende der 1960er, Anfang der 1970er Jahre darstellte. Die strukturelle, äh, solidarische Mehrheit. Mindestens.
Sound of Sozialpolitik
Zurück nach Düsseldorf, zurück zur Rede der Ministerpräsidentin vor der AWO im März, Solidarische unter sich. Hannelore Kraft berichtete von ihren Reisen nach Nordamerika, etwa nach Kalifornien oder in die kanadische Provinz Ontario, über die Frage wie Übergänge zwischen Familie, Kita, Schule und Ausbildung gelingen, wie man keine Talente verliere. Nordrhein-Westfalen setze deshalb auf Talentscouts, auf „Kein Abschluss ohne Anschluss“, den Ausbildungskonsens. Und investiere Milliarden in Kinder, Bildung und Familien.
Man habe sich auf den Weg gemacht mit „langem Atem“. Kraft spricht frei, noch ohne Wahlkampftimbre, weicht vom Manuskript ab. In einem Nebensatz, etwas vernuschelt, fast geht es unter, sagt sie, eigentlich müsse die Präventionskette ja schon bei „No Means No“, bei „Nein heißt Nein“ beginnen. Der neue Sound of Sozialpolitik. Vorbeugen ist besser als heilen. Finde nur ich das gruselig?
Als sich die SPD vor zehn Jahren zum vorsorgenden Sozialstaat bekannte, wurde auf dem Parteitag in Hamburg auch gestritten. Es gab die Angst kritischer Genossen, wer auf Prävention setze, vernachlässige wohlmöglich die Nöte der Menschen, denen es jetzt schlecht gehe, die jetzt auf staatliche Unterstützung angewiesen wären. Könnte sein. Aber mehr als soziale Kahlschläge in der Gegenwart drohte seit Hamburg eine andere Gefahr.
Hannelore Kraft ist – auch wenn sie vom Kanzlerkandidaten Martin Schulz dazu ernannt wurde – nicht das „soziale Gewissen“ der Republik, sondern eine kühl Überzeugte. Sie glaubt an Prävention, langfristig an das Vermeiden von sozialen Reparaturkosten, an den „Return of Invest“ für den Sozialstaat. Fiskalisch ist das eine unsichere Wette auf die Zukunft. Niemand kann vorhersagen, ob sich die Milliarden für Kitas, für Hilfen zur Erziehung, frühe Hilfen wirklich rentieren. Noch ob sie auf Dauer überhaupt bezahlbar sind in schlechteren Zeiten für öffentliche Haushalten. Und außerdem ist es eine Art staatliche Amtsvormundschaft für die Abgehängten und deren (künftige) Kinder.
Vorbeugen besser als heilen?
Wer behauptet, zu wissen, wie durch Prävention wirksam Armut, Bildungsarmut vermieden wird, wie Sucht, Gewalt, Diskriminierung und die Schrecken von Traumata gebannt werden, der müsste das alles schon jetzt beherzigen und daran arbeiten. Müsste schon jetzt ein Jugendhilfesystem aufgebaut haben, das trotz gewaltigem Aufwand von Engagement, Personal und Geld gute, wenigstens bessere Ergebnisse erzielt. Und nicht für hunderttausende Beziehungsabbrüche steht, für Jugendamtskarrieren, für mangelnde Mitwirkungsmöglichkeiten. Das alles ist aber nicht der Fall, sondern häufig das Gegenteil.
Ist vorbeugen wirklich besser als heilen? Es gibt einen ähnlichen Diskurs in der Kriminologie. Manche Forscher meinen, die Polizei könne demnächst bereits einschreiten, bevor eine Tat geschieht, weil es ihr aufgrund von Daten möglich würde, vorherzusagen, wann und wo und durch wen etwas geschieht. Man muss fürchten, die sozialpolitische Umsetzung dieses monströsen Gedankens nennt sich „vorbeugender Sozialstaat“.
Außerdem ist Politik – hoffentlich! – anders. Sie muss Menschen erreichen, sich Diskussionen stellen, dem wandelnden Zeitgeist und Wahlen. Und nach einem Gang an die Urnen, wird eine andere Mehrheit genauso vorbeugen? Oder etwas anderes ausprobieren? Passt Politik „mit langem Atem“ und über eine Legislatur hinaus in die Demokratie der Wahlperioden? Darf man das?
Die Landesregierung ist nicht allein. Sie hat einen einflussreichen Partner an ihrer Seite, der sich Wahlen nicht stellen muss. Die Bertelsmann-Stiftung in Gütersloh hat „Kein Kind zurücklassen! Kommunen beugen vor“ gemeinsam mit der Landesregierung entwickelt und gestartet. Beide Seiten, beide mächtigen Frauen an der Spitze, Brigitte Mohn und Hannelore Kraft, sind überzeugt vom Nutzen präventiver Politik. Aber vielleicht nicht mehr ganz so überzeugt wie zum Start ihrer Initiative im Herbst 2012. Könnte man zumindest denken, wenn man eine Presseerklärung des Familienministeriums aus dem Januar 2017 liest.
Das Leitprojekt ist eine Farce
Eigentlich ist es eine Erfolgsmeldung. „Kein Kind zurücklassen!“ werde ausgeweitet auf 40 Kommunen, auf 60 Prozent der Kinder und Jugendlichen im Bundesland: „Eines der zentralen Vorhaben der Landesregierung – die vorbeugende Politik – geht damit in die Fläche.“ Interessanter ist es zwischen den Zeilen: „Kein Kind zurücklassen! Kommunen beugen vor“ heißt jetzt „Kein Kind zurücklassen! Für ganz Nordrhein-Westfalen“. Der vorbeugende Effekt der Landesinitiative rückt in den Hintergrund, nachdem sich die Begleitforschung standhaft weigert, die finanziellen Auswirkungen von frühen Hilfen in den Kommunen exakt zu beziffern. Auch bei der Bertelsmann-Stiftung geht es nicht mehr um kommunalen Mehrwert. Im Nachsatz heißt „KeKiz“ hier „Kommunen schaffen Chancen“.
Das einstige Leitprojekt des Landes ist im fünften Jahr zu einem eher unterausgestatten, beim Familienministerium angesiedelten Programm geworden, ein lockeres Netzwerk. Versprochen wird zwar, dass alle „interessierten Kommunen“ bis 2020 Teil der Initiative werden können. Wie erstrebenswert das ist für Gemeinden und Städte angesichts des Finanzvolumens von 2,3 Millionen Euro pro Jahr, ist fraglich: „Jede neue Kommune erhält eine jährliche Förderung in Höhe von 30.000 Euro zur Koordinierung der Präventionsarbeit.“ Das reicht nicht einmal für eine Verwaltungskraft. Angesichts von „200 Milliarden“, die die Landesregierung seit 2010 für Kinder, Familien und Bildung ausgegeben haben will, sind das Brosamen.
Die Bertelsmann-Stiftung zieht weiter. Finanziert „KeKiz“ nicht mehr mit. Wie man hört, war innerhalb der Stiftung nicht immer völlig klar, was an „KeKiz“ nun Projekt war und was PR (für die Ministerpräsidentin). In den ersten vier Jahren des Programms zeichneten die Gütersloher noch verantwortlich für die wissenschaftliche Begleitung. Jetzt steht in der Januar-Presseerklärung im vorletzten Satz: „Auch die Bertelsmann Stiftung wird beim Thema kommunale Vorbeugung aktiv bleiben und stellt den Kommunen ihr Forschungswissen zur Verfügung.“
Für die FDP im Landtag war das Anlass für eine Kleine Anfrage, welche Aufgaben die Bertelsmann-Stiftung denn in der zweiten Phase von „KeKiz“ übernehme? Die Antwort der Landesregierung:
„Die Bertelsmann Stiftung betreibt Grundlagenforschung zum Thema Prävention für alle Kommunen. Dazu hat die Bertelsmann Stiftung Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds für folgende Forschungsvorhaben beantragt: Begleitforschung zur Optimierung kommunaler Verwaltungsstrukturen für präventives Handeln im bundesweiten und europäischen Vergleich, Begleitforschung zur Stärkung der Elternkompetenz, Erhebung steuerungsrelevanter Erkenntnisse auf Basis von Mikrodaten, fiskalische Begleitforschung zu Fallkosten und Falldichte in den Erziehungshilfen, Entwicklung von Qualitätsstandards in den Hilfen zur Erziehung.“
Ein einfaches „keine“ hätte genügt.
Politik ist wie die Fahrt auf einer Ausfallstraße im Wahlkampf. Stand da nicht eben noch „Kein Kind zurücklassen“?



