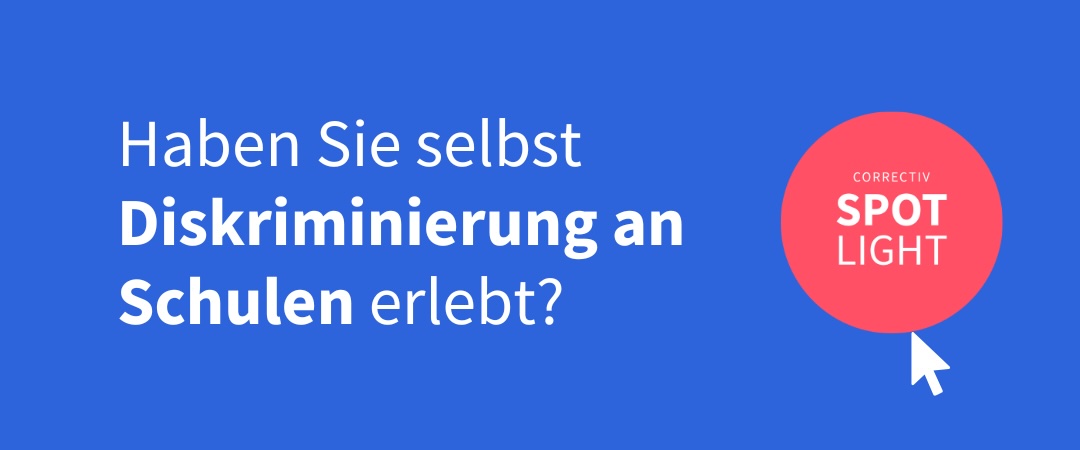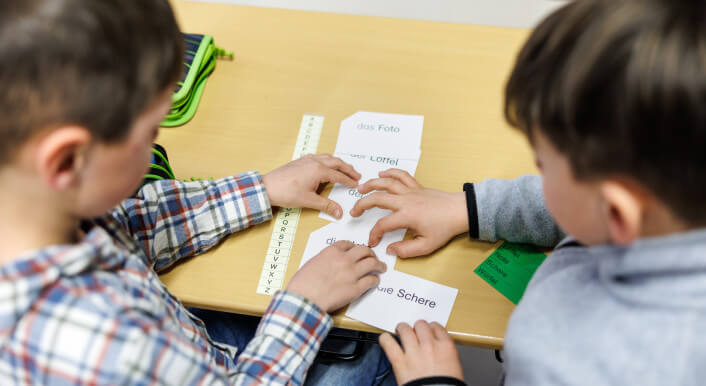Das heikle Problem mit der Queerfeindlichkeit an Schulen
Wie geht man damit um, wenn an Schulen homosexuelle Schüler oder Lehrer gemobbt werden – vor allem, wenn es Schulen mit hohem arabisch-muslimischem Schüleranteil sind? Ein aktueller Fall an der Berliner Rütli-Schule zeigt, wie schwer sich Beteiligte mit dem Thema tun.

Im Frühsommer dieses Jahres war es ein größeres Thema in den Berliner Medien: Homophobes Mobbing an der Carl-Bolle-Grundschule im Stadtteil Moabit. Ein homosexueller Lehrer berichtete, er sei monatelang beschimpft, beleidigt und gemobbt worden – von Kindern. Muslimische Schüler hätten ihm gesagt, er sei eine „Familienschande“ und er werde „in der Hölle landen“. Ein Schüler habe geäußert: „Islam ist hier der Chef.“
Der Fall löste in der Hauptstadt einen kleinen Flächenbrand aus. Es wurde diskutiert: Wie sollen Schulen damit umgehen, wenn Schüler, deren Familien aus anderen Kulturkreisen kommen, die Lebensweise ihrer Mitschüler oder Lehrer offen verachten? Wie können Schulen die betroffenen Lehrkräfte unterstützen? Die Grünen im Landesparlament forderten eine unabhängige Beschwerdestelle für solche Fälle, die Linke kritisierte die zuständige Bildungssenatorin für Ignoranz, weil sie den Fall nicht unabhängig habe aufklären lassen.
In diesem Text geht es einerseits um einen aktuellen Fall aus Berlin. Es geht andererseits aber auch um die Frage: Gibt es in manchen Kulturkreisen, Religionsgemeinschaften oder Bildungsschichten mehr Hass gegen Minderheiten als in anderen? Diese Frage hat unser Migrationsexperte Carsten Wolf ein – und kommt zu teils überraschenden Ergebnissen.
Wir wollen Ihre Erfahrungen sammeln: Waren auch Sie schon einmal von Diskriminierung an Schulen betroffen? Dann nehmen Sie an unserem CrowdNewsroom teil, hier oder per Klick aufs Bild:
Das Thema ist nicht neu für Berlin. Schon 2008 hatte es die Senatsverwaltung für Soziales auf der Zu-lösen-Liste – das war zwei Jahre, nachdem die Rütli-Schule im Berliner Stadtteil Neukölln mit einem Brandbrief an den Berliner Senat für bundesweite Aufmerksamkeit gesorgt hatte.
Die Schule, so schrieb damals deren Leitung, werde mit ihren vielen Schülerinnen und Schülern mit arabischem Hintergrund nicht mehr fertig. 83 Prozent von ihnen hätten einen Migrationshintergrund, die Stimmung an der Schule sei „von Aggressivität, Respektlosigkeit und Ignoranz uns Erwachsenen gegenüber“ geprägt. Die Rede war von Gewalt und Randale, von Hass gegen Minderheiten.
Wie geht man damit um, wenn Kulturkreise aufeinandertreffen und es kracht?
Rütli wurde damals zum Symbol für gescheiterte Schulpolitik, in Berlin und bundesweit. Wie, so damals die Debatte, kann und muss sich Deutschland darauf einstellen, dass sich vor allem in Großstädten die Zusammensetzung der Bevölkerung durch Zuwanderung ändert? Und darauf, dass diese Zuwanderung auch ungelöste Konflikte mit sich bringt? Wie geht man also damit um, wenn Kulturkreise aufeinandertreffen und es kracht?

Damals also mühte sich die Berliner Senatsverwaltung um Lösungen: Sie setzte Gesprächsrunden mit Lehrern und Vertretern von Migrationsvereinen auf, es wurde viel geredet, es wurde versucht, das Thema wissenschaftlich einzuordnen.
Denn, und das ist für die Betrachtung wichtig: Im Raum steht bei der Debatte stets die – mehr oder weniger ausgesprochene – Vermutung, arabischstämmige oder muslimisch geprägte Jugendliche seien per se queerfeindlicher als Jugendliche ohne Migrationshintergrund. Aber stimmt das überhaupt – oder sind nicht andere Faktoren wie der Bildungsgrad oder die Religion wichtiger?
Vom Problemfall zur Vorzeigeschule?
Die Rütli-Schule jedenfalls wurde damals aufwendig modernisiert. Heute gilt sie als Beleg dafür, das Thema sei abgehakt. Das Sat.1-Frühstücksfernsehen lobte: „Vom Problemfall zum Erfolgsmodell“, und im Focus erzählte vor zwei Jahren die damalige Schulleiterin, wie sie das bessere Miteinander an der Schule erreicht hätten: mit Jugendfreizeiteinrichtungen und einer pädagogischen Werkstatt, mit Projektarbeit und mit vielen Gesprächen mit den Jugendlichen. Man dürfe den Schülerinnen und Schülern nicht einfach sagen, dass etwas nicht geht, sondern auch über das „Warum“ sprechen.

CORRECTIV erfuhr nun allerdings von einem aktuellen Fall. Er zeigt, dass das Problem offenbar nicht überwunden ist. Und er spielt ausgerechnet an der Rütli-Schule.
Homophobe Briefe
Es geht dabei, ähnlich wie bei der Carl-Bolle-Grundschule, um homophobes Mobbing: Eine Gruppe aus derzeitigen und ehemaligen Schülern der Schule, die heute offiziell Campus Rütli heißt, belästigte Recherchen von CORRECTIV zufolge seit dem vergangenen Herbst den Ehemann eines Lehrers.
Zunächst erhielt er E-Mails, dann einen obszönen Drohbrief, der im Briefkasten des Ehepaars steckte. Später gab es auch beleidigende Anrufe beim Lehrer-Ehemann. Seine Kontaktdaten hatten die Schüler offenbar im Internet gefunden.
Und dem Lehrer selbst sollen Schüler demnach in der Schule Beleidigungen hinterhergerufen haben. Wer genau die Rufer waren, konnte der Lehrer offenbar nicht ermitteln – doch erkennbar war für ihn offenbar, zu welcher Gruppe sie gehörten: zu jener aus strenggläubigen muslimischen Milieus, die sich auf dem Schulhof häufiger abfällig über „Homos“ äußern oder frauenfeindliche Sprüche klopfen.
Wie viele Schüler genau am Mobbing beteiligt waren, und wer genau, lässt sich bis heute aber nicht mit Gewissheit sagen. Das liegt auch an der schleppenden Aufklärung:
Anzeige beim Landeskriminalamt
Das Ehepaar suchte Informationen der Redaktion zufolge zunächst Unterstützung bei der Schulleitung, später auch bei der Schulaufsichtsbehörde. Es forderte sie auf, bei der Suche nach den Verantwortlichen zu helfen und den Fall schulöffentlich zu machen.
Beides passierte jedoch offenbar nicht. Anstatt Schüler- und Elternschaft sowie die Lehrerinnen und Lehrer über den Fall aufzuklären, sich entschieden von queerfeindlichem Verhalten zu distanzieren und bei der Suche nach den verantwortlichen Schülern zu helfen, soll die Schulleitung dem Lehrer und seinem Ehemann gegenüber ausweichend reagiert haben.
Das Ehepaar erstattete daraufhin im Oktober vergangenen Jahres Anzeige beim Berliner Landeskriminalamt, wie die Behörde gegenüber CORRECTIV bestätigte.
Dort ermittelte der Staatsschutz, genauer gesagt die Abteilung zur Bekämpfung von Hasskriminalität. Auch beim LKA gab es Unmut über Untätigkeit der Schulleitung. Aus einem Mailverkehr mit der Ermittlungsbehörde geht hervor, dass diese „enttäuscht“ über deren fehlende Unterstützung war. Die Schulleitung habe demnach Fragen des LKA erst spät oder gar nicht beantwortet. Auf Anfrage von CORRECTIV teilt die Ermittlungsbehörde mit, sie dürfe sich nicht weiter zu ihrer Einschätzung des Falls und dem Verhalten der Schule äußern – weil der Fall mittlerweile bei der Berliner Staatsanwaltschaft liege.
Die Staatsanwaltschaft wiederum antwortete auf Fragen von CORRECTIV: Bei ihr laufe das Ermittlungsverfahren seit Mitte Januar, es sei noch nicht abgeschlossen. Lediglich einen jugendlichen Tatverdächtigen habe man ermitteln können, gegen ihn sei das Verfahren nun beendet. Über den Ausgang zu diesem einen Jugendlichen schreibt die Staatsanwaltschaft nichts. Abgesehen davon liefen nun weiter „Bemühungen, bislang unbekannte Tatverdächtige“ zu ermitteln.
Doch ohne Unterstützung der Schulleitung ist das offenbar schwierig: Das Lehrerehepaar hatte eine beleidigende Sprachnachricht an die Schule weitergeleitet, die an Heiligabend vergangenen Jahres auf der Mailbox des Lehrer-Ehemannes gelandet war – und sie gebeten, aufgrund der Stimme bei der Suche nach dem Verantwortlichen zu helfen. Die Schule reagierte darauf offenbar nicht.
Wenig transparenter Umgang
Der Fall wirft mehrere Fragen auf. Zunächst die: Warum geht die Schule nicht offener mit dem Fall um?
CORRECTIV hat die Schulleitung gefragt. Sie beantwortete die schriftlichen Fragen der Redaktion nicht. Stattdessen stellte die Schulleiterin in einer Mail in Aussicht, demnächst könne man einmal telefonieren. Auf weitere Nachfragen schrieb sie dann aber: Fragen zu diesem Fall werde sie nicht selbst beantworten, sondern die zuständige Berliner Senatsverwaltung gebe hierzu Auskunft. Auch die zuständige Berliner Schulaufsichtsbehörde antwortete nicht auf Fragen der Redaktion, sondern ließ stattdessen die Senatsverwaltung antworten.
Diese wiederum schreibt, zu laufenden Ermittlungsverfahren könne und dürfe sie sich nicht äußern. Generell seien Schulen zuweilen mit herausfordernden Situationen konfrontiert.
Ob die Schulleitung überfordert ist oder ob womöglich die Senatsverwaltung ihr ein Gespräch untersagt hat, darüber lässt sich nur spekulieren. Um sich ein möglichst vollständiges Bild zu verschaffen, hat CORRECTIV auch die Elternvertretung der Schule angeschrieben und gefragt, ob sie von der Schulleitung informiert wurden und was sie vom Umgang mit dem Fall halten. Die Elternschaft antwortete allerdings ebenfalls nicht.
Ein prominenter Lehrer warnt
Und dann ist da eben die Frage, ob denn wirklich viele deutsche Schulen dieses Problem haben: Queerfeindlichkeit und anderer Hass gegen Werte der demokratischen Grundordnung, vor allem durch Schüler aus bildungsfernen, streng muslimischen Milieus?
Sie stellt sich auch deshalb, weil einer der prominentesten Lehrer des Landes dies nahelegt: der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Stefan Düll. Er sagte Anfang vergangenen Jahres in einem Interview: Der Anteil jener Schüler – vorrangig mit muslimischem Hintergrund – nehme zu, die gesellschaftliche Grundwerte ablehnten oder gar verachteten, die antisemitische Sprüche rissen, ihre Homophobie demonstrativ zur Schau stellten, frauenverachtende Haltungen zeigten. „Das anzusprechen hat nichts mit Fremden- oder Islamfeindlichkeit zu tun. Da war man zu lange mit politisch korrekten Scheuklappen unterwegs“, sagte Düll.

Die Äußerung war außergewöhnlich – denn Queerfeindlichkeit unter strenggläubigen muslimischen Schülern, mit oder ohne Migrationshintergrund, scheint in Politik und Zivilgesellschaft ein riesiger Elefant im Raum zu sein.
„Offenkundig politisch als diskriminierend empfunden“
Die Debatte ist nicht auf Schulen allein begrenzt, und Queerfeindlichkeit ist in vielen gesellschaftlichen Milieus ein Problem. Gerade, wenn sie aus migrantischen Milieus stammt, tun sich aber offenbar viele schwer damit. So kritisierte vor einigen Monaten das Berliner Magazin Schwulissimo: Gerade im politisch linken Spektrum in der Community scheine es unmöglich, offen darüber zu sprechen, wenn Hass und Gewalt gegen Schwule und Lesben von jungen Männern mit archaischen muslimischen Rollenbildern ausgehe.
Wie heikel der ganze Komplex politisch gesehen ist, zeigt eine ungewöhnlich aussagekräftige Auskunft, die CORRECTIV von der Berliner Senatsverwaltung bekam. Wir hatten die Behörde nicht nur um Auskunft zum konkreten Fall an der Rütli-Schule gebeten, sondern auch gefragt: Gab es in Berlin schon einmal wissenschaftliche Erhebungen darüber, ob Queerfeindlichkeit in migrantisch Milieus verbreiteter ist als in nicht-migrantischen?
Der Sprecher der Behörde schreibt dazu: „Aktuelle wissenschaftliche Erhebungen speziell für Berlin, die nach Migrationshintergrund differenzieren, liegen nicht vor. In den zurückliegenden Legislaturperioden wurde dieses Themenfeld nicht aufgearbeitet – entsprechende Untersuchungen wurden nicht in Auftrag gegeben, da sie offenkundig politisch als diskriminierend bewertet wurden.“

Jetzt aber habe die Senatsverwaltung einen „Kurswechsel“ vorgenommen und doch eine Studie in Auftrag gegeben: „Konfliktpotenziale an Berliner Schulen“.
Gibt es statistische Auswertungen?
Es braucht also nüchterne, wissenschaftliche Untersuchungen zur Frage, ob migrantische, insbesondere muslimische Jugendliche, tatsächlich queerfeindlicher sind als andere. Nur so lässt sich sinnvoll die Debatte führen: Wie gehen wir als freie westliche Gesellschaft damit um?
Da es in Berlin noch keine verlässlichen statistischen Aussagen dazu gibt, haben wir einen Fachautor um seine Einschätzung gebeten: Carsten Wolf, der auch für den CORRECTIV-Spotlight immer wieder Migrationsfragen faktisch einordnet. Im folgenden Kastentext steht seine Analyse:
***
Was sagt die Forschung: Sind Jugendliche mit Migrationshintergrund queerfeindlicher als andere?
„Queerfeindlich“ zu sein, ist ein gefährliches Label, besonders bei Jugendlichen. Was sagt also die Forschung? Äußern sich Jugendliche mit Migrationshintergrund häufiger queerfeindlich – oder „homophob“ und „schwulenfeindlich“, wie es frühere Studien ausdrückten?
Ja, in der Tendenz schon. Verglichen mit dem Rest der Bevölkerung äußert ein größerer Teil von ihnen Vorurteile, besonders gegenüber Schwulen. Je nach Studie und Fragestellung ist der Anteil meist etwa doppelt so hoch. Es gibt zahlreiche Umfragen, die das belegt haben.
Zum Beispiel zeigte 2020 eine Studie „signifikant“ höhere Werte zu „Homophobie“ bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund in Deutschland und der Schweiz. Eine repräsentative Studie von 2017 fand „homophobe“ Einstellungen bei 34 Prozent der Jugendlichen mit Migrationshintergrund, im Vergleich zu 19 Prozent bei Jugendlichen ohne Migrationshintergrund.
In älteren Studien war der Unterschied noch größer: 2007 zeigte eine nicht-repräsentative Befragung unter mehr als 900 Jugendlichen in Berlin besonders bei türkeistämmigen Jugendlichen große Vorbehalte. So fanden es rund 80 Prozent von ihnen „abstoßend“, wenn sich zwei Männer auf der Straße küssen (im Vergleich zu 50 Prozent bei Jugendlichen ohne Migrationshintergrund).
Wie sind die Ergebnisse einzuordnen?
Die Forschungsergebnisse sind also recht klar. Aber: Jugendliche mit Migrationshintergrund sind keine homogene Gruppe. Die Migrationsgeschichte allein erklärt noch nicht viel. Entscheidend ist die Sozialisierung, die damit verbunden ist. Es müssen also noch weitere Faktoren hinzukommen, damit solche Einstellungen geteilt werden:
- Faktor Religion: Schon hier zeigen sich die Vielschichtigkeit. Denn viele denken bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund zuerst an arabischstämmige Jugendliche, besonders Muslime. Studien zeigen aber, dass die Mehrheit der Jugendlichen mit Migrationshintergrund christlich sein dürfte. Und tatsächlich ist, laut der Befragung von 2008, unter christlichen Jugendlichen aus Ex-Sowjetstaaten die Schwulenfeindlichkeit ähnlich verbreitet. Eine Studie von 2020 zeigte, dass Homophobie am stärksten unter freikirchlichen Befragten ausfiel. Schwulenfeindlichkeit und Religiosität hängen also zusammen, aber nicht mit einer bestimmten Religion.
- Faktor Integration: Unter Jugendlichen mit Migrationshintergrund fallen sowohl Geflüchtete der letzten Jahre, als auch Jugendliche, die in Deutschland geboren wurden. Dieser Zeit-Faktor spielt offenbar eine Rolle bei schwulenfeindlichen Vorurteilen. Mit anderen Worten: Je länger sie in Deutschland sind und desto besser sie sich integriert fühlen, desto seltener äußern sie im Schnitt schwulenfeindliche Einstellungen.
- Faktor Bildung: Jugendliche an Gymnasien akzeptieren Homosexualität eher – egal ob mit oder ohne Migrationshintergrund. Das Bildungsniveau der Eltern ist relevanter als der Migrationshintergrund. So sind Befragte mit hoher Bildung insgesamt viermal positiver gegenüber Homosexualität eingestellt.
- Faktor Männlichkeit: Ängste vor einer „bedrohten Männlichkeit“ können das Bindeglied sein zwischen autoritären, teils homophoben Einstellungen und der Suche nach einer eigenen Identität, sagt Professorin Magdalena Nowicka vom DeZim-Institut, die zum Thema geforscht hat. In diesem Fall, sagt sie, komme Queerfeindlichkeit weniger aus der eigenen Erziehung. Vielmehr erreichten Bilder einer „bedrohten Männlichkeit“ die Jugendlichen über soziale Medien, Werbung oder Filme. „Und das ist oft eine autoritäre, weiße Hetero-Männlichkeit, die sich bedroht fühlt.“ Die extreme Rechte nutze das aus und werbe damit für ihre rechten Ideen.
Potentiell betreffe dieser Zusammenhang alle Jugendlichen. „Aber es kann sein, dass solche Inhalte bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund eher auf fruchtbaren Boden fallen“, so Nowicka, „wenn zum Beispiel die Eltern häufig Fernsehen aus dem Herkunftsland schauen. Und da dann solche homophoben Positionen auch geteilt werden. Dann kann es sein, dass diese Effekte sich noch verstärken.“
Aktuelle internationale Studien zeigen jedenfalls einen Zusammenhang zwischen „bedrohter Männlichkeit“ und Unterstützung extrem rechter Positionen.
Die gute Nachricht: Insgesamt wird es besser. Fast alle großen Einstellungs-Umfragen der letzten Zeit zeigen, dass die Abneigung gegen Schwule und Lesben insgesamt abnimmt. Nur noch etwa zehn Prozent der Gesamtbevölkerung zeigt diese Haltung. Eine ganz andere Gruppe sticht aber besonders durch ablehnende Aussagen hervor: ältere AfD-Wähler. Sie äußern besonders häufig ablehnende Haltungen gegenüber Schwulen und Lesben.
Fachautor Wolf zieht zur Forschungslage dieses Fazit:
Queerfeindliche Einstellungen werden von Jugendlichen mit Migrationshintergrund stärker geäußert. Damit sie diese äußerten, müssten allerdings noch weitere Faktoren hinzukommen: Religiosität, Gefühle mangelnder Integration oder einer „bedrohten Männlichkeit“ könnten dazu führen.
Außerdem werde der Vorwurf queerfeindlicher Einstellungen oft von rechten Akteuren benutzt, um Jugendlichen das „Deutsch-Sein“ abzusprechen. All das gelte es zu berücksichtigen, wenn man wirksam etwas dagegen tun will. Das beste Mittel, um Queerfeindlichkeit an Schulen zu bekämpfen, sei laut Forschungslage das Reden – vor allem an Schulen.
Denn die Mehrheit der Jugendlichen berichtet, dass in Schulbüchern kaum Schwule und Lesben vorkommen. Häufig würden schwulenfeindliche Aussagen toleriert und homosexuelle Lehrkräfte könnten nicht offen sprechen. Das müsse sich ändern, findet die große Mehrheit der Jugendlichen.
Außerdem, analysiert Wolf, seien Aussagen von Jugendlichen mit Migrationshintergrund teils widersprüchlich. So waren Befragte in einer Studie von 2024 zwar gegen eine rechtliche Gleichstellung, sie akzeptierten Homosexualität aber auf einer individuellen Ebene und nahmen die persönliche Begegnung mit Homosexuellen als „positiv“ wahr. An solchen Punkten könnte man ansetzen.
Um Schulen dabei zu unterstützen, bei ihren Schülerinnen und Schülern eine weltoffene Einstellung zu fördern, gibt es sogar Unterrichtsmaterialien – gesammelt von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Sie empfehlen, das Thema in verschiedenen Unterrichtsstunden anzusprechen.
Zuständige Aufsichtsbehörde schweigt sich aus
Vor diesem Hintergrund hat CORRECTIV zum aktuellen Fall an der Rütli-Schule die zuständige Schulaufsichtsbehörde Berlin-Neukölln auch dies gefragt: Ist man dort der Meinung, die Schulleitung hätte anders reagieren sollen, proaktiver und entschlossener?
Die Behörde war Informationen von CORRECTIV zufolge bereits seit Mai dieses Jahres über den Vorgang informiert, wurde aber ebenfalls nicht erkennbar tätig. Informationen der Redaktion zufolge vertröstete die zuständige Beamtin das Ehepaar mit Floskeln: Man stehe mit der Schulleitung im Austausch; man unterstütze die Schule in ihren Prozessen.
Auf Fragen der Redaktion an die Schulaufsicht antwortete wieder die übergeordnete Behörde – die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie. Sie schrieb: „Wie alle gesellschaftlichen Orte können auch Schulen mit herausfordernden Situationen konfrontiert sein, etwa bei homophoben, antisemitischen, rassistischen oder anderen diskriminierenden Vorfällen. Entscheidend ist, dass sie diesen mit klaren Strukturen und verantwortungsvollem Handeln begegnen.
Die Rütli-Schule verfüge hierfür über ein „bewährtes pädagogisches Konzept“.
CORRECTIV hat die Queerbeauftragte der Bundesregierung, Sophie Koch, gefragt, was sie zu dem Fall denkt. Ihr Büro teilt dazu mit, die Beauftragte sei „sehr besorgt über das Erstarken queerfeindlicher Einstellungen in der Gesamtbevölkerung und insbesondere unter jungen Menschen“. Zu tiefergehenden Fragen könne sie keine Auskunft geben.
***
Mitarbeit: Samira Joy Frauwallner
Redaktion: Justus von Daniels, Miriam Lenz, Shammi Haque
Faktencheck: Finn Schöneck
Bildredaktion: Ivo Mayr