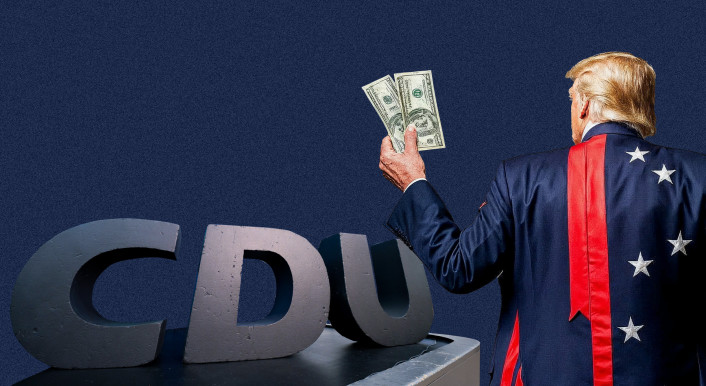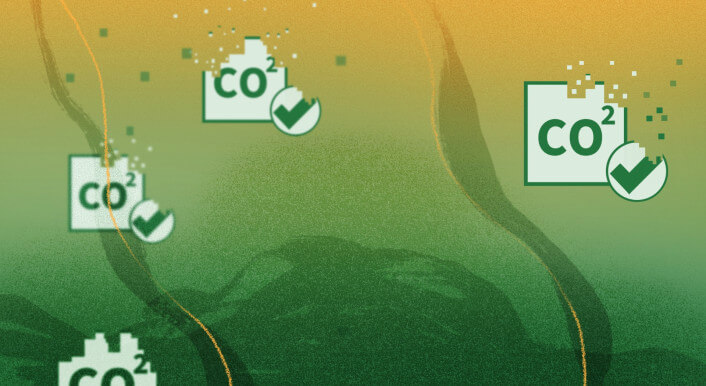CO2-Lager: Gefahr durch geplante Pipeline im Rheinland
Die neue Koalition will Treibhausgase im Meeresboden lagern. Doch nach Recherchen von WDR und CORRECTIV bestehen erhebliche Risiken bei dem größten deutschen CCS-Vorzeigeprojekt zwischen Köln und der Nordsee: Es könnten gefährliche Gase aus der zukünftigen Pipeline entweichen.

Die deutsche Industrie hofft auf eine einfache Lösung zur Klimakrise: Sie will ihre Treibhausgase per Pipeline entsorgen und unterirdisch in der Nordsee einlagern, ähnlich wie beim Atommüll-Endlager. So könnten die Konzerne weiterhin Stahl, Chemie und Zement produzieren, ohne teure Emissionszertifikate kaufen zu müssen. Die Methode nennt sich Carbon Capture and Storage (CCS).
Rückenwind erhalten die Unternehmen von Union und SPD: Die designierte Regierungskoalition setzt bei der Energiewende auf CCS. Das aktuell größte Projekt in Deutschland ist der “Delta Rhine Corridor”. Bis frühestens 2033 soll abgespaltenes CO2 durch ein circa 700 Kilometer langes, grenzüberschreitendes Pipeline-Netz fließen, das vom niederländischen Rotterdam über Köln und Gelsenkirchen bis nach Ludwigshafen reicht. Parallel dazu soll ein Wasserstoffnetzwerk die angeschlossenen Firmen mit „CO2-armen und CO2-freien“ Wasserstoff versorgen, wie es auf der Projektseite heißt. Das Projekt befindet sich noch in der frühen Planung und wird mit Steuergeldern gefördert.
Delta Rhine Corridor: Ein verlockendes Versprechen für Politik und Industrie
Doch ob und wann das Pipelinesystem je realisiert wird, ist ungewiss. Denn das Projekt birgt große Risiken, wie gemeinsame Recherchen von CORRECTIV und dem WDR-Magazin Westpol zeigen: Die bislang unerprobte Mischung aus Gasen von den vielen beteiligten Industrien könnte dazu führen, dass die Pipeline Risse bekommt und CO2 ausströmt. Zudem sind die technischen Hürden der gesamten CCS-Infrastruktur so hoch, dass die Lösung entweder zu spät kommen oder so teuer werden könnte, dass die Idee verworfen wird. Oder der Steuerzahler einspringen muss, wie einige der industriellen Nutzer öffentlich einräumen.
Dabei ist die CCS-Idee denkbar verlockend: Ungewollte Treibhausgase könnten buchstäblich von der Erdoberfläche verschwinden. Nichts müsste sich ändern, alle könnten weiter CO2 produzieren. Auch deshalb setzen CDU und SPD im aktuellen Koalitionsvertrag auf CCS. Es ist einer der konkretesten Punkte zum Klimaschutz. Die Abspaltung und Speicherung von CO2 aus industriellen Prozessen sei ein „unerlässliches Instrument“ der Energiewende. Um das möglichst schnell voranzubringen, werde man „das überragende öffentliche Interesse für den Bau dieser CCS/CCU-Anlagen- und Leitungen“ feststellen.
Was ist CCS?
Carbon Capture and Storage (CCS), auf Deutsch: Abscheidung und Speicherung von Kohlenstoff ist eine Technik, um klimaschädliches Kohlendioxid (CO2) unterirdisch zu lagern. Es gilt als große Hoffnung im Klimaschutz.Die CCS-Technik trennt CO2 aus industriellen Prozessen ab. Technische Verfahren filtern das CO2 aus den Emissionen heraus. Anschließend wird es über Pipelines oder per Schiff transportiert und am Ende unterirdisch gespeichert. Entweder im Meeresgrund oder im Boden.CCS zählt neben dem Ausbau erneuerbarer Energien zu den Maßnahmen, die die Wirtschaft dekarbonisieren sollen.
Vor allem große CO2-Emittenten aus der Zement-, Stahl- und Chemieindustrie sollen so künftig ihre nicht vermeidbaren Emissionen auf Null senken. Bisher ist allerdings unklar, ob das gespeicherte CO2 dauerhaft und vollständig in den unterirdischen Speichern bleibt. Auch die Kosten pro Tonne CO2 sind unklar – die Betreibergesellschaft OGE kann heute keine Schätzung darüber abgeben.
Hinter dem Delta Rhine Corridor steht ein Zusammenschluss von Konzernen aus der Chemie- und fossilen Industrie: BASF, der niederländische Stromnetzbetreiber Tennet und der Gasnetzbetreiber Gasunie, der dem niederländischen Staat gehört. Außerdem der Gaskonzern Open Grid Europe GmbH (OGE), ein Nachfolgeunternehmen des Essener E.ON-Konzerns, das das größte Gasnetz in Deutschland betreibt.
Das Problem des Delta-Projekts: Die Idee, eine Pipeline für viele Nutzer zu öffnen, ist Neuland. Zwar behauptet OGE, die sei bereits in den USA erprobt und daher „etabliert“. Doch Experten widersprechen: Gegenüber CORRECTIV und WDR erklären sie, ein vergleichbares Projekt existiere nicht. Es gäbe zwar bereits große CCS-Projekte, vor allem in den USA. Doch im Delta Rhine Corridor sollen erstmals CO2-Ströme verschiedener Industrien zusammen fließen. Etwa von Zementfabriken und Gaskraftwerken.
Ein solches Vorhaben sei noch nie umgesetzt worden, sagt Andrew Reid, Analyst des US-amerikanischen Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) gegenüber CORRECTIV und WDR. Zwar existieren in den USA riesige CO2-Transportnetze, aber dabei werden die CO2-Ströme verschiedener Verbrennungsprozesse nicht vermischt. Sie ließen sich daher nicht mit dem Delta Rhine Corridor vergleichen. Zudem fehlten Standards für diese Form des CO2-Transports, so Reid. Dabei seien diese unverzichtbar, da Korrosion die Pipeline beschädigen könnte, wenn sich das CO2 während des Transports etwa mit Wasserdampf mischt.
CCS: Fehlende Standards und hohes Risiko
Das Problem der verschiedenen CO2-Ströme sei „hochrelevant und nicht trivial“, sagt auch Karin Arnold, Co-Leiterin des Forschungsbereichs Systeme und Infrastrukturen am Wuppertal Institut. Bereits geringe Mengen an Begleitstoffen im CO2-Strom könnten den Zustand verändern, etwa indem sich das Gas plötzlich ausdehne. „Es kann sein, dass die Pipeline das nicht mitmacht“, so Arnold gegenüber CORRECTIV und WDR. Dadurch könnten Risse entstehen und Gas entweichen.
Die Betreibergesellschaft OGE sagt auf Anfrage von CORRECTIV und WDR, die internationalen Standards würden gerade weiterentwickelt. CO2 und andere Gase würden erst dann transportiert, wenn diese den Anforderungen entsprechen. Auf die Frage nach der Korrosion ging OGE nicht ein.
CCS-Industrie setzte sich für niedrige Standards ein
Derzeit entwickelt der Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW) Standards für die CCS-Technik. Der Verein entwickelt laut eigenen Angaben regelmäßig Regeln und Normen für die deutsche Gas- und Wasserwirtschaft und zählt auch OGE und BASF zu seinen Mitgliedern – zwei der Unternehmen, die nun den Delta Rhine Corridor planen. Laut DVGW werde ein erster Entwurf der Richtlinie aktuell überarbeitet. Kernpunkt dabei: die Grenzwerte für die Begleitstoffe.
„Die Industrie macht hier ihre eigenen Regeln“, sagt Kerstin Meyer, Leiterin Wirtschaft und Finanzen beim BUND. Dass ein Interessenverband der Gasindustrie jetzt Standards festlegen dürfe, das sei leider „üblich“, aber „nicht akzeptabel“, kritisiert Meyer im Gespräch mit CORRECTIV und WDR.
Ähnlich hatte sich bereits die Deutsche Umwelthilfe (DUH) im März 2024 geäußert: „Für die Gewährleistung der technischen Sicherheit“ sei fachliche Neutralität erforderlich, heißt es in einer Stellungnahme der Organisation. Daher sei der DVGW „durch die Interessenvertretung seiner Mitglieder aus der Gaswirtschaft denkbar ungeeignet“.
Risiken sind gewaltig – das weiß auch die CCS Industrie
Die Industrie setzt sich für niedrige Standards ein. Bei einer Veranstaltung der Europäischen Kommission im Oktober, dem „Industrial Carbon Management Forum“, erklärt ein Vertreter der europäischen Zementindustrie unverblümt, man sollte auf möglichst niedrige Standards für den CO2-Transport hinarbeiten. Im Kern geht es darum, ob die verschiedenen Industrien ihr CO2 von Beiprodukten reinigen müssen, etwa von Schwefeloxiden. Denn genau in einem bislang unbekannten Chemiecocktail besteht die Gefahr. „Das ist noch Neuland“, sagt Martijn Smit vom norwegischen Öl- und Gaskonzern Equinor.
In der Diskussion bei der Veranstaltung im französischen Pau zeigt sich zudem: Auch für die Industrie sind die finanziellen Risiken gewaltig. Einige Konzerne vermuten sogar so gewaltig, dass Versicherungen aussteigen könnten – und dann die öffentliche Hand einspringen müsse.
Nach Plänen des Gaskonzerns OGE könnten im Jahr 2030 rund 16 Millionen Tonnen CO2 aus NRW durch die Pipelines Richtung Nordsee transportiert werden. Das entspräche rund „2,5 Prozent der CO2-Emissionen Deutschlands im Jahr 2023“. Das Delta-Projekt macht deutlich, wie schwer die CCS-Ziele zu erreichen sind: Die EU will bis 2050 rund zehn Prozent aller Emissionen durch diese und verwandte Techniken unschädlich machen. Die Rhein-Ruhrpipeline würde also, selbst wenn alles glatt läuft, nur ein Viertel der CCS-Ziele erfüllen.
Die Düsseldorfer Wirtschafts- und Klimaministerin Mona Neubauer (Grüne) plädiert gegenüber CORRECTIV und WDR dafür, möglichst wenig CO2 zu produzieren. Dort, wo es unvermeidlich sei, sollte es aber bestenfalls wiederverwendet und mit der notwendigen Infrastruktur abtransportiert werden.
Welche Risiken mit solch einer Infrastruktur verbunden sind, zeigt ein Blick in die USA: Dort explodierte im Jahr 2020 eine CO2-Pipeline in einem Dorf im Bundesstaat Mississippi. Das ausströmende Gas vergiftete Anwohner. 45 Menschen mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden, weitere 200 wurden vorsorglich evakuiert.
Delta Rhine Corridor: Bisher unklar, welche Kommunen betroffen sein könnten
Laut den Plänen des Firmen-Konsortiums um OGE soll die Pipeline komplett neu verlegt werden und teilweise durch das dicht besiedelte Ruhrgebiet führen. Die genaue Strecke ist noch nicht bekannt.
„Derzeit läuft noch keine Raumverträglichkeitsprüfung für den Delta Rhine Corridor“, teilt das Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie Nordrhein-Westfalen (MWIKE) auf Anfrage von CORRECTIV und WDR mit. Diese Prüfung ist der erste Schritt vor einer möglichen Zulassung.
Klar sind hingegen die Industriestandorte, die an die Pipeline angeschlossen werden sollen. Dazu schreibt das MWIKE: „In Nordrhein-Westfalen plant der Gaskonzern OGE eine CO2-Transportleitung von Köln-Wesseling über Kempen nach Gelsenkirchen-Scholven.“ Auch eine Verbindung von Gelsenkirchen-Scholven nach Duisburg sei geplant.
In Köln-Wesseling hat Shell einen Sitz, aber auch der Chemiekonzern Evonik. In Gelsenkirchen-Scholven betreibt unter anderem der Ölkonzern BP eine Erdölraffinerie. Unklar ist, ob und inwieweit all diese Unternehmen künftig auch an den Delta Rhine Corridor angeschlossen werden.
CCS galt bisher als Lösung für Unternehmen, die ihre Emissionen aufgrund ihrer Produktionsprozesse nicht auf Netto null reduzieren können. Das ist vor allem in der Zement- und Kalkindustrie der Fall. Der Koalitionsvertrag sieht vor, CCS künftig „insbesondere für schwer vermeidbare Emissionen des Industriesektors und für Gaskraftwerke“ zu ermöglichen. Auch die Stahlindustrie wird ausdrücklich genannt. Praktisch steht die Technologie damit allen Industriebranchen offen, die sie nutzen wollen.
Für Greenpeace ist die Technik hingegen keine Klimaschutzlösung, „sondern eine teuer erkaufte Illusion.“ Laut der Umweltschutzorganisation scheiterten bislang rund 90 Prozent aller CCS-Projekte weltweit. Besser sei es, Emissionen direkt zu vermeiden.
EU fördert Delta Rhine Corridor mit neun Millionen Euro
Trotz dieser Bedenken und offenen Fragen unterstützt die Europäische Union den Delta Rhine Corridor großzügig mit Steuergeld: Im Januar genehmigte die Europäische Kommission eine Förderung in Höhe von neun Millionen Euro. Das Geld fließt im Rahmen der „Projects of Common Interest“ (PCI), einem Förderprogramm für grenzüberschreitende Infrastruktur- und Energieprojekte.
Laut dem Gaskonzern und Initiator des Delta-Projekts, OGE, plant das Konsortium, mit dem EU-Geld die Raumverträglichkeitsprüfung zu kofinanzieren. Beantragt hatte die Förderung der Energiekonzern Shell, der ursprünglich Teil des Firmen-Konsortiums war. Mittlerweile aber nur noch ein wichtiger Kunde des Projekts sei, wie Shell gegenüber CORRECTIV und WDR angibt.
Zuspruch bekam das Projekt dabei auch von der bisherigen Bundesregierung. Das BMWK hat für das Projekt einen „Letter of Support“ für den Antrag auf EU-Gelder ausgestellt.
Kritik an der Förderung kommt von Michael Bloss, Abgeordneter der Grünen im EU-Parlament. Es sei nicht nachvollziehbar, warum öffentliche Gelder in so ein Projekt flössen, so Bloss gegenüber CORRECTIV und WDR. „Das ist eine große Verschwendung von Steuergeld und ein Versuch, klimaschädlichem Gas und Öl das Leben zu verlängern.“ Dabei gäbe es günstigere und effizientere Alternativen wie den Ausbau erneuerbarer Energien.
Mit den Plänen, CCS künftig auch in Gaskraftwerken einzusetzen, mache sich die neue Bundesregierung zum „Erfüllungsgehilfen der fossilen Industrie“, so Bloss weiter. Gaskraftwerke seien auch mit CCS nicht klimaneutral. „Das Vorhaben der Bundesregierung ist extrem teuer und ineffizient.“
Update, 11. April 2025: Nach der Veröffentlichung hat Shell uns mitgeteilt, nicht mehr Teil des Firmen-Konsortiums um den Delta Rhine Corridor zu sein. Das Unternehmen sei nur noch ein wichtiger Kunde. Wir haben das im Text korrigiert.
Redigat: Marie Bröckling und Justus von Daniels
Design: Ivo Mayr
Faktencheck: Marie Bröckling
Die Recherche wurde gefördert und unterstützt von Netzwerk Recherche und Ecosia. Weitere Informationen finden Sie hier