Irreführende „Entscheidungshilfe“ auf Tiktok unterstellt Parteien vor der Bundestagswahl falsche Positionen
Seit mehreren Jahren kursiert eine „Entscheidungshilfe“ in Sozialen Netzwerken, die politische Positionen von sechs Parteien vergleicht. Gestreut wird sie von der AfD und ihr nahestehenden Accounts, auch jetzt vor der Bundestagswahl. Sie schiebt allen Parteien falsche Positionen unter, die AfD-Forderungen sind hingegen überwiegend richtig abgebildet.

Wer bei Tiktok nach einer „Entscheidungshilfe“ zur Bundestagswahl sucht, landet bei etwa zwei Dutzend Videos mit Desinformation. Die Videos zeigen eine Tabelle, die vermeintlich einen neutralen Überblick der Parteiprogramme von CDU, SPD, AfD, Linke, FDP und Grünen bieten soll. Teilweise trägt die Tabelle jedoch das Logo der AfD, den Namen der bayerischen AfD-Landtagsabgeordneten Elena Roon oder ein Zitat der AfD-Bundestagsabgeordneten Nicole Höchst. Die AfD ist es auch, deren Positionen in der Tabelle vorwiegend richtig dargestellt sind – den anderen Parteien werden aber in vielen Fällen falsche Standpunkte zugeschrieben.
Die Tabelle kursierte bereits im Vorfeld der Europawahl 2019. Obwohl wir darüber berichteten, erzielten Videos mit dieser „Entscheidungshilfe“ seit Juni 2023 erneut über zwei Millionen Aufrufe und rund 60.000 „Gefällt mir“-Angaben auf Tiktok, auch Facebook, Instagram und X kursiert die „Entscheidungshilfe“.
Verbreiter sind vor allem AfD-Anhänger, aber auch AfD-Politiker, darunter: Elena Roon und Christian Weiland, AfD-Lokalpolitiker in Bad Kreuznach. Warum sie teils falsche Parteipositionen teilten, beantworteten sie uns nicht.
Basis der Recherche sind die Wahlprogramme von CDU, SPD, AfD, Grüne, FDP und Die Linke. Teils betrachteten wir auch die vorläufigen Wahlprogramme und Grundsatzprogramme. Bei offenen Fragen kontaktierten wir die Parteien. Im Folgenden stellen wir die Entscheidungshilfe richtig – ohne Anspruch darauf, einen vollständigen Überblick über generelle Positionen der Parteien zu geben.
Die Themen im Überblick
- Grenzen sichern und kontrollieren
- GEZ abschaffen oder reformieren
- Unbegrenzte Aufnahme von Asylbewerbern
- Kindererziehung bei Rente anrechnen
- Erhöhung der Strompreise durch EEG
- Für Schulden anderer EU-Länder haften
- Gegen Links- und Rechtsextremismus
- Der Islam gehört zu Deutschland
- Volksentscheide auf Bundesebene
- EU grundlegend reformieren
Unser Fazit: Bis auf zwei Fälle werden die Positionen der AfD in der Tabelle korrekt dargestellt. Anders ist das bei den anderen Parteien: In mehr als der Hälfte der Positionen wird der CDU, SPD, Linken, FDP und den Grünen eine falsche Position unterstellt.
Die einzelnen Themengebiete haben wir grafisch dargestellt: Positionen, die auf der Entscheidungshilfe richtig dargestellt werden, haben wir mit einem grünen Haken markiert. Positionen, die falsch dargestellt wurden, haben wir mit einem roten X markiert. Ist die Position einer Partei unklar, ist ein Fragezeichen zu sehen.
Grenzen sichern und kontrollieren


• CDU
Im Wahlprogramm der CDU heißt es auf Seite 4: „Wir kontrollieren die deutschen Staatsgrenzen und setzen konsequente Zurückweisungen an der Grenze durch.“ Demnach sollen Personen, die aus einem anderen EU-Mitgliedstaat oder dem Schengen-Raum nach Deutschland einreisen und einen Asylantrag stellen wollen, an den deutschen Grenzen zurückgewiesen werden. Die CDU/CSU möchte zudem in „modernste Grenzsicherungstechnik, wie etwa in Drohnen, Nachtsicht- und Wärmebildkameras“ investieren (Seite 41). Am 3. Februar 2025 hat die CDU auf ihrem Parteitag ein Sofortprogramm beschlossen, das sie im Fall einer Regierungsbeteiligung umsetzen will. Geplant sind unter anderem dauerhafte Grenzkontrollen und mehr Befugnisse für die Bundespolizei.
Zu den EU-Außengrenzen heißt es (Seite 42), die CDU/CSU, wolle diese „wirksam schützen“. Dafür soll die Europäische Grenzschutzagentur Frontex mehr Befugnisse erhalten, indem sie eigene Grenzabschnitte zugewiesen bekomme. Auch das Personal soll aufgestockt werden.
• SPD
Das SPD-geführte Innenministerium hat seit 2023 vorübergehende Kontrollen zunächst an einigen, seit September 2024 an allen deutschen Grenzen eingeführt. Die Landesgrenzen dauerhaft zu kontrollieren erachtet die SPD jedoch nicht als sinnvoll. So heißt es im Wahlprogramm auf Seite 55: „Grenzschließungen und Pauschalzurückweisungen an den Binnengrenzen widersprechen dem Geist eines gemeinsamen Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts. Die befristete Wiedereinführung von Binnengrenzkontrollen muss deshalb die absolute Ausnahme bleiben.“
Im Wahlprogramm der SPD heißt es auf Seite 56: „Wir wollen, dass die Außengrenzen der EU stärker geschützt und kontrolliert werden.“ Die Arbeit von Frontex soll rechtsstaatlich gestärkt und überwacht werden.
• AfD
Die Kontrolle und Sicherung der Grenzen ist ein zentrales Anliegen der AfD. Auf der Webseite der Partei findet sich die Forderung: „Die Grenzen müssen umgehend geschlossen werden“. Ähnlich heißt es im Wahlprogramm auf Seite 100: „Die AfD wird eine deutliche Kehrtwende in der bisherigen Migrationspolitik einleiten und die Staatsgrenzen wieder kontrollieren.“
Das gilt auch für die EU-Außengrenzen. Die AfD will die EU zwar auflösen und durch einen „Bund europäischer Nationen“ ersetzen, der Schutz dieser Außengrenzen vor illegaler Zuwanderung steht jedoch explizit im Wahlprogramm auf Seite 140.
• Linke
Auf Anfrage schreibt Die Linke: Die Partei wolle keine innereuropäischen Grenzkontrollen einführen, das sei nicht mit den Regelungen des Schengen-Abkommens vereinbar. Die Landesgrenze solle auch nicht gegen Geflüchtete gesichert werden.
Was die EU-Außengrenzen betrifft, schreibt Die Linke: „Ja, die Grenzkontrollen an den Außengrenzen wollen wir behalten. Das bedeutet allerdings nicht, dass Geflüchtete entgegen der EU Grundrechtecharta und der Genfer Flüchtlingskonvention abgewiesen werden können (sollen).“ Die europäische Grenzschutzagentur Frontex soll laut Wahlprogramm abgeschafft und durch ein „ziviles europäisches Seenotrettungsprogramm“ ersetzt werden.
• FDP
Ob die deutsche Grenze gesichert werden soll, geht aus dem FDP-Programm nicht klar hervor. Auf unsere Nachfrage dazu reagierte die Partei nicht. Im Wahlprogramm heißt es aber, dass Migrantinnen und Migranten, die die „Voraussetzungen für einen Aufenthalt“ nicht erfüllen, gar nicht erst nach Deutschland einreisen können sollen, was eine wie auch immer geartete Kontrolle der Landesgrenzen nötig machen würde. Die Partei ist laut Wahlprogramm zudem für eine „modellhafte Erprobung von Zurückweisungen an den deutschen Außengrenzen“.
Die FDP will die europäische Grenzschutzagentur Frontex stärken und die EU-Außengrenzen so besser vor „irregulärer Migration und Schleuserkriminalität“ schützen, wie es im Wahlprogramm heißt.
• Grüne
In dem Programm der Grünen heißt es, dass die Reisefreiheit „zu den größten Errungenschaften in Europa“ gehöre und die Partei „dauerhafte stationäre Binnengrenzkontrollen“ ablehne (Seite 132).
Anders sieht die Partei das, wenn es um die europäischen Außengrenzen geht. Man müsse wissen, wer nach Europa komme, heißt es im Programm. Rechtsstaatliche Kontrollen an den Außengrenzen und eine zuverlässige Registrierung der Menschen seien unabdingbar.
GEZ abschaffen oder reformieren

Bei der Forderung, die GEZ (Gebühreneinzugszentrale der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten) abzuschaffen, zeigt sich, dass die „Entscheidungshilfe“ nicht aktuell ist. Die GEZ ist seit Januar 2013 abgeschafft und heißt nun Beitragsservice. Folglich wird auch keine GEZ-Gebühr mehr erhoben, sondern der sogenannte Rundfunkbeitrag, worüber sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk (ÖRR) finanziert.
Der Unterschied zwischen der GEZ-Gebühr und dem Rundfunkbeitrag: Die GEZ-Gebühr mussten nur diejenigen bezahlen, die ein Radio oder einen Fernseher besaßen. Den Rundfunkbeitrag bezahlen hingegen alle Haushalte in Deutschland.
• CDU
Die CDU/CSU erwartet vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk „Sparsamkeit“, heißt es im Wahlprogramm (Seite 55). Von einer Abschaffung des Rundfunkbeitrags ist nicht die Rede. Stichwortsuchen bei Google liefern keinerlei Hinweise darauf, dass die Union plant, die Rundfunkgebühren abzuschaffen.
• SPD
Die SPD will den Rundfunkbeitrag nicht abschaffen, sondern den ÖRR „ durch eine auftragsgerechte, rechtssichere Finanzierung“ stärken (Seite 49 im Wahlprogramm). Allerdings gibt es sehr wohl Bestrebungen, das System umzugestalten. So erklärte der medienpolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag, Helge Lindh, in einem Interview 2022 auf die Frage, wie das verlorengegangene Vertrauen in den ÖRR zurückgewonnen werden könne: „Mit Mut und Demut, mit schonungsloser Ehrlichkeit und Selbstkritik, mit grundlegenden Strukturreformen. Die Devise der Reformierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks muss lauten: mehr Demokratie nach innen, mehr Demokratie nach außen.“
• AfD
Ein sogenannter gebührenfreier Grundfunk soll den ÖRR ersetzen. Letzterer sei nach Ansicht der AfD nicht mehr zeitgemäß und „muss grundlegend reformiert, verschlankt und entideologisiert werden“, heißt es im Wahlprogramm auf Seite 174. Auch was dessen Inhalte sein sollen, wird erwähnt: „Die AfD setzt sich vehement für eine nachhaltige Strukturreform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ein, dessen Aufgabe allein eine gebührenfreie Grundversorgung mit Informations-, Kultur- und Regionalprogrammen sein soll.“
• Linke
Einem Sprecher der Linken zufolge will die Partei die Rundfunkgebühren nicht abschaffen: „Die Linke will eine vielfältige Medienlandschaft, zu der neben privaten Anbietern ein starker öffentlich-rechtlicher Rundfunk und nicht-kommerzielle Medien gehören.“
• FDP
Im Programmentwurf spricht sich die FDP für eine Reform, konkret eine Verschlankung des ÖRR aus. Er soll sich auf Nachrichten, Information und Bildung konzentrieren. Auch die internen Strukturen sollen schlanker werden: „Durch eine Reduktion der Kanäle sowie den Abbau von Doppelstrukturen wollen wir den Rundfunkbeitrag deutlich senken“, heißt es auf Seite 26 des Wahlprogramms.
• Grüne
In ihrem Programm bekennen sich die Grünen zum ÖRR (Seite 140). Dieser sichere „die pluralistische, staatsferne und unabhängige Berichterstattung“ und soll nach dem Willen der Partei eine „auskömmliche Finanzierung“ erhalten.
Unbegrenzte Aufnahme von Asylbewerbern

• CDU
Laut ihrem Wahlprogramm (Seite 40) will die CDU/CSU einen „faktischen Aufnahmestopp“ sofort durchsetzen, indem Personen, die aus einem anderen EU-Mitgliedstaat oder dem Schengen-Raum nach Deutschland einreisen und einen Asylantrag stellen wollen, an den deutschen Grenzen zurückgewiesen werden. Darüber hinaus will die Union weitere „sichere Herkunftsländer“ ausweisen, um Asylverfahren zu beschleunigen und Rückführungen zu erleichtern (Seite 41). Am 3. Februar 2025 hat die CDU auf ihrem Parteitag ein Sofortprogramm beschlossen, das sie im Fall einer Regierungsbeteiligung umsetzen will. Geplant sind unter anderem Zurückweisungen an den Grenzen und ein zeitlich unbefristeter Ausreisearrest für ausreisepflichtige Straftäter und Gefährder. Es soll ein „Zustrombegrenzungsgesetz“ geben und keinen Familiennachzug mehr für subsidiär Schutzberechtigte.
• SPD
Die SPD spricht sich für beschleunigte Asylverfahren, eine „geordnete Migration auf den Arbeitsmarkt und eine bessere Kontrolle der Fluchtmigration“ aus. Sie befürwortet den Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte, fordert aber auch „humane und konsequente“ Rückführungen sowie Abschiebungen, insbesondere von Straftätern. Von einer Deckelung der Flüchtlingszahlen ist im Wahlprogramm keine Rede. Wir haben dazu bei der SPD-Pressestelle nachgefragt. Von dort schrieb man uns: „Wir wollen irreguläre Migration einschränken und stehen gleichzeitig zum Recht auf Asyl.“
• AfD
Die AfD fordert auf Seite 103 des Wahlprogramms, dass die Staatsgrenzen kontrolliert werden, um illegale Migration zu stoppen. Sie will eine „umfassende Rückführungsoffensive“ (Seite 107) und „nicht bleibeberechtigte und ausreisepflichtige Personen konsequent abschieben“ (Seite 106f.). Für eine stabile Rente fordert die Partei auf Seite 20 des Wahlprogramms eine „Begrenzung der Zuwanderung auf qualifizierte Arbeitskräfte, damit diese am Ende ihres Erwerbslebens nicht auf deutsche Sozialleistungen angewiesen sind.“
• Linke
Die Linke lehnt laut ihrem Wahlprogramm alle bisherigen Asylrechtsverschärfungen ab. Auf Anfrage widerspricht Die Linke nicht der Darstellung, dass sie eine unbegrenzte Aufnahme von Asylbewerbern befürwortet. Ein Sprecher schreibt: „Wer in Deutschland Schutz sucht, hat das Recht auf eine Prüfung seines Schutzbedarfs im Einzelfall. Wir fordern eine solidarische Lastenteilung in der EU, so dass alle ihren Beitrag leisten.“
• FDP
Die FDP hat sich nicht für eine unbegrenzte Aufnahme von Asylbewerbern ausgesprochen, sondern fordert klare Regeln zur Migration. „Wer die Voraussetzungen für einen Aufenthalt in Deutschland nicht erfüllt, sollte gar nicht erst dauerhaft nach Deutschland einreisen können“, heißt es im Wahlprogramm auf Seite 28. Dort heißt es auch: „Die Aufnahme- und Integrationsfähigkeit unserer Gesellschaft ist begrenzt. Anhaltend hohe Flüchtlingszahlen überlasten die Infrastruktur in den Kommunen.“
• Grüne
In ihrem Programm schreiben die Grünen auf Seite 127, dass sie eine „funktionierende und pragmatische Flucht- und Migrationspolitik“ wollen, die „Humanität und Ordnung verbindet.“ Man verteidige das Grundrecht auf Asyl und stehe zu den völkerrechtlichen Verpflichtungen, die Deutschland zum Beispiel durch die Genfer Flüchtlingskonvention eingegangen ist. Sie wolle „schnelle und faire Verfahren und damit Klarheit für Betroffene und für die Kommunen schaffen“, so die Partei.
Davon, dass sie „unbegrenzt Asylbewerber“ aufnehmen wolle, ist in dem Programmentwurf nichts zu lesen. Stattdessen schreiben die Grünen auf Seite 130: „Wer nach individueller Prüfung auf asyl- und aufenthaltsrechtliche Voraussetzungen sowie nach Ausschöpfung aller Rechtsmittel kein Aufenthaltsrecht hat und bei dem keine Abschiebungshindernisse entgegenstehen, muss zügig wieder ausreisen. Die freiwillige Rückkehr hat für uns Vorrang […] Ausreisepflichtige, die schwere Straftaten begangen haben, müssen nach Verbüßung ihrer Straftaten prioritär zurückgeführt werden.“
Man wolle mit Dritt- und Transitstaaten zusammenarbeiten, „denn mehr geregelte Migration ermöglicht weniger ungeregelte Migration“, schreibt die Partei.
Kindererziehung bei Rente anrechnen

Aktuell gilt laut der Rentenversicherung: Wer sein Kind in Deutschland erzieht, kann per Antrag bis zu drei Jahre pro Kind für die eigene Rente anrechnen lassen, wenn das Kind nach 1992 geboren wurde. Frauen, deren Kinder vor 1992 geboren sind, bekommen maximal zwei Jahre und sechs Monate als Erziehungszeiten gutgeschrieben. In dieser Zeit übernimmt der Bund die Rentenbeiträge. Diese sogenannte Mütterrente gibt es seit 2014. Im Schnitt steigt die Rente dadurch um 107 Euro, wie eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung ergab.
• CDU
Im Wahlprogramm der Union findet die sogenannte Mütterrente keine Erwähnung, doch die CDU hatte gemeinsam mit der SPD die Mütterrente 2014 eingeführt. Anfang Januar 2025 forderte die CSU, dass Mütter, deren Kinder vor 1992 geboren sind, ebenfalls bis zu drei Jahre pro Kind für die Rente angerechnet bekommen. Der Wirtschaftsrat der Schwesterpartei CDU, eine wirtschaftsnahe Lobbyorganisation, lehnte den Vorschlag der CSU jedoch ab.
• SPD
Die SPD hatte die Mütterrente zusammen mit der CDU 2014 überhaupt erst eingeführt. Im Wahlprogramm heißt es dazu auf Seite 48: „Frauen sollen besser vor Altersarmut geschützt werden. Wir stärken die Anerkennung von Erziehungs- und Pflegezeiten in der Rente und schaffen eine faire Absicherung für alle Lebensphasen.“ Wie genau diese Stärkung aussehen soll, bleibt im Programm offen.
• AfD
Die AfD möchte die Rente langfristig mit einer Reihe von Maßnahmen sichern. Eine davon ist ein Erziehungsgeld, „das Eltern die Eigenbetreuung ihrer Kinder in den ersten drei Lebensjahren finanziell erleichtert“, heißt es auf Seite 20 des Wahlprogramms. Auch eine sogenannte Willkommensprämie von 20.000 Euro für Neugeborene soll gezahlt werden oder als Gutschrift auf künftige Rentenbeiträge erfolgen. 2018 hatte die AfD zudem beantragt, dass die Mütterrente bei der Grundsicherung nicht als zu versteuerndes Einkommen zählen solle.
• Linke
Die Mütterrente wird im Wahlprogramm der Linken nicht erwähnt. Ein Sprecher schreibt auf Anfrage, dass die Linke die Kindererziehung in der Rente anerkenne. „Für jedes Kind werden drei Entgeltpunkte auf dem Rentenkonto gutgeschrieben. Egal ob ein Kind 1960 oder 2010, egal ob es in Frankfurt am Main oder in Frankfurt an der Oder geboren wurde.“
• FDP
Die FDP ist kein Fan der sogenannten Mütterrente und schlug 2024 vor, sie abzuschaffen. Im Wahlprogramm wird stattdessen vorgeschlagen, „dass Paare bei Erwerbsunterbrechungen aufgrund von Carearbeit standardisiert die Möglichkeit des Rentenpunkte-Splittings wahrnehmen“, um Altersarmut zu verhindern. Eine Aufteilung der Rentenpunkte ist derzeit aber nur für verheiratete Paare oder eingetragene Lebenspartnerschaften möglich und auch dann nur unter besonderen Bedingungen. Was konkret der Plan der FDP in diesem Punkt ist, bleibt offen, da unsere wiederholten Anfragen dazu nicht beantwortet wurden.
• Grüne
Darüber, wie künftig die Anrechnung von Kindererziehung bei der Rente geregelt sein soll, steht nichts im Programm der Grünen. Auf Anfrage schreibt uns Sprecher Kai Goll, die Partei wolle statt einer Ausweitung der Mütterrente aus der Grundrente eine sogenannte „Garantierente“ machen. „Konkret schlagen wir vor, dass bei 30 Versicherungsjahren – einschließlich Erziehungs- und Pflegezeiten – mindestens 30 Entgeltpunkte in der Rentenversicherung gutgeschrieben werden.“ Ein Entgeltpunkt entspricht 39,32 Euro. Das käme besonders Frauen zugute, „die aufgrund von Erziehungs- und Pflegezeiten im Berufsleben zurückgesteckt haben und dadurch ein erhöhtes Risiko für Altersarmut tragen“, so Goll.
Erhöhung der Strompreise durch EEG

„EEG“ steht für das Erneuerbare-Energien-Gesetz, das im Jahr 2000 durch die Regierung Schröder eingeführt wurde. Darin enthalten: die EEG-Umlage zur Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien, die die Regierung Scholz jedoch zum 1. Juli 2022 abgeschafft hat. Die EEG-Umlage gehört also nicht mehr zum Strompreis. Daran zeigt sich, dass die Tabelle keine „Entscheidungshilfe“ ist, sondern veraltet.
Die EEG-Umlage machte zudem nur einen kleinen Teil des Strompreises aus – es gab größere Komponenten: Kosten für die Beschaffung und den Vertrieb des Stroms, Netzentgelte, staatlich veranlasste Steuern, Abgaben und etwaige Umlagen. Auf knapp 60 Prozent des Strompreises – wie Netzentgelte, Abgaben, Steuern und Umlagen – kann die Bundesregierung direkt Einfluss nehmen. Das Netzentgelt machte Anfang 2025 rund 26 Prozent des durchschnittlichen Strompreises aus. Die Stromsteuer liegt seit 2003 unverändert bei 2,05 Cent pro Kilowattstunde und machte 2024 etwa fünf Prozent des durchschnittlichen Haushaltspreises.

• CDU
Von einer angeblichen Strompreis-Erhöhung steht nichts im aktuellen CDU/CSU-Wahlprogramm. Im Gegenteil: Die CDU will die Stromsteuer und Netzentgelte senken (Seite 2). Das solle durch Einnahmen aus der CO2-Bepreisung möglich gemacht werden. In dem von der CDU am 3. Februar 2025 beschlossenen Sofortprogramm ist die Rede von einer Entlastung von mindestens fünf Cent pro Kilowattstunde.
• SPD
Auch die SPD will neben Grünen, CDU und FDP die Stromsteuer auf das rechtliche Minimum in der EU absenken – also von aktuell 2,05 Cent auf 0,1 Cent pro Kilowattstunde. Ziel sei, „Strom auch für Privathaushalte bezahlbar zu halten“, hieß es in einer Mitteilung der Fraktion im Bundestag vom Dezember 2024.
Die SPD will erneuerbare Energien vorantreiben und das Stromnetz entsprechend ausbauen. Dass das teuer ist, ist der Partei klar. Laut Wahlprogramm lautet der Plan so: „Wir werden die Entgelte für das Übertragungsnetz […] zunächst stabilisieren, dann schnellstmöglich auf 3 Cent pro Kilowattstunde deckeln und so den Netzausbau unterstützen.“
• AfD
„Das EEG ist ersatzlos zu streichen“, formuliert die AfD klar auf ihrer Webseite. Im Wahlprogramm wird die EEG-Umlage als „ideologiegetrieben“ bezeichnet und deren Abschaffung angekündigt – allerdings gibt es die Umlage schon seit 2022 nicht mehr. Vermutlich meint die AfD, dass das ganze Erneuerbare-Energien-Gesetz gestrichen werden soll. Auf unsere Anfrage dazu, inwiefern die AfD eine Umlage abschaffen will, die es gar nicht mehr gibt, erhielten wir bis zur Veröffentlichung keine Antwort.
Ziel des seit dem Jahr 2000 bestehenden Gesetzes ist, das Stromnetz vorwiegend auf die Verwendung erneuerbarer Energien umzuwandeln. Bis 2030 sollen so 80 Prozent des Stromverbrauchs in Deutschland aus erneuerbaren Energien kommen, wie das Umweltbundesamt schreibt.
• Linke
Die Linke fordert in ihrem Wahlprogramm sozial gestaffelte Energiepreise und „preisgünstige Sockeltarife“ für den Verbrauch von elektrischem Strom und Heizenergie, nach dem Motto: „Wer mehr verbraucht, zahlt mehr.“
Weiter schreibt die Partei, dass der Ausbau von erneuerbaren Energien die Preise für Strom und Wärme langfristig senken werde, aber „kleine Energieverbraucher*innen“ bis dahin kurzfristig entlastet werden sollten. Heiz- und Strompreise sollten „wieder bezahlbar“ werden.
• FDP
Die Energiepreise zu senken ist eines der expliziten Ziele im Wahlprogramm der FDP (ab Seite 16). Die Partei will, wie die SPD, die Stromsteuer von aktuell 2,05 Cent pro Kilowattstunde auf das EU-Mindestmaß von 0,1 Cent pro Kilowattstunde senken – und verspricht, sich langfristig für ihre Abschaffung einzusetzen. Zudem will die Partei Netzentgelte „umfassend reformieren“.
Die FDP setzt auch auf erneuerbare Energien, will jedoch EEG-Subventionen für neue Anlagen abschaffen; sie sei „nicht mehr zu rechtfertigen“, wie es im Wahlprogramm auf Seite 17 heißt.
• Grüne
Die Grünen weisen in ihrem Programm darauf hin, dass die Umlage aus dem Erneuerbare-Energien-Gesetz bereits abgeschafft wurde und „vollständig aus dem Haushalt“ finanziert wird.
Auch die Grünen wollen die Stromsteuer auf das EU-Mindestmaß von 0,1 Cent pro Kilowattstunde für Haushalte absenken. Die Finanzierung des Netzausbaus soll reformiert werden, um Netzentgelte senken zu können.
Für Schulden anderer EU-Länder haften
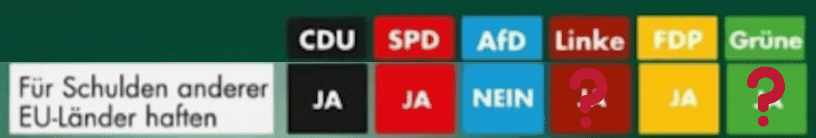
Dass EU-Länder nicht für die Schulden anderer Mitgliedstaaten haften sollen, wurde 1992 im Vertrag von Maastricht festgeschrieben und später in den Vertrag über die Arbeitsweise der EU aufgenommen (Artikel 125). Dennoch gab es wiederholt Rettungspakete für Länder wie Griechenland, die in finanzielle Schieflage geraten waren.
Solche Kredite bedeuten nicht, dass Deutschland und andere Mitgliedsländer immer für fremde Schulden haften würden – das heißt, sie können rechtlich nicht dafür verantwortlich gemacht werden, wenn andere Länder verschuldet sind.
Einige Expertinnen und Experten bewerten jedoch EU-Mittel, in die Mitgliedsländer bereits einzahlen, wie den Corona-Wiederaufbaufonds oder das Sure-Kurzarbeiterprogramm als Maßnahmen, die eine gemeinsame Schuldenaufnahme der EU-Staaten ermöglichen könnten. So nahm die EU für den Wiederaufbaufonds Darlehen am Finanzmarkt auf.
• CDU
Anders als behauptet, plant die CDU nicht, dass Deutschland künftig für die Schulden anderer Länder haftet. Im Wahlprogramm der Union (Seite 8) heißt es: „Allen Formen einer Haftung Deutschlands für Schulden anderer EU-Staaten erteilen wir eine klare Absage.“ Verstöße gegen die Schuldenstandsquote müssten sanktioniert werden (Seite 76).
• SPD
Im Wahlprogramm der SPD haben wir dazu nichts gefunden. Wir haben bei der Pressestelle der SPD nachgefragt, ob Deutschland für die Schulden anderer EU-Länder haften soll. Die Antwort: „Nein.“
• AfD
Die Politik der Anleihen der Europäischen Zentralbank (EZB) „verletzt geltendes EU-Recht, darunter das Verbot der Staatsfinanzierung durch die Zentralbank und das Verbot der Haftung für Schulden anderer Mitgliedstaaten“, heißt es auf Seite 64 im Wahlprogramm.
Hintergrund ist, dass die EZB bei nationalen Banken Staatsanleihen kauft. Damit kommt mehr Geld in Umlauf und die Konjunktur des jeweiligen Landes kommt in Schwung. Weil das auch gemacht wird, um wirtschaftlich schwache Länder zu unterstützen, kommt der Vorwurf auf, die EZB betreibe eine eigene Wirtschaftspolitik, was sie jedoch laut EU-Verträgen nicht darf.
• Linke
Auf Anfrage schreibt ein Sprecher: „Die Linke fordert eine solidarische Finanzpolitik in der EU, spricht sich aber nicht ausdrücklich für eine generelle Haftung Deutschlands für die Schulden anderer EU-Länder aus.“
• FDP
Auf Seite 35 des Wahlprogramms heißt es, dass die EU sich nicht verschulden können sollte. Die FDP positionierte sich zudem bereits in der Vergangenheit beispielsweise gegen Eurobonds, mit denen EU-Staaten gemeinsam Geld an internationalen Finanzmärkten aufnehmen können.
Durch eine gemeinsame Ausgabe von Eurobonds könnten hoch verschuldete Eurostaaten Geld am Finanzmarkt zu erheblich günstigeren Konditionen erhalten als durch die Ausgabe eigener Staatsanleihen, auf die bei schlechter Bonität wesentlich höhere Zinsen anfallen würden. Umgekehrt müssten relativ stabile Euroländer wie Deutschland höhere Zinsen zahlen als bei der Ausgabe eigener, deutscher Staatsanleihen. Eurobonds sind daher umstritten, wie etwa die Bundeszentrale für politische Bildung schreibt.
• Grüne
Dazu, ob die Grünen gemeinsame Schulden in der EU befürworten oder nicht, finden sich im Programm der Partei keine direkten Aussage. Die Partei schreibt auf Seite 144, dass es „mehr Finanzkraft auf europäischer Ebene“ brauche und dass die EU neue Eigenmittel brauche. Einnahmen, „die durch europäische Instrumente entstehen“, sollten dem EU-Haushalt zugutekommen. Investitionen „mit höchster Priorität für unsere Sicherheit, unseren Wohlstand, den sozialen Frieden und den Klimaschutz“ will die Partei unter „Einbeziehung aller Finanzierungsoptionen gemeinsam stemmen“. Was das für eine gemeinsame Schuldenaufnahme der EU-Länder bedeutet, bleibt aber unklar.
Auf unsere Frage dazu antwortete Pressesprecher Kai Goll indirekt. Die gemeinsame Aufnahme von europäischen Schulden sei nach dem Corona-Wiederaufbaufonds für 750 Milliarden Euro „kein Neuland“ mehr. Ein weiteres Beispiel für gemeinsame Anleihen sei das Sure-Kurzarbeiterprogramm: Dabei hatte die EU Darlehen an Staaten vergeben, die Arbeitsplatzverluste in Folge der Corona-Pandemie fürchteten.
Gegen Links- und Rechtsextremismus

• CDU
Die Union schreibt in ihrem Wahlprogramm (Seite 5): „Wir bekämpfen jede Form von Extremismus, Gewalt und Terror mit voller Härte.“ Die Partei betont auch, dass sie Linksextremismus genauso konsequent begegnen wolle wie Rechtsextremismus und dass es auch gegenüber Islamismus eine „Wachsamkeit“ brauche. Wer Terrororganisationen unterstützt, dem soll die Ausweisung, der Entzug des Aufenthaltstitels oder der Verlust der deutschen Staatsbürgerschaft drohen. Die Union plant außerdem, Moscheen zu schließen, sollte dort Hass und Antisemitismus gepredigt werden.
• SPD
Die SPD tritt „entschlossen gegen jede Form von Extremismus ein“, heißt es im Wahlprogramm auf Seite 35. Im Kampf gegen Extremismus setze man vor allem auf Prävention, um extremistische Tendenzen und Demokratiefeindlichkeit „frühzeitig zu bekämpfen“ (Seite 41).
Mehrfach erwähnt werden Rechtsextremismus und Islamismus; Linksextremismus wird im Programm dagegen nicht explizit genannt. Jedoch haben sich in der Vergangenheit einige Abgeordnete der Partei gegen Linksextremismus ausgesprochen. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Sebastian Fiedler etwa erklärte in einem Interview mit dem Deutschlandfunk 2023, man dürfe Linksextremismus nicht verharmlosen, es gebe eine „zunehmende Radikalisierung“ unter Linksextremen.
• AfD
Laut ihres Wahlprogramms will die AfD gegen jede Form von Extremismus vorgehen: „Das gilt sowohl für den Rechtsextremismus als auch für den Linksextremismus sowie den religiösen – meist islamistisch geprägten – Extremismus.“ Die Partei betont dazu, die Bekämpfung des Linksextremismus werde „staatlicherseits momentan sträflich vernachlässigt“. Sie duldet allerdings ihre eigenen, vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuften Landesverbände in Sachsen und Thüringen. Die AfD beschloss jedoch die Neugründung ihrer Jugendorganisation, die bisherige, die Junge Alternative, gilt dem Verfassungsschutz ebenfalls als gesichert rechtsextrem.
• Linke
In ihrem Wahlprogramm spricht sich die Linke deutlich gegen Rechtsextremismus aus, unter anderem will die Partei entsprechende Projekte fördern und die parlamentarische Aufklärung von „Rechtsterror“ im Bundestag vorantreiben. Sie fordert „das Verbot militanter, bewaffneter, neonazistischer Organisationen“ und will Artikel 139 des Grundgesetzes ändern, damit künftig eine „Wiederbelebung nationalsozialistischen Gedankenguts und Handlungen, die in der Absicht vorgenommen werden, das friedliche Zusammenleben der Völker zu stören“ verfassungswidrig ist.
Auf Linksextremismus geht Die Linke in ihrem Wahlprogramm nicht ein. Auf Nachfrage schreibt ein Sprecher: Der Begriff „Linksextremismus“ suggeriere eine Gleichheit des „Extremismus“ von links und rechts. Faschistische und autoritäre Strömungen negierten Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, wohingegen sich die „radikale Linke“ für Aufklärung, die Gleichheit aller Menschen und ihre Rechte auf demokratische Selbstbestimmung einsetze. „In diesem Sinne“, so der Sprecher der Linken, „setzen wir uns nicht gegen Linksextremismus ein. Gewalt zur Durchsetzung politischer Ziele lehnen wir klar ab“.
• FDP
Das FDP-Wahlprogramm enthält zu politischem Extremismus mehrere Absätze. So wird etwa besonders in Bezug auf die Sicherheit von Jüdinnen und Juden erwähnt, dass sowohl rechtsextremistischer als auch linksextremistischer Antisemitismus „konsequent bekämpft“ werden soll. Dort heißt es zudem allgemein: „Wir Freie Demokraten lehnen jede Form des politischen und religiösen Extremismus strikt ab.“
• Grüne
In ihrem Programm positionieren sich die Grünen gegen Extremismus jeglicher Art. So schreibt die Partei auf Seite 136, „menschenverachtende und verfassungsfeindliche Ideologien“ säten Hass, spalteten die Gesellschaft und seien der „Wegbereiter für Gewalt und Terror“. Gleichzeitig weist sie darauf hin, dass die größte Gefahr vom Rechtsextremismus ausgehe. Diese Einschätzung teile auch das Bundesamt für Verfassungsschutz.
Auch Islamismus wird als Gefahr benannt, linken Extremismus erwähnen die Grünen nicht explizit. Mit frühzeitiger Prävention will die Partei verhindern, „dass Menschen sich radikalisieren“. Präventionsarbeit will sie stärken und „dauerhaft mit einem Demokratiefördergesetz gesetzlich absichern“.
Die Partei positioniert sich also gegen jeglichen Extremismus – setzt den Fokus in ihrem Wahlprogramm aber auf Rechtsextremismus.
Der Islam gehört zu Deutschland

Der Satz, „der Islam gehört zu Deutschland“, hat in der politischen Debatte eine lange Geschichte. Darüber berichtete unter anderem der Deutschlandfunk im Jahr 2015. Demzufolge sagte der ehemalige Innen- und Finanzminister der CDU, Wolfgang Schäuble, schon bei der ersten Islamkonferenz im Jahr 2006: „Der Islam ist Teil Deutschlands und Europas“.
• CDU
Ein klares Bekenntnis dazu, ob der Islam zu Deutschland gehört, findet sich im Wahlprogramm der Union nicht. Vielmehr geht es darin um die Bekämpfung von „islamistischem Terror“, also religiös motiviertem Terrorismus. So will die Union zum Beispiel wieder den Expertenkreis „Politischer Islamismus“ einsetzen. Dieser beriet 2021 und 2022 das Bundesinnenministerium zu Erscheinungen des politischen Islamismus aus wissenschaftlicher Perspektive.
Auf die Frage, ob für die Unionspartei aktuell der Islam zu Deutschland gehört, erhielten wir trotz mehrfacher Nachfrage keine Antwort von der CDU-Pressestelle.
• SPD
Im Wahlprogramm der SPD taucht die Religion Islam größtenteils in Zusammenhang mit den Begriffen Islamismus und dessen Prävention auf. An einer Stelle geht die Partei aber auch auf Muslimfeindlichkeit ein und schreibt: „Wir stellen uns weiterhin entschlossen gegen jede Form von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit.“
Wir haben bei der Pressestelle der SPD nachgefragt, ob für die Partei der Islam zu Deutschland gehöre. Die Antwort: „Ja.“
• AfD
Auf der Webseite der AfD findet sich ein Themenpunkt, der lautet: „Der Islam gehört nicht zu Deutschland.“ Kanzlerkandidatin Alice Weidel macht aus ihrer Fremdenfeindlichkeit Musliminnen und Muslimen gegenüber auch keinen Hehl.
• Linke
Im Wahlprogramm der Linken heißt es auf Seite 50: „Das muslimische Zuckerfest und der höchste jüdische Feiertag Yom Kippur sollen gesetzliche Feiertage in Deutschland werden, denn der Islam und das Judentum gehören zu Deutschland.“
• FDP
Die FDP betrachtet den Islam als Teil von Deutschland. So heißt es im Wahlprogramm etwa: „Die Ausbildung von Imamen und islamischen Religionslehrern an deutschen Universitäten muss ausgebaut werden“, damit der Einfluss von Imamen aus autokratischen oder islamistischen Ländern verringert werden könne. Abgesehen davon geht es im Wahlprogramm jedoch häufiger um Islamismus, der im Kontext von Bedrohungen erwähnt wird, etwa in extremistischer Form als Gefahr für die jüdische Gemeinde oder die Demokratie.
Es haben sich auch hochrangige FDP-Mitglieder klar zum Islam als Teil Deutschlands bekannt. Vize-Vorsitzender Wolfgang Kubicki etwa erklärte 2018 in einem Interview: „Wir haben mehr als vier Millionen Menschen mit muslimischem Glauben in Deutschland leben. Selbstverständlich gehören die auch als Teil unserer Gesellschaft zu uns“.
• Grüne
Die Grünen positionieren sich in ihrem Programm deutlich für Musliminnen und Muslime. So will die Partei mit einer „Nationalen Strategie“ gegen Islamfeindlichkeit und „die zunehmende Diskriminierung von Muslim*innen und muslimisch gelesenen Menschen“ vorgehen. Sie will außerdem die Ausbildungen von Imaminnen und Imamen in Deutschland vorantreiben und die „Unabhängigkeit der islamischen Gemeinden“ stärken.
Das bedeutet laut Sprecher Kai Goll, dass man die Deutsche Islamkonferenz weiterentwickeln und „in unserem politischen Handeln auch progressive, liberale muslimische Vertretungen einbinden“ wolle. Zudem solle die Finanzierung von Moscheegemeinden unabhängiger werden, um eine Einflussnahme aus dem Ausland zu verhindern.
Volksentscheide auf Bundesebene

Bei Volksentscheiden können Menschen unmittelbar politische Entscheidungen treffen. In Deutschland sind Volksentscheide auf Bundesebene, wie die Bundeszentrale für Politische Bildung schreibt, nur dann möglich, wenn die Grenzen eines Bundeslandes verändert werden sollen. Das geht aus dem Gesetz über das Verfahren bei Volksentscheid, Volksbegehren und Volksbefragung nach Artikel 29 Absatz 6 des Grundgesetzes hervor. Ebenso kann ein Volksbegehren, also die Initiative, dass es einen Volksentscheid geben soll, auf Bundesebene auch nur darauf gerichtet sein, die Zuteilung der Bundesländer zu verändern.
• CDU
Weder im Wahlprogramm der Union noch im Grundsatzprogramm der CDU spricht sich die Partei für die Einführung von Volksentscheiden auf Bundesebene aus. Im Grundsatzprogramm heißt es: „Wir bekennen uns zur repräsentativen Demokratie. […] Partizipative Demokratieelemente können eine sinnvolle Ergänzung sein, aber sie können etablierte Repräsentationsverfahren nicht ersetzen.“ Trotz mehrfacher Nachfrage antwortete die CDU-Pressestelle nicht auf unsere Anfrage dazu.
• SPD
Die SPD setzt sich schon seit Jahren für mehr direkte Demokratie ein. Das zeigt etwa ein Vorstoß von 2013, bei dem die SPD-Fraktion mehr Instrumente direkter Demokratie, wie etwa Volksentscheide und Volksbegehren, im Grundgesetz verankern wollte.
Von der Pressestelle der SPD schreibt man uns aktuell aber: „Anstatt auf Volksentscheide setzten wir uns für mehr Bürgerbeteiligung auf Bundesebene ein. Wir sind dafür, dass geloste Bürgerräte als feste Bestandteile unserer Demokratie etabliert werden.“ Auf Landesebene gibt es aber auch zu Volksentscheiden Vorstöße: 2024 schlug die Berliner SPD vor, das Parlament solle Volksentscheide anregen können. Konkret ging es dabei um ein lokales Thema: die Randbebauung des Tempelhofer Felds.
• AfD
„Wir fordern Volksentscheide nach Schweizer Vorbild auch für Deutschland“, heißt es auf Seite 130 des Wahlprogramms. Sogar Verfassungsänderungen sollen per Volksabstimmung beschlossen werden können.
In der Schweiz gibt es Volksabstimmungen seit 1848. Eine Mehrheit von 50 Prozent entscheidet über Ja oder Nein zum Vorschlag. Bei Änderungen der Verfassung muss zusätzlich mindestens die Hälfte der Kantone zugestimmt haben.
• Linke
Die Linke spricht sich in ihrem Wahlprogramm deutlich für die Einführung von Volksentscheiden auf Bundesebene aus. Sie schreibt: „Wir wollen Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheide, Bürger*inneninitiativen, Bürger*innenbegehren und Bürger*innenentscheide auf Bundesebene einführen.“
• FDP
Im Wahlprogramm von 2017 fand sich noch die Idee, Instrumente der direkten Demokratie auszuprobieren. Damals wollte die FDP unter anderem „den probeweisen Ausbau von Instrumenten der direkten Demokratie auf kommunaler Ebene und Landesebene unterstützen“. Um Volksentscheide auf Bundesebene ging es aber weder damals, noch steht davon etwas im aktuellen Wahlprogramm. Auf unsere Anfrage dazu antwortete die FDP bis zur Veröffentlichung dieses Textes nicht.
• Grüne
Volksentscheide kommen im Programm der Grünen nicht vor, im Jahr 2020 strich die Partei diese aus ihrem Grundsatzprogramm. Sie will stattdessen sogenannte „Bürgerräte“ stärken. Sie böten die Möglichkeit, den Rat von „Menschen als ‚Expert*innen des Alltags‘ in einem repräsentativen Verfahren einzuholen“.
Der Deutsche Bundestag schreibt dazu auf seiner Homepage: „Bürgerräte sind Versammlungen von 30 bis 200 per Los zufällig ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern, die bei mehreren Terminen gemeinsam und in Kleingruppen ein vorgegebenes Thema diskutieren und der Politik ihre Handlungsempfehlungen als Bürgergutachten übergeben.“
EU grundlegend reformieren

• CDU
Auf Seite 30 im Grundsatzprogramm der CDU steht, die Partei wolle „inneren Prozesse“ der EU reformieren. So sollen beispielsweise Entscheidungsverfahren in der Außen- und Sicherheitspolitik durch qualifizierte Mehrheitsentscheidungen beschleunigt und die EU-Kommission „spürbar verkleinert“ werden. Die CDU fordert zudem ein Initiativrecht des EU-Parlaments, also dass künftig auch Gesetzesvorschläge vom Parlament eingebracht werden können.
Im Wahlprogramm der Union (Seite 52) finden sich außerdem mehrere Vorschläge dazu, wie die Bürokratie in der EU abgebaut werden soll.
• SPD
Die Pressestelle antwortete uns auf Nachfrage: „Schon heute kommt die EU an die Grenzen ihrer Handlungsfähigkeit. Spätestens mit der EU-Erweiterung müssen Europäische Vertragsreformen erfolgen. Hierfür setzen wir uns für eine ergebnisorientierte Einsetzung eines Europäischen Konvents ein.“ Europäische Konvente setzen sich aus Vertretern der nationalen Regierungen und Parlamente sowie der Europäischen Kommission und des Europäischen Parlaments zusammen. Einberufen wurden sie zuletzt in den Jahren 1999/2000 und 2002/2003, um die Charta der Grundrechte der Europäischen Union festzulegen und EU-Verträge zu reformieren.
Die SPD will laut Europawahlprogramm von 2024 auch das Einstimmigkeitsprinzip im Europäischen Rat abschaffen, sodass das Vetorecht einzelner Länder nicht mehr Druckmittel missbraucht werden kann. Und sie fordert ein Initiativrecht für das EU-Parlament, sodass von dort direkt Gesetzesvorschläge eingebracht werden können. Bislang darf das, bis auf wenige Ausnahmefälle, nur die EU-Kommission. Das Parlament kann zwar die EU-Kommission auffordern, einen Vorschlag einzubringen, daran halten muss sie sich aber nicht.
• AfD
Das Wahlprogramm lässt keine Fragen offen, was den Reformbedarf der EU nach Ansicht der AfD angeht: „Daher streben wir einen ‚Bund europäischer Nationen‘ an, eine neu zu gründende europäische Wirtschafts- und Interessengemeinschaft, in der die Souveränität der Mitgliedstaaten gewahrt ist und nur dort zusammengearbeitet wird, wo echte gemeinsame Interessen bestehen. Alle anderen Bereiche gehen zurück in die Zuständigkeit der Nationalstaaten.“
• Linke
Aus dem Grundsatzprogramm der Linken geht hervor, dass die Partei die EU grundlegend reformieren will (Seite 85). Die Linke spricht von einem „Neustart mit einer vollständigen Revision jener primärrechtlichen Grundelemente der EU, die militaristisch, undemokratisch und neoliberal sind“. Die Partei setzt sich dabei unter anderem für eine Verfassung ein, die von Bürgerinnen und Bürgern mitgestaltet und über ein Referendum abgestimmt werden soll. Zudem will die Linke laut ihrem Wahlprogramm die europäische Grenzschutzagentur Frontex durch ein ziviles europäisches Seenotrettungsprogramm ersetzen.
• FDP
Die FDP will die EU laut Wahlprogramm (Seite 50) explizit reformieren: Die „Erfolgsgeschichte“ der EU müsse man „durch mutige Reformen sichern und fortschreiben.“ Konkret soll unter anderem die EU-Kommission verkleinert und das Parlament mit einem Initiativrecht ausgestattet werden, wie es ebenfalls im Wahlprogramm heißt. Dieses Initiativrecht, das seit Jahren immer wieder diskutiert wird, würde ermöglichen, dass das EU-Parlament selbstständig Gesetzesvorschläge macht. Bislang darf das, bis auf wenige Ausnahmefälle, nur die EU-Kommission. Das Parlament kann zwar die EU-Kommission auffordern, einen Vorschlag einzubringen, daran halten muss sie sich aber nicht.
• Grüne
Europa spielt in dem Programm der Grünen eine wichtige Rolle. Konkret fordert die Partei, zum Beispiel auf Seite 20, den europäischen Binnenmarkt zu vertiefen und eine sogenannte „Digitalunion“ aufzubauen. Damit ist gemeint, dass Digitalunternehmen gefördert werden sollen.
Zudem spricht sich die Partei für „eine rasche Vollendung der Kapitalmarkt- und Bankenunion“ aus. Das heißt, dass die Finanzmärkte der europäischen Länder einheitliche Regeln bekommen sollen, um es Investorinnen und Investoren leichter zu machen, grenzüberschreitend zu investieren.
Weiter möchte die Partei neue Mitglieder in die EU aufnehmen, man unterstütze den Beitrittswunsch der Westbalkanstaaten, der Ukraine, Moldaus und Georgiens, sofern alle Beitrittskriterien erfüllt seien. Auch eine demokratische Türkei will die Partei in die EU aufnehmen (Seite 143).
Andere Reformen, die sich im Programmentwurf finden, sind, dass das Europäische Parlament „ein vollwertiges Initiativrecht für die Einbringung von Gesetzen“ bekommen soll. Damit soll künftig auch das direkt gewählte Europäische Parlament Gesetzesvorschläge einreichen können. Bisher kann nur die vom EU-Parlament gewählte Europäische Kommission Vorschläge vorlegen.
Die weitreichendste Reform, die die Grünen vorschlagen, ist, dass der Rat der EU künftig nicht mehr einstimmig entscheiden soll, sondern zum Beispiel in der Außen- und Sicherheitspolitik Mehrheitsentscheidungen trifft. Der Rat der EU, in dem Ministerinnen und Minister der Mitgliedstaaten sitzen, entscheidet neben dem EU-Parlament über Gesetzgebungsvorschläge der Kommission.
Alle Faktenchecks rund um die Bundestagswahl 2025 lesen Sie hier.
Korrektur, 11. Februar 2025: Wir haben die Grafiken näher erläutert und die Bildunterschrift einer Grafik geändert.
Redigatur: Paulina Thom, Sarah Thust, Gabriele Scherndl
Die wichtigsten, öffentlichen Quellen für diesen Faktencheck:
- Wahlprogramm der CDU/CSU zur Bundestagswahl 2025: Link (archiviert)
- Grundsatzprogramm der CDU von 2024: Link (archiviert)
- Wahlprogramm der SPD zur Bundestagswahl 2025: Link (archiviert)
- Wahlprogramm der AfD zur Bundestagswahl 2025: Link (archiviert)
- Leitantrag der AfD zum Wahlprogramm zur Bundestagswahl von November 2024: Link (archiviert)
- Wahlprogramm von Die Linke zur Bundestagswahl 2025: Link (archiviert)
- Parteiprogramm von Die Linke von 2024: Link (archiviert)
- Wahlprogramm der FDP zur Bundestagswahl 2025: Link (archiviert)
- Wahlprogramm der Grünen zur Bundestagswahl 2025 (Link) archiviert





