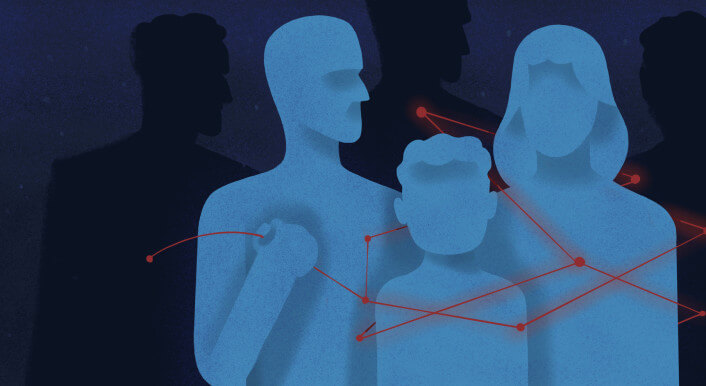Im Glashaus – Machtmissbrauch und sexuelle Belästigung im EU-Parlament
Kurz vor den EU-Wahlen drängt hinter den Kulissen im Europa-Parlament ein brisantes Thema auf die Tagesordnung: Sexuelle Übergriffe und Mobbing im eigenen Haus. Gegenüber CORRECTIV und Stern berichten mehrere Dutzend Frauen und Männer von unerwünschten Berührungen, psychischer Schikane und offener Gewalt – zumeist von Abgeordneten

In dieser Nacht passiert es Sophie Lehnert. Es ist spät, die Party schon zu Ende. Ihr schwirrt der Kopf, sie kann das alles kaum fassen: das opulente Essen, die Musik, die Abgeordneten, Assistenten, Berater – und sie mittendrin. Dann geschieht die Tat, die Lehnert kalt erwischt, und was als rauschender Abend begann, wird einige Monate später zu einem aktenkundigen Fall.
„Ich hatte gar keine Vorstellung davon, wie es ist, wenn einem so etwas mal selbst widerfährt“, sagt sie heute im Rückblick. „Ich dachte immer: Man wird doch irgendetwas tun können, um sich zu wehren.“
Sophie Lehnert heißt eigentlich anders. Sie ist damals Anfang 20, Praktikantin bei einer Fraktion im EU-Parlament in Brüssel. Was genau in der Nacht damals vorfiel, die Abfolge der Ereignisse, muss geheim bleiben, denn Lehnert soll nicht erkannt werden. Wenn sich ihre Vorwürfe bestätigen, kann man von sexueller Nötigung sprechen. Der mutmaßliche Täter: der Assistent eines deutschen Abgeordneten.
„So, als ob jemand ein bisschen Würde von einem nimmt“
Etwa ein Jahr ist der Übergriff inzwischen her. Wie sie sich heute fühlt? Irgendwie okay. Irgendwie nervös. Irgendwie verunsichert. Es gibt Momente, da kommen ihre Zweifel wieder hoch: Hat sie den Mann ermuntert? War sie auf der Party vielleicht zu flirty, zu naiv, zu fröhlich?
Als die Situation kippt, ist es schon nach Mitternacht: Nach dem Ende der offiziellen Feier hat sich die Menge zerstreut, und sie ist plötzlich mit dem Kollegen alleine. Lehnert sagt, er habe sie begrabscht, überall, auch an den intimsten Stellen, so sei das eine ganze Zeit gegangen. Wie lange genau, kann sie nicht mehr sagen, nur, dass der Mann irgendwann von ihr abließ. Sie sagt: „Es ist so, als ob jemand ein bisschen Würde von einem nimmt.“
Niemand weiß, wie viele Fälle wie den von Sophie Lehnert es gibt; sexuelle Übergriffe und Grenzüberschreitungen im EU-Parlament werden in keiner Statistik erfasst. Es gibt aber Hinweise darauf, dass solche Verstöße häufig passieren. Hört man sich unter EU-Beschäftigten um, nennen sie Politiker, denen man aus dem Weg gehen sollte – es fallen immer wieder die selben, zum Teil prominenten Namen.
In Teilen geprägt von Machtmissbrauch und Straflosigkeit
Hinter der Fassade des Parlaments gären Wut und Empörung. Während die Europawahlen Anfang Juni kurz bevorstehen und um Themen wie Migration, Wirtschaft und Klimaschutz gerungen wird, drängt hinter den Kulissen ein ganz anderes Problem auf die Tagesordnung: sexuelle Belästigung im eigenen Haus.
Immer neue Vorwürfe machen die Runde, und nicht nur sexuelle Übergriffe, auch Mobbing ist offenbar weit verbreitet und bleibt oft folgenlos für die Politiker. Assistentinnen, Beobachter und Arbeitnehmervertreter sprechen von einer Kultur, die in Teilen bestimmt ist von Machtmissbrauch und Straflosigkeit.
Die Initiative MeToo EP hat im März eine Umfrage veröffentlicht: Mehr als 1100 Beschäftigte nahmen teil, zwei Drittel davon waren weiblich. Fast 50 Prozent haben demnach Mobbing erlebt, rund 15 Prozent sexuelle Belästigung. Knapp sieben Prozent körperliche Gewalt – alles am Arbeitsplatz, im EU-Parlament – ausgerechnet an dem Ort, wo für ganz Europa Gesetze gemacht werden, die eigentlich alle Bürgerinnen und Bürger vor Übergriffen am Arbeitsplatz und vor sexueller Gewalt schützen sollen.
Für manche ist das Parlament ein Haus der Angst
CORRECTIV und Stern haben wochenlang im EU-Parlament und anderen EU-Institutionen recherchiert und sind auf insgesamt elf Fälle von sexuellen Übergriffen und Zudringlichkeiten gestoßen – und außerdem auf 15 Fälle von psychischer Schikane. Es geht um prominente Christdemokraten, die mit Ordnern werfen und herumbrüllen, es geht um Mitarbeiter des Parlaments, die jungen Frauen in Meetings auflauern und ihnen später heimlich aufgenommene Fotos der Frauen schicken. Und um hochrangige Beamte, deren Verurteilung wegen Vergewaltigung totgeschwiegen wird. Manche der Vorfälle waren bereits in der Presse, viele tauchen bisher nicht öffentlich auf.
Aus Dokumenten, Mails, Berichten und Dutzenden Gesprächen mit Betroffenen, Politikern, Anwältinnen, Assistentinnen und Arbeitnehmervertretern ergibt sich ein bedrückendes Bild: Es gibt auch männliche Mitarbeiter, die von Terror auf der Arbeit und gravierendem Mobbing und sexuellen Übergriffen sprechen. Vor allem aber für viele junge Frauen ist das EU-Parlament ein Haus der Angst.
Selbst, wenn Beschäftigte Übergriffe melden oder Beschwerde einreichen, werden Vorwürfe oft nicht aufgeklärt oder geahndet. Betroffene, Expertinnen und Insider sagen: Die Parlamentarier umgibt ein schützender Kokon aus Macht und Mandat. Den Betroffenen bleibt in vielen Fällen nichts anderes übrig, als zu kündigen und zu verschwinden.
„Hier gibt es Abgeordnete, bei denen wir einander warnen: Wenn du einen Rock trägst, geh‘ nicht zu dem rein“, sagt die Assistentin einer deutschen Abgeordneten.
„Betroffene haben Angst, ihren Job zu verlieren, weil die Abgeordneten ihren Einfluss nutzen können, um ihre Karriere zu zerstören“, sagt eine andere junge Beschäftigte.
Mit Beklemmungen im Fahrstuhl
Oft mischen sich Privates und Arbeit, die Grenzen sind fließend; gerade Berufsanfängerinnen kommen in heikle Situationen. Eine ehemalige Assistentin erzählt, wie junge Frauen von Abgeordneten beauftragt werden, auf abendlichen Empfängen „mindestens 20“ Visitenkarten von Abgeordneten und einflussreichen Leuten zu sammeln. Vor allem junge Frauen tappen mitunter in die Falle. Sie tun das, was von ihnen erwartet wird: Auf Parties und Empfängen versuchen sie Kontakte zu knüpfen – und geraten mitunter an enthemmte Abgeordnete auf Anmachtour. Und immer wieder hört man von Mitarbeiterinnen, die nur mit Beklemmungen in Fahrstühle steigen.
Betritt man das Parlament in Straßburg, beginnt eine andere Welt mit einer starren Klassengesellschaft; vor den Sitzungssälen stehen schweigende Saaldiener mit schweren Silberketten, und es gibt Bars mit „Fast Lanes“ nur für Abgeordnete.
Jobs und Praktika in den Fraktionen und den Parlamentsbüros sind heiß begehrt, Stress, Druck und einen oft rüden Ton nehmen viele in Kauf – sexuelle Belästigung und ein zum Teil brutales Mobbing gehören offenbar in vielen Fällen dazu.
Das Zentrum der Demokratie – ohne Gewaltenteilung
Die Recherche zeigt: Gerade in der EU, dem Zentrum der Demokratie in Europa, wo jedes Jahr einige Hundert Richtlinien, Beschlüsse und Verordnungen entstehen, offenbaren sich frappierende demokratische Defizite: In den EU-Institutionen gilt kein nationales Arbeitsrecht, sondern staff regulations, das bedeutet: Die EU-Institutionen geben sich ihre Regeln selbst, setzen sie selbst um und überwachen sie selbst. Statt Transparenz herrscht in vielen Fällen organisiertes Schweigen.
Das Problem räumen selbst hochrangige EU-Politiker ein: „Wenn ein Kommissar durch einen anderen Kommissar kontrolliert wird oder ein Parlamentarier durch andere Parlamentarier, ist die Gefahr groß, dass ,ein Auge zugedrückt‘’ wird”, sagt Katarina Barley, Spitzenkandidatin der SPD für die EU-Wahlen und Vize-Präsidentin des europäischen Parlaments.
Das EU-Parlament weist Vorwürfe über Missstände in der Verwaltung bei dem Thema zurück: Eine Sprecherin teilt auf Anfrage von CORRECTIV mit, „der Respekt vor der Menschenwürde und der Gleichheit“ seien Stützpfeiler des Hauses, und: „Das Parlament zeigt null Toleranz für Belästigung und andere Formen des unangebrachten Verhaltens.“
Dies spiegele sich in der Geschäftsordnung und im Verhaltenskodex des Hauses wider, den alle Abgeordneten unterzeichnen müssten, schreibt die Sprecherin weiter, auch habe das Parlament 2023 seine Prozeduren verbessert, um Belästigung besser unterbinden zu können: Zum Beispiel sei ein Mediations-Dienst eingerichtet worden, der Abgeordneten und ihren Beschäftigten helfen soll, „schwierige Arbeitsbeziehungen zu lösen.“
Es rumort auch bei den Grünen
Aber es rumort derzeit in vielen Fraktionen. Den Grünen wachsen die internen Fälle aktuell über den Kopf, das geht aus Aussagen interner Quellen hervor. Nach Recherchen von CORRECTIV und Stern gibt es in der Fraktion mindestens fünf Beschwerdeverfahren. Seit der Stern im März den Fall Malte Gallée aufgedeckt hat, ist die Partei in Aufruhr: Etwa ein Dutzend Mitarbeiterinnen und Praktikantinnen werfen dem ehemaligen grünen Abgeordneten und Hoffnungsträger vor sie sexuell belästigt zu haben. Gallée wiegelte ab: In seiner Welt sei das nicht passiert, sagte er dem Stern. Danach trat er zurück.
Auch die grüne Spitzenkandidatin Terry Reintke ist unter Beschuss geraten: Sie soll Hinweise monatelang ignoriert haben. Reintke, ausgerechnet, die 2017 den Hashtag #MeTooEU prägte, eine der ersten Frauen im EU-Parlament war, die offen über eigene Erfahrungen sprach und in einem Interview im Deutschlandfunk in Bezug auf Belästigung sagte: „Diese Kultur des Schweigens muss aufgebrochen werden.“
Nun aber schien sie selbst auf der falschen Seite zu stehen. Viele Betroffene fühlten sich im Stich gelassen. Für Reintke ist all das ein heikles Thema. Gerade jetzt, im EU-Wahlkampf, kann sie das nicht gebrauchen.
Ein heikles Problem bei der „Nur ja heißt ja“-Partei
Eine Anfrage nach einem Interview dazu lehnt Reintke über eine Pressesprecherin ab: Ein Gespräch ließe sich „terminlich nicht einrichten“, sie sei „vollständig in den Wahlkampf“ und die „Vorbereitungen der Verhandlungen über die kommende Legislatur eingebunden.”
Einerseits wirft das ein fragwürdiges Licht auf die Partei, die sich als Vorkämpferin für Frauenrechte sieht und mit Slogans wie „Nur ja heißt ja” Politik macht. Auf der anderen Seite bemüht sich die Fraktion spätestens jetzt offenbar, Verstöße und Beschwerden gründlich aufzuarbeiten. Das Problembewusstsein ist besser ausgeprägt als bei anderen Parteien; auch deshalb kommt nun vieles ans Licht.
Die Grünen teilen auf Anfrage von CORRECTIV und Stern dazu mit, es sei ihr „gemeinsames Ziel, dass die Fraktion ein sicherer und vertrauensvoller Arbeitsplatz“ sei. Hinweise auf Belästigung und „unangemessenes Verhalten“ nehme man sehr ernst. Zu den internen Verfahren will die Fraktion keine Auskunft geben: Aus Gründen von „Vertraulichkeit und zum Schutz potenzieller Betroffener“ könne man dazu nichts sagen.
Eine neue „Task Force“ und „externe Evaluierung“ sollen Abhilfe schaffen
Die Grünen sind die einzige Fraktion, in der es überhaupt eigene Verfahren gibt. Seit diesem Frühjahr habe man „zusätzliche Maßnahmen“ beschlossen, teilt die Pressestelle der Fraktion mit, etwa eine „Task Force“ und eine „externe Evaluierung“ der internen Prozesse.
Das Problem ist lange bekannt: 2017, im Zuge der MeToo-Bewegung, meldeten sich auch im EU-Parlament Frauen zu Wort; die Medien berichteten über Mitarbeiterinnen und Praktikantinnen, die begrapscht, bedrängt, gedemütigt wurden. Kurz machte das Thema Schlagzeilen und geriet wieder in den Hintergrund. Getan hat sich seither wenig.
Oft scheinen in Straßburg und Brüssel besondere Regeln zu gelten. Party und Politik gehen ineinander über, der Alkohol fließt, und mitunter geht es zu wie auf einem Schulausflug für 50-Jährige. Dass gefeiert wird, ist nicht das Problem. Wohl aber, wenn gewählte und mit Steuergeld finanzierte Abgeordnete sich verhalten, als gelten für sie keine Grenzen.
Als während der Plenarwoche in Straßburg Ende April ein Foto von einem Kondom auf dem Fußboden der Kantine im Parlament auf X kursiert, twittert eine Kommissions-Mitarbeiterin: „What happens in the EP, stays in the EP.“ Das bedeutet: Was im EU-Parlament geschieht, das bleibt unter uns.
Ein Tagebuch voller Geschichten von Belästigung
Aber so ganz stimmt das nicht mehr; inzwischen können sich übergriffige Machtmenschen weniger auf das Stillschweigen der Betroffenen verlassen, es gibt erste Veränderungen, zarte Blüten, und das ist das Verdienst einer früheren Mitarbeiterin namens Jeanne Ponté.
Ponté ist seit 2017 dabei und kann als berühmteste Kämpferin gegen sexuelle Gewalt und Belästigung in Brüssel gesehen werden. Sie war es, die mit einigen Mitstreiterinnen die selbst organisierte Gruppe MeToo EP einst ins Leben rief. Sie führte damals ein Tagebuch über anzügliche und sexistische Bemerkungen und Übergriffe im EU-Parlament, das überall in Europa Schlagzeilen machte – gegenüber CORRECTIV und Stern legt sie nun erstmals offen, dass ausgerechnet ein deutscher CDU-Abgeordneter ihren Kampf gegen sexuelle Belästigung im Parlament anstieß.
2014, mit gerade einmal 24 Jahren, kam sie als Assistentin zu einem französischen Abgeordneten, einem Gewerkschafter. Ein „wunderbarer Typ“, sagt sie, mit dem sie noch heute in Kontakt stehe – aber Ponté konnte nicht fassen, wie andere Abgeordnete oder Beamte mit Praktikantinnen und Mitarbeiterinnen umgingen.
„Ganz Brüssel hat sich an Übergriffe gewöhnt”
An einem ihrer ersten Arbeitstage geht sie abends auf einen Empfang der mächtigen Energie-Industrie, direkt vor dem Parlament am Place de Luxembourg. Ein älterer Herr starrt die junge Frau an, er ist fast drei Mal so alt wie sie. Er folgt ihr, schaut sie an „wie ein Stück Fleisch“. Sie sei sehr „beschämt” gewesen, sagt sie heute. Als sie aufbrechen will, stellt sich der Christdemokrat vor ihr in den Türrahmen, umfasst ihre Taille und fragt, ob sie neu sei und seine Bekanntschaft machen wolle.
Er versperrt ihr den Weg, die junge Frau windet sich aus seinem Griff, geht nach Hause und erzählt am anderen Morgen auf der Arbeit von dem unangenehmen Vorfall. Die Reaktion, so erzählt sie heute, habe sie „noch mehr verstört“. Die Kolleginnen seien weder überrascht noch alarmiert gewesen. „Es ist, als ob sich ganz Brüssel an Übergriffe gewöhnt hat“, sagt Ponté.
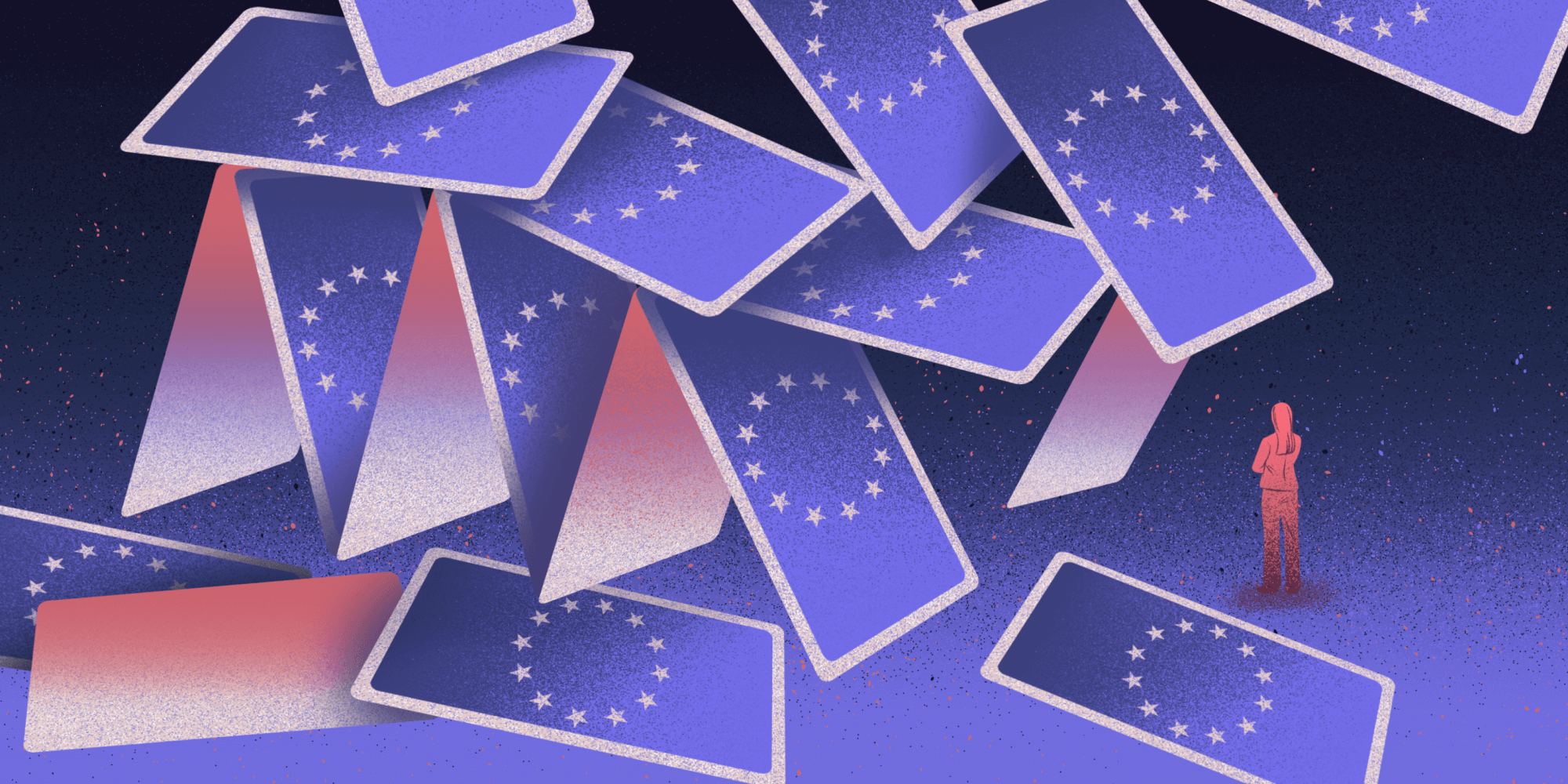
Ponté arbeitet inzwischen für die Kommission und hat ein kleines Kind. Beim Mittagessen, ein paar Haltestellen vom Brüsseler Parlament entfernt, spricht sie Klartext. Ein langjähriger Vertrauter von Angela Merkel sei es gewesen, der sie an diesem Abend so bedrängte. Der Name liegt der Redaktion vor, inzwischen ist der ehemalige CDU-Abgeordnete Rentner. Auch ein früherer Fraktionskollege erinnert sich an die anzüglichen Bemerkungen des Mannes. Unsere Anfragen hat er nicht beantwortet.
Alle haben Angst vor mächtigen Chefs
Es gab andere Vorfälle; Jeanne Ponté hat nichts vergessen, auch nicht den Mitarbeiter des Parlaments, der ihr eine E-Mail schickte mit lauter Fotos von ihr selbst, Betreff: „Im hinteren Teil des Raumes”. Der Mann hatte sie offenbar gestalkt und heimlich im Parlament fotografiert, immer und immer wieder. Auch vor ihm seien alle Frauen gewarnt worden, er fotografiere sie unter den Röcken, wenn sie Treppen steigen. „Ich will nicht, dass wir uns an solche Vorfälle gewöhnen”, sagt Ponté.
Als das Gespräch endet, verspricht sie, mit Frauen aus ihrem Tagebuch zu sprechen: Sie sollen ihre Geschichten endlich selbst öffentlich erzählen. Wochen vergehen, doch niemand meldet sich. Offenbar trauen sich die Betroffenen auch heute nicht, mächtige Chefs zu belasten.
Problematische Beamte, sagt Ponté, würden ihrer Erfahrung nach selten sanktioniert, sondern höchstens wegbefördert. Bei manchen Beamten würde darauf geachtet, dass sie nicht mehr von weiblichen Praktikantinnen umgeben wären. Sie hätten nichts zu befürchten: „Das Brüsseler Parlament ist ein Ort mit viel Macht. Wer nicht damit umgehen kann, wird schnell zu einem kleinen, autoritären König.”
„Wegen ihrer Beschwerde abgestraft”
Es geht aber nicht nur um Machtmissbrauch, sondern auch um das Gebot der Gleichheit. Wenn sich junge Frauen im Europaparlament nicht sicher fühlen, rührt das an die Grundfesten europäischer Demokratien.
Oft enden die Verfahren wegen Belästigung damit, dass die Opfer den Rückzug antreten, sagt auch die Brüsseler Anwältin Nathalie de Montigny, die mehrere Betroffene vertritt: „Ich würde eher vorschlagen, dass Opfer von Belästigung die Institutionen verlassen, um sich zu schützen, statt dass sie sich langwierigen Verfahren stellen.“ Die Betroffenen hätten nicht nur Täter gegen sich, die ihr Fehlverhalten leugnen, sondern auch die Verwaltung, die sich oft scheue, zumindest Schwächen im Personalmanagement einzugestehen. „Und sie gehen das Risiko ein, dass sie wegen ihrer Beschwerde abgestraft werden, ohne dass sie Unterstützung erhalten.”
Fragt man beim EU-Parlament nach, scheint es keinerlei Probleme zu geben. Auf Fragen zu konkreten Vorfällen geht die Sprecherin nicht ein, stattdessen schreibt sie von Ausschüssen, die Beschwerden von Belästigung aufarbeiten, von Anti-Belästigungs-Workshops für Abgeordnete und von einem „Netzwerk aus geschulten Vertrauensleuten“.
Viele Mitarbeiterinnen aber trauen sich nicht, zu den offiziellen Stellen hinzugehen – oder sie wissen nichts von ihnen. Stattdessen organisieren sich einige selbst in Netzwerken.
Eine neue Generation ist nachgerückt und nicht mehr bereit, Sexismus und Übergriffe hinzunehmen, auch das zeigt die Geschichte von Sophie Lehnert, der Ex-Praktikantin, die sexuelle Nötigung meldete.
Networking und der Traum von einer Karriere in Brüssel
Sophie Lehnert läuft nun wieder durch Brüssel, ihr Praktikum ist längst vorbei, aber an diesem Tag ist sie zurückgereist: Ein neues Netzwerk hat sich formiert, um Betroffenen eine Anlaufstelle zu bieten. Harassment Support Network nennt sich die Gruppe; später stellt sich die Initiative vor, deshalb ist Lehnert hier, sie will, dass sich etwas ändert.
Kurz vor dem Auftakttreffen hat sie sich in einem Bistro niedergelassen und denkt zurück. Eigentlich, sagt sie, war dieser Abend für sie ein Höhepunkt, ihre Träume schienen ihr plötzlich zum Greifen nah: dazugehören, Teil der politischen Blase in Brüssel sein, vielleicht eine Chance auf einen späteren Job. „Ich habe mein Bestes gegeben zu networken“, sagt sie, „mir wurde auch geraten, verschiedene Kollegen kennen zu lernen.“
Den Mitarbeiter, der sie drangsaliert haben soll, kannte sie flüchtig. Sie hatten sich ein paar Mal kurz gesprochen, auf dem Weg zu Fraktionssitzungen oder bei Meetings. Deshalb dachte sie sich zunächst nichts dabei, als am Ende des Abends nur noch sie beide übrig waren. Wo das war, und wie es dazu kam, kann nicht veröffentlicht werden. Nur so viel: „Er hat mich ununterbrochen angefasst, am Oberschenkel, dann hoch zum Hintern und versucht, mir unter das T-Shirt zu gehen”, sagt sie. „Ich war gelähmt und wie in einer Schockstarre.“
Eine schriftliche Aussage der jungen Frau liegt CORRECTIV und Stern vor; Hinweise zu ihrem internen Verfahren ebenso. Zeugen gibt es nicht. Aber eine Freundin bestätigt, dass Lehnert die Vorgänge genau so in einem Gruppenanruf am folgenden Morgen ihren Freundinnen geschildert hat: „Sie hat gesagt, sie wusste gar nicht, wie sie das einordnen sollte“, bestätigt die Freundin: „Sie hat uns gefragt: War das denn schlimm?“
Das ist bei Vorwürfen sexueller Übergriffe oft das Problem: Handfeste Beweise fehlen meist. Prüfen lässt sich nur, ob die Schilderungen schlüssig sind, ob es Widersprüche gibt, und ob mutmaßlich Betroffene die Ereignisse von Anfang an so dargestellt haben.
Nur ein paar Stunden nach dem Übergriff war Lehnert wieder auf dem Weg ins Parlament; in der Cafeteria lief sie dem mutmaßlichen Täter über den Weg. „Er hat so getan, als sei gar nichts passiert.“
Angst, als Nestbeschmutzerin angesehen zu werden
In den folgenden Tagen hing ihr diese Nacht nach, manchmal brach sie zu Hause in Tränen aus. Sie sprach mit einer Vertrauensperson, die sie zu einer Frau in der Personalstelle schickte. Die Reaktionen, sagt sie, waren zögerlich und vage, und es kam ihr vor, als werde der Fehler nicht nur bei dem Kollegen gesucht, sondern auch bei ihr.
Mitfühlend waren ihre Ansprechpartnerinnen schon, sagt sie. Aber einen klaren Kurs gab ihr niemand vor, und niemand wies sie darauf hin, dass sie nach dem Vorfall auch Strafanzeige stellen könnte. „Was ist, wenn ich später einmal im Parlament arbeiten möchte? Ich hatte Angst, als Nestbeschmutzerin angesehen zu werden“, sagt sie. Die Frau in der Verwaltung nahm ihr die Ängste nicht, stattdessen antwortete sie mit einem Satz, der sie bestürzte: Ja, das tue ihr leid, aber so sei das in unserer Gesellschaft eben immer noch.
Da meldet also eine Praktikantin einen sexuellen Übergriff, angeblich begangen vom Mitarbeiter eines beliebten Abgeordneten. Und niemanden schien das zu alarmieren.
Eine der ehrenamtlichen Beraterinnen vom Harassment Support Network gab ihr erstmals ein konkretes Wort für das, was ihr aufgezwungen worden sein soll: ein gewaltsamer Übergriff. Vor kurzem hat die Studentin einen neuen Anlauf gestartet: Sie hat offiziell Beschwerde eingereicht und eine Zeugenaussage verfasst. Nun wartet sie auf Antwort.
Betroffene fühlen sich verpflichtet zu schweigen
Lehnert will Gerechtigkeit. Und sie ist froh, dass ihr Fall nun aufgearbeitet wird. Aber das interne Verfahren hat einen Preis: ihr Schweigen. Deswegen darf sie nicht identifizierbar sein: Sie glaubt, es könne die Aufklärung gefährden, wenn sie sich öffentlich äußert.
Der beschuldigte Mitarbeiter und der Abgeordnete, in dessen Büro er arbeitet, schreiben auf Anfrage von CORRECTIV und Stern, ihnen seien keine Vorwürfe von Belästigung bekannt.
Die Zahl der Fälle zeigt: Offenbar waren die Verantwortlichen in Parlament und der Kommission in Brüssel, die Aushängeschilder europäischer Politik, über viele Jahre ahnungslos und blind dafür, wie Mitarbeiter und Kolleginnen zu behandeln sind.
Die Abgeordneten werden praktisch von einem Tag auf den anderen Arbeitgeber: Führungsfähigkeiten, Empathies, Teamgeist – das bringt nicht jeder von Natur aus mit. Zwar können sie hausintern schon lange Grundwissen in puncto Mobbing und Belästigung erlangen – bis vor kurzem aber war dies freiwillig. In den Fortbildungen sind dann etwa schmucklose Folien mit folgenden Informationen zu sehen: Unangemessen sei es zu schreien und zu drohen, die Person zu ignorieren oder sie mit unerfüllbaren Aufgaben zu überhäufen, steht dann dort auf den Folien. Passiert dies häufiger, handelt es sich um Mobbing. Wer körperlich belästigt, antatscht, Gegenstände wirft, begeht eine Straftat.
Auch in Kommission und EU-Institutionen häufen sich die Fälle
Es ist nicht nur das Parlament, wo Probleme grassieren. CORRECTIV und Stern haben auch mit Beschäftigten anderer EU-Institutionen gesprochen: Immer wieder fallen die gleichen Sätze: Die hochrangigen Belästiger und Vergewaltiger werden systematisch geschützt, sagt etwa eine Insiderin der Kommission, mit mehr als 30.000 Beamten ein noch größerer Apparat als das Parlament.
Die Kommission wird als die europäische Regierung bezeichnet, sie soll die Einhaltung der europäischen Gesetze überwachen. Regeln zum Schutz ihrer eigenen Angestellten aber bleiben offenbar weitestgehend missachtet.
CORRECTIV und Stern haben die jährlichen Berichte der Disziplinarstelle IDOC analysiert – an sie soll sich jede Person wenden können, die korrupte, gewalttätige, übergriffige Mitarbeiter in der Kommission oder den beigeordneten Verwaltungen erlebt oder beobachtet. Bei der IDOC werden jedes Jahr einige wenige Fälle von sexueller Belästigung und Mobbing gemeldet – sanktioniert werden die Täter nahezu nie. Und wenn, dann trifft es fast ausschließlich Beschäftigte in den unteren Hierarchiestufen, etwa mit Zeitverträgen.
Links, die plötzlich aus dem Intranet verschwinden
Beispielhaft ist der Jahresbericht 2021: 24 Verdachtsfälle sexueller und psychischer Gewalt wurden gemeldet, nur in einem Fall wurde der Täter gerügt – und dieser war bereits aus der Kommission ausgeschieden. Die hochrangigen Belästiger und Vergewaltiger würden systematisch geschützt, sagt die hochrangige Beamtin.
Einmal wagte sich eine Kollegin vor. Als 2019 Vergewaltigungsvorwürfe gegen einen führenden Kommissionsbeamten publik wurden, postete sie im Intranet Medienberichte über den Gerichtsprozess: Margus Rahuoja, estnischer Direktor in der Generaldirektion Mobilität und Verkehr, vergewaltigte auf einer Betriebsfeier anlässlich der Geburt seiner Tochter eine 26-jährige Französin, deren Chef er war. Aber plötzlich verschwanden die Links wieder aus dem Intranet.
Rahuoja bestritt die Vorwürfe. Das rechtskräftige Urteil kam 2022. Die Tat soll er bereits 2015 begangen haben. Über die sieben Jahre hinweg habe Rahuoja weiter sein Gehalt bezogen, laut der französischen Tageszeitung Libération rund 15 000 Euro monatlich – eine Summe von 1,5 Millionen Euro, die er voraussichtlich nicht zurück zahlen muss. Der Fall tauchte in den damaligen Berichten der IDOC nicht einmal auf.
Die EU-Kommission bestreitet, sexuelle Belästigung nicht ausreichend zu ahnden und Opfern zu wenig zu helfen. Die Zahl der gemeldeten Fälle sei nach wie vor sehr gering – das beweise aber, „dass die Kommission ein sicheres und respektvolles Arbeitsumfeld bietet”, schreibt sie auf Anfrage. Im Übrigen gebe es seit 2023 neue Verfahren und Anlaufstellen, die das Opfer in den Mittelpunkt rückten.
Ein Gewerkschafter spricht von Kündigungsdrohungen
Auch in anderen EU-Institutionen helfen die Strukturen in einigen Fällen offenbar häufiger nicht, wenn es um Mobbing und Belästigung geht. Carlos Bowles ist Vize-Präsident der Gewerkschaft IPSO, die vor allem Beschäftigte der Europäischen Zentralbank vertritt, er spricht von einer „Konzentration und Konfusion der Macht”, das heißt: Die Macht ist gebündelt, und zugleich ist bei Problemen oft unklar, wer zuständig ist. „Das ist der Hintergrund in allen internationalen Organisationen: Das nationale Arbeitsrecht gilt nicht für uns – auch nicht die deutschen Gesetze, obwohl wir in Frankfurt sitzen“, sagt er. Das Ergebnis: Der Arbeitgeber entscheidet, welche Rechte die Beschäftigten haben.
Bowles ist ein streitbarer Arbeitnehmervertreter. CORRECTIV und Stern haben knapp zehn Vertreter von Gewerkschaften für EU-Beschäftigte angeschrieben; fast keiner meldete sich zurück. Bowles geht ein Risiko ein. Mehrfach, sagt er, hätten ihn Manager der EZB bedroht, weil er mit Journalisten sprach. „Es wird gesagt: Lasst uns Probleme intern regeln. Sonst verlieren die Leute das Vertrauen in die EZB, und dann wählen sie nachher die Rechten.”
Eine Sprecherin der EZB teilt dazu mit, es sei kein Fall „einer angeblichen Kündigungsdrohung gegenüber einem Personalvertreter“ bekannt.
Recht oft wendeten sich Betroffene an die Gewerkschaft. Bowles sagt, er hört vor allem von Mobbing und psychische Misshandlungen. In einigen Fällen gehe es auch um unerwünschte Berührungen, sexuellen Anspielungen und obszöne Witze. Viele Beschäftigte meldeten sich nicht bei den offiziellen Stellen; aus Angst, vor noch mehr Schikane, Karriere-Nachteilen, erniedrigende Gerüchte, der Verlust des Jobs – dies scheint auch eine Umfrage unter allen Beschäftigten von 2023 zu bestätigen: Vier von fünf gaben an, den Verantwortlichen in der Personalverwaltung nicht zu vertrauen. „Wenn man zur Personalabteilung geht, passiert meistens nichts”, sagt Bowles. „Daher kommt das Misstrauen.“
Die EZB verweist auf ihren „Null-Toleranz-Ansatz“
Aber auch der Gewerkschafter kann in vielen Fällen wenig tun, weil Betroffene Angst hätten, Übergriffe und Mobbing zu melden. Bowles klingt wütend, er sagt: „Wir sind eingeschlossen in einem Elfenbeinturm, wo sich die Leute nicht trauen, offen zu sprechen.”
Auf Anfrage von CORRECTIV teilt eine Sprecherin der EZB mit: „Unangemessenes Verhalten jeglicher Art ist inakzeptabel und verstößt gegen unsere Werte in der EZB.“ Die EZB verfolge hierbei einen „Null-Toleranz-Ansatz“, allen Fällen werde nachgegangen. Niemand müsse negative Konsequenzen erleiden, wenn er oder sie Dinge offen anspreche: „Es kann schwierig sein, offen zu sprechen, daher bieten wir unseren Mitarbeitenden verschiedene Möglichkeiten, dies zu tun, einschließlich eines anonymen Whistleblowing-Tools.“
Auf der einen Seite gibt es in den meisten Institutionen durchaus Ansprechpartner und Meldesysteme. Auf der anderen Seite versagen die Strukturen regelmäßig, das bestätigt auch die Anwältin Nathalie de Montigny: Sehr oft, sagt sie, bleiben die Verantwortlichen trotz deutlicher Hinweise untätig. „In politischen Institutionen trauen sich die Vorgesetzten meist nicht, einzugreifen, um Konflikte zu vermeiden, oder sie antworten: Sie können nicht auf Grundlage von Gerüchten handeln.“ Die einzige Möglichkeit bestehe darin, dass die Opfer selbst offiziell Beschwerde einlegen, „aber für einige kann das das Ende ihrer Karriere bedeuten, weil ihr Vertrag an die Person gebunden ist, die sie belästigt.“
„Das müsst ihr nicht an die große Glocke hängen“
Betroffenen steht vieles entgegen: Das Machtgefälle, die Trägheit des Systems. Hinzu kommt der Druck zur Geschlossenheit. In einem Chat von Mitgliedern der Grünen kursieren nach der Gallée-Recherche im Stern aufgebrachte Nachrichten, Empörung und Wut, und immer wieder auch auch Zweifel und die alten Reflexe, so schildern es Insider: Ob vielleicht der Stern von politischen Rivalen benutzt worden sei, um das Ansehen der Partei zu beschädigen?
Nach wie vor gelten Schweigegebote, sagt eine Assistentin aus einer anderen Fraktion: „Uns wird schon am ersten Arbeitstag gesagt, dass wir das Ansehen des Parlaments schützen müssen. Das haben viele von uns immer im Kopf.“ Einmal habe ein Abgeordneter in Bezug auf Belästigungsvorwürfe gesagt: Das müsse man nicht an die große Glocke hängen, so etwas schade dem Haus.
Andererseits: Gerade in Brüssel gehen ständig Gerüchte um; nicht alle Hinweise, die CORRECTIV und Stern erhielten, ließen sich erhärten. Tatsächlich kommt es vor, dass Vorwürfe als politische Waffe benutzt werden. Als der Skandal um Gallée eskalierte, schreiben 14 Abgeordnete aus der CDU/CSU-Gruppe einen Brief an die Spitze der Grünen-Fraktion: „Diese Vorwürfe müssen transparent aufgearbeitet werden“, heißt es darin, „damit nicht der Eindruck entsteht, dass solches Verhalten vertuscht oder gar toleriert wird.“
Bizarr daran: Auch die CDU-Abgeordnete Karolin Braunsberger-Reinhold unterzeichnete. Erst ein Jahr zuvor stand sie selbst im Zentrum einer Belästigungs-Affäre. Dazu später mehr.
Welcher Abgeordnete schikaniert, ist ein offenes Geheimnis
Einige prominente Parlamentarier können, so scheint es, unbehelligt und seit vielen Jahren ihre Beschäftigten schikanieren. Da ist zum Beispiel Elmar Brok, CDU-Urgestein und fast 40 Jahre lang Mitglied des Europaparlaments. Offiziell ist er in Rente, aber er hält sich nach wie vor oft dort auf. Lange Zeit bestimmte er über Voten der konservativen Fraktion und damit über Brüsseler Gesetze. Inzwischen arbeitet er für eine PR-Agentur, die für den Rüstungskonzern Rheinmetall und McDonalds aktiv ist. Ein mächtiger Mann.
Bei Brok geht es nicht um sexuelle Belästigung. Er soll die Beschäftigten in seinem Büro angebrüllt und mit Gegenständen beworfen haben, mit einem Schlüsselbund oder einer Mappe. Das sagen mehrere Zeuginnen: Brok habe so getobt, dass sie es mit der Angst zu tun bekamen, nur vom Zuhören einige Büros entfernt. CORRECTIV und Stern liegt ein Beweis vor, aus dem hervorgeht, dass Brok minutenlang auf einen Beschäftigten einbrüllte.
Selbst Staatschefinnen habe er herablassend behandelt, erzählt eine hochrangige EU-Vertreterin. Eine Beschäftigte im Parlament sagt, sie habe sich einmal nicht anders zu helfen gewusst, als den Sicherheitsdienst zu rufen. Jeder habe gewusst, wie Brok seine Leute terrorisiert, aber seine Fraktion habe tatenlos zugesehen. Auch in der Presse war das bislang kein Thema. „Ich habe damals mehrere Journalisten darauf hingewiesen”, sagt eine der Zeuginnen, „Aber alle haben geantwortet: Das ist keine Geschichte: Das weiß jeder.“
Auf Anfrage von CORRECTIV antwortet Brok nicht eindeutig. Er schreibt nur, es gebe über ihn in Brüssel „viele nette und manche weniger nette Geschichten, die gut erfunden oder einfach falsch sind oder nicht so stimmen“. Was genau an den Vorwürfen nicht stimmen könnte, benennt er nicht. Lieber verweist er auf sein Bielefelder Büro, in dem seit über vierzig Jahren dieselben zwei Mitarbeiterinnen tätig seien – er habe also „wohl nicht alles falsch gemacht“.
Da ist auch ein ebenso oft genannter Fall eines weiteren CDU-Abgeordneten, der sein Mandat noch ausübt, ebenfalls ein einflussreicher Mann. Mehrere hochrangige Politikerinnen und Mitarbeiter sagen, er verhalte sich vielen Frauen gegenüber unangemessen: Er taxiere sie im Aufzug, zwinkere, lächle anzüglich; mehrere Beschäftigte sagen, sie empfinden das als unangenehm. Das Beispiel zeigt, wie fließend die Grenzen sind: In anderem Kontext könnte das als plumpe Anmache durchgehen. Aber mit der Abhängigkeit und dem Machtgefälle am Arbeitsplatz, wird der penetrante Flirtmodus zum Problem. Ein Parteikollege sagt: Es hat schon Beschwerden gegen diesen Mann gegeben. Geändert hat das aber nichts.
Satiriker Sonneborn: Die Brüsseler Presse funktioniert nicht
Zurück zu Elmar Brok: Auch Martin Sonneborn, Satiriker und fraktionsloses Mitglied im Europaparlament, bekam zu spüren, dass man sich mit dem Christdemokraten nicht anlegen sollte. Zuvor war der Politiker auf einer Podiumsbühne eingeschlafen, Sonneborn hatte ein Foto der Szene im Internet verbreitet. Danach ging Brok ihn an, es gibt sogar eine Aufnahme davon: Zu sehen ist Brok, wie er sich drohend und nah vor Sonneborn aufbaut und mit dem Zeigefinger fuchtelt.
Sonneborn benennt in seinen Büchern und Auftritten offen Machtmissbrauch und Interessenkonflikte im Parlament. Er bestätigt: „Der Eindruck ist richtig, dass man sich in Brüssel nicht mit Problemen auseinandersetzen will, sondern sie unter den Teppich kehrt.”
Eine aktuelle Recherche der investigativen Plattform Follow the Money ergab: Einer von vier EU-Abgeordneten hat bereits einen Verstoß oder eine Straftat begangen. In absoluten Zahlen: Von 704 Mitgliedern des Parlaments waren 163 Personen in Korruption, Betrug und Veruntreuung, oder Mobbing und sexuelle Übergriffe verwickelt.
Eine Maschine aus Hierarchien und Loyalitäten
Laut Sonneborn hinterfragten auch die Medien Fehlentwicklungen oft nicht, er spricht von Pressekonferenzen, auf denen Journalisten von Kollegen ausgebuht wurden, weil sie kritische Fragen stellten. „Die vierte Gewalt funktioniert nicht mehr“, sagt er.
Einige Journalisten fühlen sich abhängig von Politikern; bei manchen geht die Sorge um, in Folge missliebiger Berichterstattung nicht mehr an Informationen zu kommen, von Hintergrundrunden ausgeladen zu werden. Das beobachten sogar die Politiker selbst, nicht nur Sonneborn. Auch Vizepräsidentin Barley wünscht sich vor allem mehr kritische Berichterstattung: Das Europäische Parlament müsse mehr in den Fokus der nationalen Berichterstattung rücken. Die öffentliche Aufmerksamkeit sei die „effektivste Kontrolle“.
Hinter jedem Abgeordneten steht eine riesige Maschine aus Parteien, Hierarchieebenen, Loyalitäten, viele davon sind unsichtbar. Ein Beispiel ist der Fall eines hochrangigen deutschen Verwaltungsmitarbeiters im Parlament, gegen den gravierende Vorwürfe im Raum stehen: Er soll Frauen belästigt und Beförderungen gegen sexuelle Gefälligkeiten in Aussicht gestellt haben. Eine, die das selbst erlebt haben soll, sagte ein Treffen erst zu und schließlich aus Angst wieder ab. Öffentlich spricht niemand darüber. Aber der Verdacht soll so konkret gewesen sein, dass seine Partei ihn zwar beförderte, aber nicht auf einen ganz so hohen Posten wie geplant. Nach wie vor gehört er zu den mächtigsten Männern in der EU.
„Bumsberger” nennen sie eine zudringliche CDU-Abgeordnete
Namentlich bekannt ist dagegen Karolin Braunsberger-Reinhold, eine CDU-Abgeordnete aus Sachsen-Anhalt, die bei einem Ausflug über die „Weinmeile“ in ihrem Wahlkreis gleich zwei Untergebene massiv sexuell belästigt haben soll – eine Frau und einen Mann: Sie sei so betrunken gewesen, dass sie kaum noch gehen konnte und dann zudringlich geworden. Ihren Assistenten soll sie gesagt haben, sie sei bisexuell und wolle „flachgelegt werden.“ Später auf dem Rückweg soll sie ihrer Mitarbeiterin außerdem an die Brust gefasst haben.
Aber das wäre nie an die Öffentlichkeit gekommen, wenn nicht jemand die Vorfälle an die Bild-Zeitung durchgestochen hätte.
Dabei reichten die Betroffenen offiziell Beschwerde ein. Zuständig ist für solche Fälle im EU-Parlament ein Gremium mit kompliziertem Namen, der Beratungs-Ausschuss für Belästigungs-Beschwerden. Dieses ermittelte und kam zu einem erstaunlichen Fazit: Die Vorwürfe bestätigten die Mitglieder zwar. Dennoch wurde die Politikerin nicht bestraft. Der Ausschuss habe die „Schwere der Vorfälle“ gegen die „Schwere der Konsequenzen“ für das Leben der Politikerin abgewogen, wenn die „sexuellen Belästigungen öffentlich“ würden.
Wenn Abgeordnete bestraft werden, wird das im Plenum verkündet. Das war in diesem Fall wohl nicht erwünscht.
Braunsberger-Reinhold selbst reagierte nicht auf eine Anfrage von CORRECTIV und Stern.
Generell gilt: Sanktionen gibt es nur, wenn sich in dem Komitee alle einig sind, sagen Insider. Und immer hat die Parlamentspräsidentin das letzte Wort: Roberta Metsola kann also Sanktionen trotz allem ablehnen. Im Fall Braunsberger-Reinhild hatte auch das Komitee nicht für Strafen plädiert, Metsola schloss sich dem an. Jemand, der Einblick in das Verfahren hatte, erklärt sich die Entscheidung mit Parteienloyalität – beide Politikerinnen gehören derselben Fraktion an, der konservativen Europäischen Volkspartei.
Metsolas Sprecher antwortet auf Fragen dazu nicht: Einzelne Fälle würden nicht kommentiert, teilt er mit.
Bei Parlamentskollegen indes sorgte die Sache indes für Heiterkeit: „Bumsberger“ werde die Abgeordnete seither in Brüssel genannt – so als wäre das alles nur ein großer Witz.
Es gibt Fälle in fast allen Fraktionen und Nationen
Es gibt weitere Fälle von Abgeordneten, gegen die Vorwürfe erhoben wurden – aus vielen Nationen und in praktisch allen Fraktionen: Die Dänin Karen Melchior von Renew soll dafür bekannt sein, Beschäftigte zu tyrannisieren; das ist in der dänischen Presse ein Thema, in ihrer Fraktion offenbar weniger.
Hinzu kommen Fälle, die gleich bei den Justizbehörden landen: Da ist der weit rechte Abgeordnete Peter Lundgren aus Schweden, der in seiner Heimat verurteilt wurde, weil er einer Parteikollegin im schwedischen Parlament mit beiden Händen unter den Pullover gefasst hat. Im April wurde der estnische Rechtspopulist Jaak Madison von einer Praktikantin wegen sexueller Belästigung angezeigt; Madison streitet das ab, bezeichnete die Betroffene als „schizophren“ und spricht von einer „Verleumdungskampagne“. Und der griechische Linke Alexis Gergoulis muss sich wegen Vergewaltigung einer Mitarbeiterin der EU-Kommission verantworten; das Parlament hat seine Immunität aufgehoben.
Es ist Ende April, die letzte Plenarwoche in Straßburg läuft. Wer sich länger in dem gläsernen Palast aufhält, hat den Eindruck, in eine geschlossene Gesellschaft vorzustoßen; beim Presse-Apéro mit dem Flensburger Grünen Rasmus Andresen etwa gibt es Crémant, Häppchen und Hintergrund-Informationen zu Fragen von Journalisten, aber offenbar nur auf solche, die Andresen ins Konzept passen. Als das Rechercheteam von CORRECTIV und Stern nach dem Stand des Gallée-Verfahrens fragt, schlägt die Stimmung um; Andresen verschränkt die Finger und macht ein kühles Gesicht.
Am Nachmittag kursieren in sozialen Medien Herrenwitze
Dazu könne er gar nichts sagen, es gehe ja um ein internes Verfahren, und außerdem, sagt er spitz, sei erstmal zu klären, ob die Berichte im Stern auch stimmten. Zu der Aufarbeitung will der Abgeordnete selbst nach mehrfachen Nachfragen nichts sagen. Andresen, 38 Jahre alt und Sprecher der deutschen Grünen in der EU, klingt genervt, die Korrespondenten ringsum gucken auf den Boden.
Seit November gibt es bei den Grünen ein internes Verfahren zur Prüfung von Belästigungsfällen. Außerdem ließ die Fraktion den internen Umgang mit Vorwürfen von externen Beratungsfirmen auswerten. Das Fazit wurde zwar in Straßburg vorgestellt. Der gesamte Bericht wird Parlamentariern und Beschäftigten aber bisher vorenthalten.
Ringsum erstrecken sich die Korridore des Parlaments, ein Labyrinth über 17 Etagen, es geht treppauf und treppab, über Galerien, Plattformen und immer neue Abzweigungen. An einem Donnerstagabend Anfang Mai verkündet der grüne Belgier, der Co-Vorsitzende der Fraktion, Phillippe Lamberts, seinen Abschied, er lädt alle noch zu einer Party im Parlament ein, das ist wieder ein Anlass für Herrenwitze, ein Journalist schreibt auf X: „Stellt euch darauf ein, dass in 2025 mehrere Kinder geboren werden, die nach ihm benannt sind.”
„Das alles nimmst du mit in deinen nächsten Job”
Als der Tweet die Runde macht, sitzt in einem Café eine junge Frau und geht im Kopf die Fälle durch, die bei ihr angekommen sind. Solche Posts mögen witzig gemeint sein, aber Alejandra Almarcha sagt: „Für Betroffene ist das beängstigend.“
Alejandra Almarcha ist Teil des Harassment Support Networks. Wer einmal gemobbt, belästigt, schikaniert oder drangsaliert wurde, der werde seine Hilflosigkeit oft nicht wieder los, sagt sie, all die Zweifel und Fragen: Habe ich übertrieben? War das wirklich so dramatisch? „Und das alles nimmst du mit, auch in deinem nächsten Job.“
Seit das Netzwerk im März offiziell startete, haben sich bereits rund 20 Betroffene an die ehrenamtlichen Beraterinnen gewandt. Almarcha sagt: „Du brauchst Leute, die dir erklären, was du tun kannst. Diese Strukturen fehlen. Deswegen kommen die Leute zu uns.“
Auch bei den Sozialdemokraten wird an diesem Nachmittag gefeiert. Am frühen Abend stehen Mitarbeiterinnen in Grüppchen zusammen, mittendrin die Abgeordnete Gaby Bischoff, sie ist ist bestens gelaunt: Sie hat lange für das gekämpft, was die Gruppe MeToo EP schon 2018 gefordert hat: Eine verpflichtende Schulung für Abgeordnete, die für Belästigung sensibilisieren soll. Der Widerstand war groß, vor allem die Union blockierte den Vorstoß in Brüssel.
„Wir Frauen werden belächelt“, sagt eine SPD-Politikerin
Das Argument der Konservativen: Die Pflicht zur Fortbildung würde ihr freies Mandat beschränken. Zuständig für die Regularien im Parlament ist der Ausschuss für konstitutionelle Fragen (AFCO), und der ist dominiert von früheren Staatsmännern und Ministern a.D. „Wir Frauen werden belächelt”, sagt Gabriele Bischoff, manchmal komme es ihr vor, als habe sie sich in eine Männerrunde in einer Kneipe verirrt.
Der Abend bricht an, in Sälen sprechen noch Abgeordnete allein vor leeren Rängen. Ringsum sammeln sich ihre Kollegen da und dort zu Empfängen, am Tresen der „Bar des Cygnes” im Erdgeschoss haben sich dichte Trauben gebildet, in dem Raucherraum nebenan sehen die Aschenbecher schon am frühen Abend aus wie in einer Kneipe kurz vor der Sperrstunde, zwischen umgekippten Flaschen liegen Asche und Kippen.
Es geht auf Mitternacht zu, die meisten Büros und Sitzungssäle sind nun dunkel. In Lokalen der Altstadt aber brennt helles Licht. Abgeordnete, Mitarbeiter, Beamte ziehen durch die gepflasterten Gassen in Richtung der Bar Les Aviateurs. Drinnen ist es laut und stickig; Männer und Frauen in Anzügen schieben sich vor der Bar aneinander vorbei; fast jeder hier arbeitet für die EU, manchen hängt der Abgeordnetenausweis noch um den Hals. An einer Empore tanzt ein Grüppchen AfD-Mitarbeiter, weiter hinten plaudert ein Mann von der CDU mit Journalisten, junge Frauen wiegen sich im Takt um einen älteren Herrn von der rechtspopulistischen Lega Nord, am Rand stehen Abgeordnete und gucken zu, aus den Boxen wummert Shakira, „Hips don’t lie.“
„Es ist wie David gegen Goliath“
Spricht man mit Betroffenen, die sich an die offiziellen Strukturen gewandt haben, an Personalverantwortliche in den Fraktionen oder den Belästigungs-Ausschuss des Parlaments, klingt Ernüchterung durch: Einer Praktikantin wird ein „klärendes Gespräch“ mit dem Beschäftigten angeboten, der sie sexuell bedrängt und begrapscht haben soll. Manche warten seit Monaten auf eine Antwort. Andere fühlen sich, als stünden sie selbst vor einem Tribunal. „Es kam mir vor, als sei ich in der Defensive“, sagt eine Betroffene.
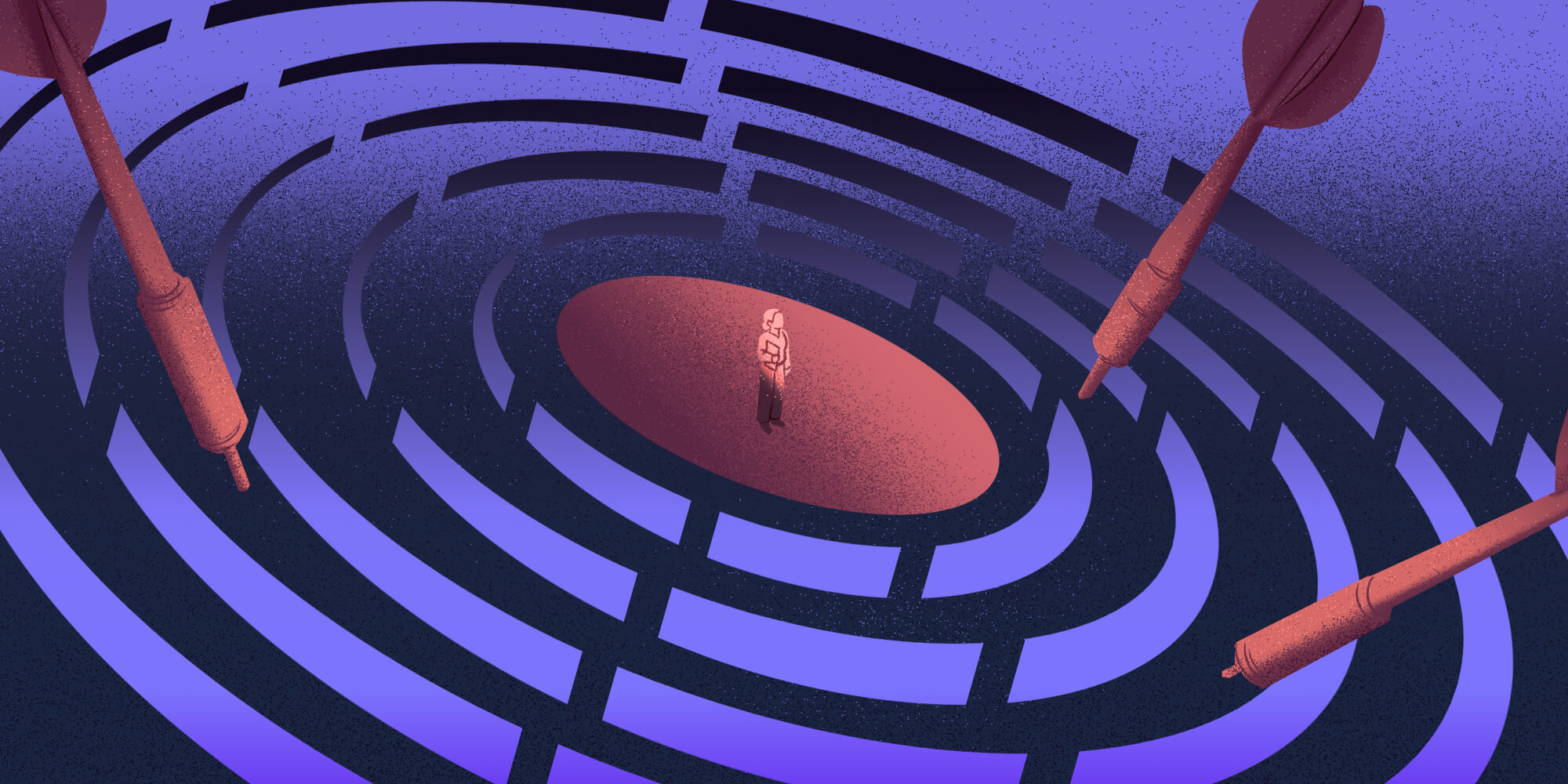
Eine andere junge Frau sagt: „Es ist alles oder nichts. Verliert man, muss man wieder zu dem Abgeordneten zurück oder wird gekündigt.“ Zurück bleibt ein Gefühl von Hilflosigkeit: „Es ist wie David gegen Goliath. Wir haben keine Chance gegen die Abgeordneten.”
Ein Berichtsentwurf des Ausschusses für die Rechte der Frauen und die Gleichstellung der Geschlechter im EU-Parlament stellte im Januar 2023 fest, „dass viele Fälle sexueller Belästigung weiterhin nicht gemeldet werden, da Opfer die vorhandenen Kanäle nicht nutzen.”
Kein Abgeordneter wurde wegen sexueller Belästigung sanktioniert
Wer eine Beschwerde beim Belästigungs-Ausschuss einreicht, muss vor dem Komitee mündlich Fragen beantworten, sie sind zahlreich und sehr detailliert, so dass man mitschreiben muss, um nichts zu vergessen. Über den Stand des Verfahrens erhalten sie oft keine Informationen. Werden Sanktionen verhängt, werden diese im Plenum verkündet.
Kein einziger Abgeordneter wurde in dieser Legislaturperiode wegen sexueller Belästigung sanktioniert, und nur drei wegen Mobbings. Auffällig ist, dass viele Frauen vor dem Komitee landen – als Beschuldigte. Zwei der drei bestraften Abgeordneten in diesem Mandat waren Frauen.
Statistiken in Deutschland zufolge sind die Täter sexueller Belästigung zu mehr als 80 Prozent männlich.
Die härtesten Sanktionen in dieser Legislatur treffen eine Schwarze Frau, wenngleich zu recht, wie es aussieht: Die Liberale Monica Semedo geriet sogar schon zwei Mal ins Visier des Ausschusses, beide Male wegen psychischer Gewalt gegen ihre Assistenten: Einmal wurde die Luxemburgerin für 15 Tage vom Parlament ausgeschlossen, ein zweites Mal wurde ihr das Tagegeld von 348 Euro für zehn Tage gesperrt.
In einem Radio-Interview stritt Semedo die Vorwürfe kürzlich pauschal ab und stellte ihre Assistenten bloß. Sie legte nahe, die Inkompetenz ihrer Assistenten sei das größte Problem gewesen und sagte: „Die haben nur Kaffee getrunken und nicht zugehört.“
Eine Assistentin sagt: „Jetzt kenne ich meinen Platz“
Fragt man beim Ombudsmann der EU nach, scheint alles in Ordnung: Die Institution ist die letzte Instanz, wenn alle anderen Wege ausgeschöpft sind und Ansprechpartner für Missstände in der Verwaltung der Institutionen. Christophe Lesauvage ist Rechtsexperte beim Ombudsmann und sagt: „Die Menschen, die bei den Institutionen der EU arbeiten, sind von den internen rechtlichen Regelungen vor Belästigung gut geschützt. Normalerweise kannst du gar nicht in eine Situation geraten, wo es eine Lücke in diesem Schutz gibt.“ Tatsächlich kommt nur eine geringe Zahl an Vorfällen zu Belästigung und Mobbing bei seiner Behörde an: Pro Jahr seien es zwischen zehn und 20 von insgesamt 2400 Beschwerden.
Dagegen stehen Aussagen von Beschäftigten, mit denen CORRECTIV und Stern sprachen: Eine Mitarbeiterin sagt, sie wurde gemobbt und geschunden; sie spricht von einer Atmosphäre der Angst. In den Augen ihrer Chefin habe sie nichts richtig machen können, bekam immer neue Anweisungen, richtete sie sich danach, war es wieder falsch. Die Politikerin habe erst ihre Kompetenz in Frage gestellt, dann sie persönlich.
Die Assistentin rieb sich auf und erhielt am Ende trotzdem die Kündigung. Sie wollte sich wehren, schaltete die Personalleitung ein, bat um Mediation, wandte sich an Vertrauensleute. „Niemand hat mir geholfen”, sagt sie. „Ich habe Punkt für Punkt aufgezählt, was passiert ist. Sie sagten: Danke. Tschüss.“ Niemand habe wirklich hingehört.
Schließlich wurde das Verfahren eingestellt. Ihr blieb nichts anderes übrig, als sich eine neue Stelle zu suchen. Nun arbeitet sie für einen konservativen, älteren Parlamentarier. „Ich weiß, dass er mich nicht als ebenbürtig ansieht”, sagt sie, das erwarte sie aber auch nicht mehr, sie arrangiere sich: „Ich kenne jetzt meinen Platz.“
Bei Hinweisen/Beobachtungen zu diesem Thema wenden Sie sich gerne an die Autorinnen:
Gabriela Keller
+49 151 58352062
gabriela.keller@correctiv.org
Annika Joeres
+33 6 30 88 36 19
annika.joeres@correctiv.org
Charlotte Wirth und Nicolas Büchse vom Magazin Stern wirken an der Recherche mit.
Der Absatz über die bereits bekannten und medial berichteten Vorwürfe wurde nachträglich aus redaktionellen Gründen gekürzt. In Bezug auf die Verurteilung wegen Vergewaltigung im Fall von Margus Rahuoja hieß es in der ursprünglichen Fassung, er habe die Tat gestanden. Dies trifft nicht zu, er bestritt die Vorwürfe. Wir haben dies korrigiert.