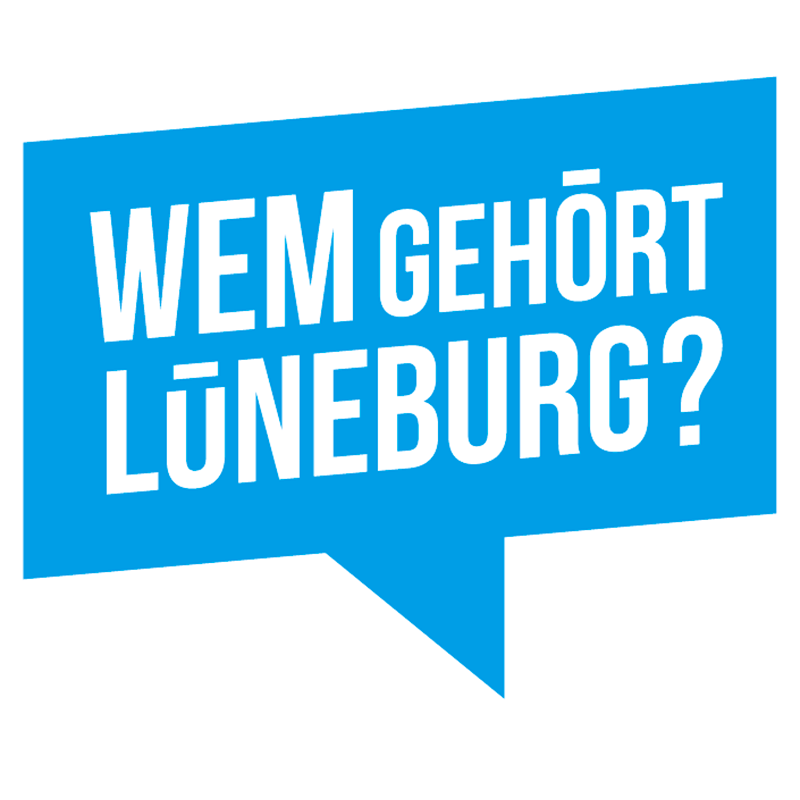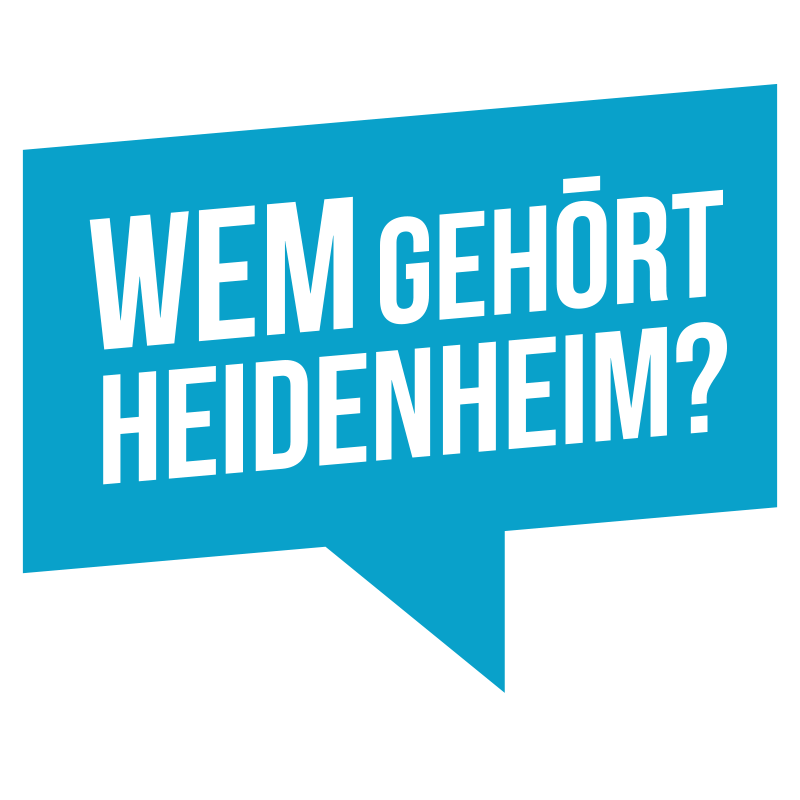Aus vielen kleinen Datenpunkten entstand nach und nach ein Bild in der Vogelperspektive. Hinweise, Gespräche und Folgerecherchen füllten dieses Datenbild mit Leben. Die zehn wichtigsten Erkenntnisse aus unserer Recherche fassen wir in einer Übersicht zusammen.
Besonders hoch war die Datendichte im Bezirk Altona-Altstadt, wo auf kleinstem Raum sämtliche Eigentümertypen vertreten sind. Deshalb sind wir den Hinweisen hier systematisch nachgegangen. Die Reportage
Die Große Bergstraße spiegelt im Kleinen etliche Phänomene des Hamburger Wohnungsmarkts.
Weiß auch die Stadt, mit wem sie es zu tun hat, wenn sie die Kontrolle über Baugrund aufgibt? Nicht immer, wie unsere Auswertung der kompletten Grundstücksverkäufe der letzten sieben Jahren ergab. In
Die verkaufte Stadt lesen Sie, wie Hamburg im Minutentakt Grundstücke verkauft – auch an Firmen in Steueroasen.
Der Senat gab uns häufiger zu verstehen, dass unsere Recherche im Grunde unnötig sei: Hamburg sei ja mieterfreundlich, auch dank der vielen Wohnungen in Hand der städtischen Wohngesellschaft Saga. Im Crowdnewsroom fanden wir mehrere Hinweise, wie die Saga bei Mieterhöhungen fast ans Limit geht. Wie der drittgrößte Vermieter Deutschlands am Boom mitverdient, lesen Sie im Text
Sagahafte Mieten.
Wer oder was treibt die Preise für Immobilien und Mieten in die Höhe? Zum Beispiel die ganz alltägliche Renditegier von Otto Normalverbraucher. Wie wir über unsere private Altersvorsorge den Immobilienmarkt anheizen, lesen Sie in Wir, die Miethaie.
Hinter geschätzt 10 Prozent der Immobilienumsätze in Deutschland steckt allerdings auch Geldwäsche. Wie die Intransparenz des Wohnungsmarkts die Verfolgung von organisierter Kriminalität erschwert, lesen Sie im Text Gewaschene Preise.
Der Versuch, die Transparenz im Immobiliensektor zu erhöhen, dürfte deshalb wenig umstritten sein – sollte man meinen. Doch das Thema Wohnen wird hoch emotional verhandelt. In dem Maße, wie Immobilienpreise und Mieten durch die Decke gehen, ist das Misstrauen zwischen Mietern und Eigentümern gewachsen.
Eigentümer stehen oft als gierige Geldjäger da, Mieter als die Verdrängten, schnell wird pauschalisiert. Sogar Initiativen zum Schutz von Mietern rivalisieren miteinander. In diesem Klima löst auch eine Transparenzoffensive Misstrauen aus. Auch wir gerieten zwischen verschiedene Fronten.