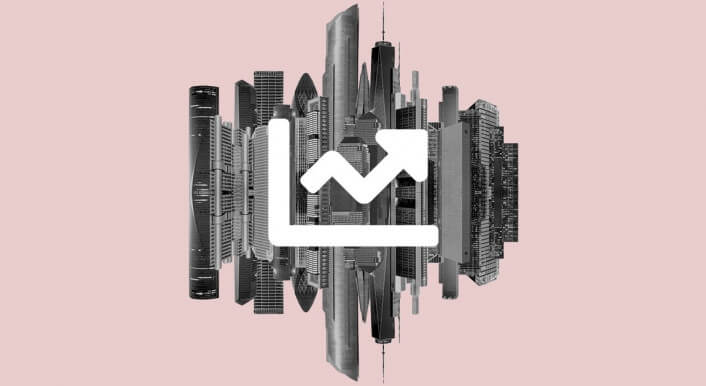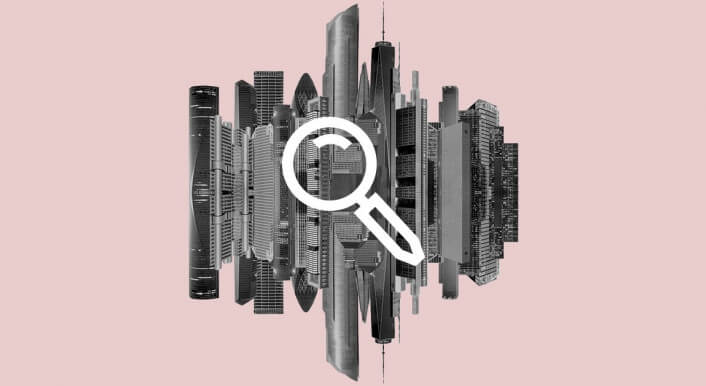Theater tut, was Journalismus nicht kann
Dreißig Journalisten – ein Regisseur. Helge Schmidt hat aus den CumEx-Files ein Theaterstück gemacht. Damit bringt CORRECTIV schon zum zweiten Mal eine Recherche auf die Bühne. Weil Theater kann, was wir nicht können.

Glitzerfolienschnipsel rieseln von der Decke herab – oder eher: sie stürzen. Weil es so viele sind, und weil selbst Plastikfolie ein Gewicht hat, wenn man genug davon in einen Sack steckt. Von der Seite der Bühne schleppt eine Frau einen weiteren Sack heran, kippt noch mehr Glitzer heraus, noch mehr Schnipsel. Jetzt wälzen sie sich darin, drei Menschen in Business-Kleidung, reiben sich mit den Glitzerschnipseln ein, werfen sie sich in die Gesichter, tanzen, lachen – und man wäre gerne dabei. Man würde gern aufstehen und sich hinwerfen und mitwälzen. Aber man ist nur Zuschauer.
31,8 Milliarden Euro – das ist eine Zahl, die in den letzten Wochen oft auf Zeitungspapier stand. Tagesschausprecher haben die Zahl gesagt und Moderatoren in Podiumsdiskussionen. Und trotzdem ist diese Zahl erst verständlich, wenn man sie sieht: Wenn ein Regisseur 100 Kilogramm Glitzerfolienschnipsel (die Schauspieler nennen sie „Flitterfettis“) auf eine Bühne legt und ihnen einen Umrechnungskurs gibt. „30 dieser Flitterfettis“, sagt der Mann, der den gealterten Benjamin Frey spielt, den Whistleblower der Cum-Ex-Files, der selbst CumEx-Geschäfte gemacht hat, „sind eine halbe Million Euro.“ Er sagt das, während er in einem Berg aus Glitzer steht. Eine halbe Million Euro ist nichts, wenn es um den größten Steuerraub in der europäischen Geschichte geht.
Das Stück Die CumEx Papers, inszeniert vom Hamburger Regisseur Helge Schmidt, gespielt von Ruth Marie Kröger, Jonas Anders und Günter Schaupp, ist quasi der Film zum Buch – die Visualisierung zur Recherche von CORRECTIV und 19 weiteren Medienpartnern aus mehreren europäischen Ländern. Wer das Stück sieht, versteht einerseits ein wenig besser, um welche Geldberge es geht – und andererseits, wo Journalismus aufhört.
Erzählen, was nicht ist
Die Rolle des Whistleblowers Benjamin Frey teilen sich zwei Schauspieler, einer spielt den jungen Frey, einer den alten. Beide tragen Anzug, natürlich, und halten sich in einer Szene Masken vors Gesicht: Wolfgang Schäuble, Peer Steinbrück, Männer in Anzügen eben. Denn die CumEx-Welt kommt ohne Frauen aus, sie wird gesteuert und konzipiert von Anzugträgern, die alle gleich sind. Es ist eine Vermutung, dass die Gleichförmigkeit der Beteiligten die Geschäfte womöglich vereinfacht hat: Gleich und gleich vertrauen einander. Die Anzugträger aus der Politik und die Anzugträger aus der Finanzbranche treten sich nicht gegenseitig auf ihre Anzugschuhe – das ist ein Gedanke, den Helge Schmidt in mehreren Szenen auf die Bühne bringt. Um solche Nuancen zu erzählen, solche Gedanken und Vermutungen, bräuchten Journalisten einen Beweis, eine Szene aus der Realität. Das Theater stellt die Szene selbst her.
Schubsen und Sticheln
So kniet der gealterte Benjamin Frey, der Whistleblower, der die Geschäfte moralisch nicht mehr vertreten konnte und sich deshalb der Polizei stellte, gegen Ende des Stücks auf der Bühne. Er quäkt. Heult rum. Trägt eine rote Käppi, sieht aus wie ein Achtjähriger mit dem Gesicht eines Fünfzigjährigen. „Ich wollte doch nur eine Villa auf Mallorca“, weint er.
Wer sich als Journalist mit Menschen trifft, muss ihnen neutral begegnen, aufgeschlossen – ob man denkt, dass da ein Verbrecher sitzt, ist egal. Auch mit Verbrechern muss man reden, sonst findet man nichts heraus. Einen Whistleblower darf man deshalb kritisieren, aber man macht sich nicht über ihn lustig. Theater hingegen darf respektlos sein. Emotional. Witzig. Ironie auf Papier macht in den allerwenigsten Fällen Spaß, und meistens versteht man sie nicht.
Das Stück von Helge Schmidt ist deshalb dort am stärksten, wo es übers Erklären hinaus geht, wo es die Realität interpretiert anstatt sie nur zu zeigen. Nur manche Szenen geben Anlass zum Augenrollen: Natürlich muss geschrien werden auf der Bühne, es muss ein bisschen Nacktheit geben und Gespräche mit dem Publikum. Das ist die Postmoderne, da muss man wohl durch, als Zuschauer und Regisseur und Schauspieler gleichermaßen.
Am peinlichsten und gleichzeitig am bedeutungsvollsten sind die Schreie der Empörung. Als es im Stück zum ersten Mal um die Ungerechtigkeit geht, um den Griff in die Steuerkasse, das Stehlen aus Geldern, die nicht für Reiche, sondern für Umverteilung bestimmt waren, fallen die zwei Benjamin Freys aus der Rolle. Gemeinsam mit der Hauptdarstellerin echauffieren sie sich über die Sache, weinen fast vor Wut. Das wirkt lächerlich. Weil sich in der Realität niemand empört, weil niemand schreit, demonstriert, erschüttert ist. Nur im Theater. Da geht das.
Cum-Ex-Themenseite – Häufig gestellte Fragen und aktuelle Recherchen